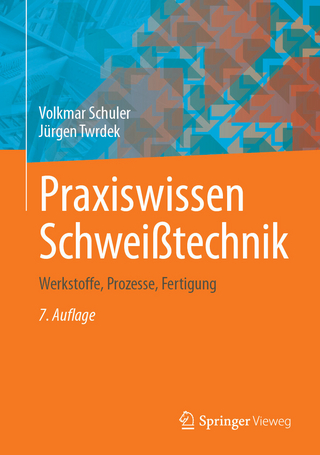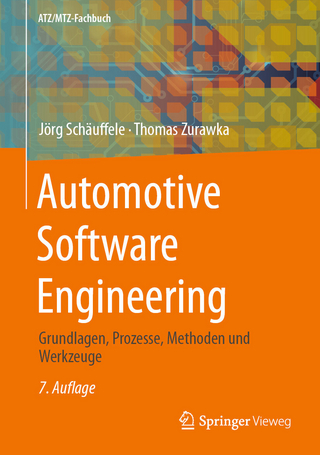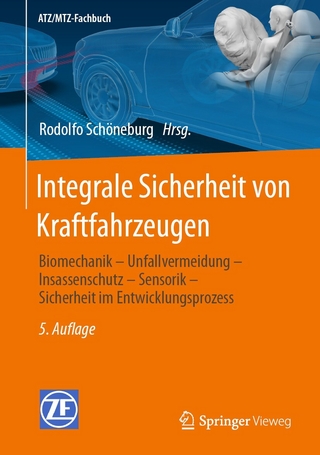Handbuch des Spezialtiefbaus (E-Book) (eBook)
1036 Seiten
Reguvis Fachmedien GmbH (Verlag)
978-3-8462-1276-9 (ISBN)
Autoreninfo: *Prof. Dr.-Ing. Rolf Katzenbach* ist Universitätsprofessor, Geschäftsführender Gesellschafter der Ingenieursozietät Professor Dr.-Ing. Katzenbach GmbH und öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger mit jahrzehntelanger Erfahrung im Spezialtiefbau. *Prof. Dr.-Ing. Steffen Leppla* lehrt und forscht an der Frankfurt University of Applied Sciences im Bereich des Spezialtiefbaus und ist beratend in der Ingenieursozietät Professor Dr.-Ing. Katzenbach GmbH tätig.
Vorwort 6
Autoren 36
1 Spezialtiefbau 46
1.1 Einführung 46
1.2 Historische Entwicklung 47
1.3 Beispiele aus der Ingenieurpraxis 48
1.3.1 Wiedernutzung von Bestandsbauteilen 48
1.3.2 Entwicklungen im Hochhausbau 50
1.3.3 Innerstädtische Großbaumaßnahmen und Tiefe Baugruben 52
1.3.4 Spezialtiefbau und Geothermie 56
1.4 Technische Regelungen im Spezialtiefbau 57
1.5 Literatur 58
2 Baugrunderkundung 62
2.1 Grundlagen der Baugrunderkundung 62
2.2 Vorstudie 64
2.2.1 Allgemeines 64
2.2.2 Geologische und ingenieurgeologische Karten 64
2.2.3 Gefahrenhinweis- und Risikokarten 65
2.2.4 Erdbebengefährdung 66
2.3 Art und Umfang der Baugrunderkundung 67
2.4 Felduntersuchungen 68
2.4.1 Rechtliche Grundlage 68
2.4.2 Probenentnahmeverfahren 70
2.4.2.1 Allgemeines 70
2.4.2.2 Schürfe 72
2.4.2.3 Bohrungen 73
2.4.2.3.1 Allgemeines 73
2.4.2.3.2 Rotationskernbohrungen 74
2.4.2.3.3 Rammkernbohrungen 78
2.4.3.2.4 Kleinbohrungen 79
2.4.2.4 Berichterstattung 79
2.4.3 Feldversuche 80
2.4.3.1 Allgemeines 80
2.4.3.2 Rammsondierungen (DP) 80
2.4.3.3 Bohrlochrammsondierungen (BDP) und Standard Penetration Test (SPT) 82
2.4.3.4 Drucksondierungen (CPT) 83
2.4.3.5 Flügelsondierungen (FVT) 86
2.4.3.6 Bohrlochaufweitungsversuche 87
2.4.3.7 In-situ-Scherversuch mittels Phicometersonde 88
2.4.3.8 Geohydraulische Feldversuche 89
2.4.3.8.1 Allgemeines 89
2.4.8.3.2 Wasserdurchlässigkeitsversuche in einem Bohrloch unter Verwendung offener Systeme 90
2.4.3.8.3 Wasserdruckversuche im Fels 91
2.4.3.8.4 Pumpversuche 92
2.4.3.8.5 Infiltrometerversuche 93
2.4.3.8.6 Wasserdurchlässigkeitsversuche im Bohrloch unter Verwendung geschlossener Systeme 93
2.4.4 Erfassen der Grundwasserverhältnisse 93
2.4.4.1 Allgemeines 93
2.4.4.2 Grundwassermessstellen 94
2.4.4.3 Grundwasserprobenentnahme 95
2.4.4.4 Grundwasserstandsmessungen 96
2.5 Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden und Fels 96
2.5.1 Benennung und Beschreibung von Boden 96
2.5.2 Klassifizierung von Böden nach DIN 18196:2011 97
2.5.3 Benennung und Beschreibung von Gestein und Gebirge (Fels) 101
2.5.3.1 Allgemeines 101
2.5.3.2 Mineralbestand und Korngefüge 102
2.5.3.3 Porosität 106
2.5.3.4 Verwitterung 107
2.5.3.5 Trennflächengefüge 108
2.5.3.6 Beschreibung von Kernproben 113
2.5.4 Beschreibung und Einstufung von Boden und Fels nach den ATV der VOB 115
2.5.4.1 Allgemeines 115
2.5.4.2 Boden- und Felsklassen nach ATV DIN 18300 Erdarbeiten 115
2.5.4.3 Boden- und Felsklassen für Bohrarbeiten 118
2.5.5 Bohrlochmessungen 119
2.5.5.1 Allgemeines 119
2.5.5.2 Bohrlochsondierungen 120
2.5.5.3 Bohrlochabweichungsmessungen 120
2.6 Literatur 120
3 Tiefgründungen 122
3.1 Allgemeines 122
3.2 Pfahlgründungen 122
3.2.1 Allgemeines 122
3.2.2 Allgemeine Konstruktionsgrundlagen 123
3.2.2.1 Pfahlanordnung 123
3.2.2.2 Entwurf und Bemessung 125
3.2.2.3 Lastangriff und Lastabtragung 125
3.2.3 Grundbegriffe für Pfahlgründungen 127
3.2.3.1 Mantelreibung 127
3.2.3.2 Negative Mantelreibung 127
3.2.3.3 Pfahlspitzenwiderstand 128
3.2.3.4 Horizontale Belastung von Pfählen 128
3.2.3.5 Spitzendruckpfähle 129
3.2.3.6 Schwimmende Pfahlgründung 129
3.2.3.7 Zugpfähle 130
3.2.3.8 Schutzpfähle 130
3.2.4 Wahl der Pfahlart 131
3.2.5 Herstelleinflüsse auf die Tragfähigkeit von Pfählen 132
3.3 Bohrpfähle 132
3.3.1 Allgemeines 132
3.3.2 Normen und Vorschriften 133
3.3.2.1 Allgemeines 133
3.3.2.2 Definitionen und Geltungsbereiche 133
3.3.2.3 Wesentliche Regelungen der DIN EN 1536 [4] 134
3.3.2.3.1 Allgemeines 134
3.3.2.3.2 Bohrarbeiten 135
3.3.2.3.3 Bewehren 136
3.3.2.3.4 Betonieren 136
3.3.2.3.5 Bemessungshinweise 138
3.3.3 Einbaustoffe und Materialien 138
3.3.3.1 Allgemeines 138
3.3.3.2 Beton 138
3.3.3.2.1 Allgemeines 138
3.3.3.2.2 Kenndaten und Grundbegriffe 139
3.3.3.2.3 Zemente 140
3.3.3.2.4 Betoneigenschaften 140
3.3.3.2.5 Transportbeton 145
3.3.3.2.6 Befördern und Fördern von Frischbeton 149
3.3.3.2.7 Einbringen des Betons 149
3.3.3.2.8 Betonüberwachung während der Bauausführung 150
3.3.3.2.9 Umfang der Frischbetonuntersuchungen auf der Baustelle 151
3.3.3.2.10 Festbeton 154
3.3.3.2.11 Besondere Anforderungen an Pfahlbeton 155
3.3.3.3 Bewehrung 156
3.3.3.3.1 Allgemeines 156
3.3.3.3.2 Stahlsorten und Kennzeichnung 156
3.3.3.3.3 Lieferung, Abnahme und Lagerung 158
3.3.3.3.4 Besondere Hinweise für die Bohrpfahlbewehrung 159
3.3.3.4 Stützflüssigkeit 162
3.3.3.4.1 Allgemeines 162
3.3.3.4.2 Bentonitsuspension 162
3.3.3.4.3 Überwachung der Suspensionsqualität 163
3.3.3.4.4 Hinweise der DIN EN 1536 [4] 163
3.3.3.4.5 Aufbereitung und Entsorgung der Suspension 165
3.3.3.4.6 Stützwirkung in fein- und grobkörnigen Böden 165
3.3.4 Bohrpfahlsysteme und Herstellverfahren 166
3.3.4.1 Allgemeines 166
3.3.4.2 Greiferbohrverfahren 166
3.3.4.2.1 Allgemeines 166
3.3.4.2.2 Greiferbohrverfahren in unverrohrter Bohrung 168
3.3.4.2.3 Greiferbohrverfahren mit Bohrlochsicherung durch Stützflüssigkeit 168
3.3.4.2.4 Greiferbohrverfahren in voll verrohrter Bohrung 169
3.3.4.2.5 Abteufen der Verrohrung 170
3.3.4.3 Drehbohrverfahren 172
3.3.4.3.1 Allgemeines 172
3.3.4.3.2 Kelly-Bohrverfahren in unverrohrter Bohrung 172
3.3.4.3.3 Kelly-Bohrverfahren mit Bohrlochsicherung durch Stützflüssigkeit 172
3.3.4.3.4 Kelly-Bohrverfahren in voll verrohrter Bohrung 173
3.3.4.3.5 Pfahlherstellung mit durchgehender Hohlbohrschnecke 175
3.3.4.3.6 Pfahlherstellung im Doppelkopfsystem 177
3.3.4.4 Spülbohrverfahren 178
3.3.4.4.1 Allgemeines 178
3.3.4.4.2 Rotary-Bohrverfahren (direktes Verfahren) 179
3.3.4.4.3 Saugbohrverfahren (indirektes Verfahren) 180
3.3.4.4.4 Lufthebeverfahren (indirektes Verfahren) 181
3.3.4.5 Pfahlfußerweiterungen 182
3.3.4.6 Mantel- und Fußverpressungen 183
3.3.4.6.1 Allgemeines 183
3.3.4.6.2 Mantelverpressung 184
3.3.4.6.3 Fußverpressung 186
3.3.4.6.4 Kombination von Fuß- und Mantelverpressung 187
3.3.5 Geräte- und Werkzeugtechnik 188
3.3.5.1 Seilbagger 188
3.3.5.2 Hydraulikbagger 190
3.3.5.3 Drehbohrgeräte 190
3.3.5.3.1 Drehbohreinrichtungen ohne geführte Drehantriebe 190
3.3.5.3.2 Drehbohrgeräte mit feststehenden Drehantrieben 191
3.3.5.3.3 Drehbohrgeräte mit geführten Drehantrieben 192
3.3.5.4 Spülbohranlagen 198
3.3.5.4.1 Allgemeines 198
3.3.5.4.2 Aufsatzbohranlagen 198
3.3.5.5 Verrohrungseinrichtungen 199
3.3.5.5.1 Allgemeines 199
3.3.5.5.2 Verrohrung über den Kraftdrehkopf des Drehbohrgerätes 200
3.3.5.5.3 Hydraulische Verrohrungsmaschinen – oszillierend 201
3.3.5.5.4 Hydraulische Verrohrungsmaschinen – durchdrehend 203
3.3.5.5.5 Vibrationsverfahren 204
3.3.5.6 Verrohrung 205
3.3.5.6.1 Allgemeines 205
3.3.5.6.2 Bohrrohre ohne Verbindungselemente 206
3.3.5.6.3 Nietbohrrohre (Brunnenrohre) 206
3.3.5.6.4 Bohrrohre mit Gewindeverbindung 206
3.3.5.6.5 Bohrrohre mit Schnellverbindung 206
3.3.5.6.6 Schneidschuhe bzw. Bohrkronen 208
3.3.5.6.7 Schneidschuhbestückung 208
3.3.5.6.8 Bohrrohrtrichter 208
3.3.5.6.9 Bohrrohrgehänge 209
3.3.5.6.10 Grundsätzliche Hinweise 209
3.3.5.7 Schlagbohrwerkzeuge 210
3.3.5.7.1 Allgemeines 210
3.3.5.7.2 Mechanische Seilbohrgreifer 210
3.3.5.7.3 Hydraulische Seilbohrgreifer 211
3.3.5.7.4 Mechanische und hydraulische Brunnen- bzw. Schachtbohrgreifer 211
3.3.5.7.5 Kiespumpen 212
3.3.5.7.6 Schlamm- und Schlagbüchsen 212
3.3.5.7.7 Bohrmeißel 213
3.3.5.8 Drehbohrwerkzeuge 214
3.3.5.8.1 Allgemeines 214
3.3.5.8.2 Meißel und Pilotbohrer für Drehbohrwerkzeuge 215
3.3.5.8.3 Bohrschnecken 216
3.3.5.8.4 Bohreimer 217
3.3.5.8.5 Kernrohre 219
3.3.5.8.6 Rollenmeißel-Kernrohre 219
3.3.5.8.7 Pfahlfußerweiterungsschneider 220
3.3.5.8.8 Endlosbohrschnecken 221
3.3.5.8.9 Tieflochhämmer 222
3.3.5.8.10 Spülbohrverfahren mit Rollenmeißel-Flachbohrköpfen 223
3.3.5.8.11 Zubehör für Drehbohrwerkzeuge 224
3.3.5.9 Sonstige Geräte 226
3.3.5.9.1 Betoniergeräte 226
3.3.5.9.2 Arbeitskörbe bzw. -bühnen 227
3.3.5.9.3 Pumpen 227
3.3.5.9.4 Befahrungskorb 227
3.3.5.9.5 Weiteres Zubehör 228
3.3.6 Arbeitsvorbereitung und Ausführung 228
3.3.6.1 Allgemeines 228
3.3.6.2 Baustellenbesichtigung und Anfahrtsbeschreibung 230
3.3.6.3 Gerätekonfiguration und Transporte 230
3.3.6.4 Arbeiten auf der Baustelle 230
3.3.6.5 Ausführungshinweise 232
3.3.6.5.1 Bohrtechnik 232
3.3.6.5.2 Bewehren 233
3.3.6.5.3 Betonieren 233
3.3.6.5.4 Nacharbeiten 234
3.3.6.5.5 Protokollierung 234
3.3.7 Pfahlprobebelastungen 235
3.3.7.1 Allgemeines 235
3.3.7.2 Statische Pfahlprobebelastung 236
3.3.7.3 Pfahlprobebelastungen mit einbetonierten Hydraulikzylindern 236
3.3.7.4 Dynamische Pfahlprobebelastungen 237
3.3.8 Bemessung 238
3.3.8.1 Allgemeines 238
3.3.8.2 Äußere Tragfähigkeit 238
3.3.9.3 Tragverhalten und Widerstände von Bohrpfählen und Pfahlgruppen 238
3.3.9.4 Bohrpfähle unter horizontaler Beanspruchung 239
3.3.9.5 Pfahlgruppen 240
3.3.9.6 Zugpfähle und Zugpfahlgruppen 240
3.3.9.7 Innere Tragfähigkeit 241
3.3.9.8 Schlussbetrachtung 241
3.4 Verdrängungspfähle 241
3.4.1 Normung und Definitionen 241
3.4.2 Pfahlsysteme 242
3.4.2.1 Fertigpfähle 242
3.4.2.1.1 Holzrammpfähle 242
3.4.2.1.2 Stahlrammpfähle 243
3.4.2.1.3 Stahlbetonrammpfähle 247
3.4.2.2 Ortbeton-Verdrängungspfähle 250
3.4.2.2.1 Ortbeton-Rammpfähle 250
3.4.2.2.2 Ortbeton-Schraubpfähle 256
3.4.2.3 Verpresste Verdrängungspfähle 261
3.4.2.3.1 Allgemeines 261
3.4.2.3.2 MV-Pfahl 262
3.4.2.3.3 RI-Pfahl 263
3.4.2.3.4 Verpresste Rohrpfähle 264
3.4.2.3.5 Eingepresste Verdrängungspfähle 264
3.4.3 Gerätetechnik 265
3.4.3.1 Allgemeines 265
3.4.3.2 Geräte für Fertigpfähle 265
3.4.3.3 Geräte für Ortbeton-Verdrängungspfähle 267
3.4.3.4 Drehantriebe und Zieheinrichtungen 270
3.4.3.5 Betoniereinrichtungen 272
3.4.3.6 Ramm- und Bohrrohre 272
3.4.4 Arbeitsvorbereitung und Ausführung 272
3.4.4.1 Allgemeines 272
3.4.4.2 Baugrundaufschluss 273
3.4.4.3 Wahl des Pfahlsystems 273
3.4.4.4 Baustellenbesichtigung und Anfahrtsbeschreibung 273
3.4.4.5 Arbeitsplanum 274
3.4.4.6 Maßnahmen vor und während der Arbeiten 274
3.4.5 Bemessungsgrundlagen 275
3.4.5.1 Allgemeines 275
3.4.5.2 Nachweis der inneren Tragfähigkeit 275
3.4.5.3 Nachweis der äußeren Tragfähigkeit 275
3.4.5.3.1 Nachweis durch Probebelastungen 276
3.4.5.3.2 Nachweis über Erfahrungswerte 276
3.4.5.4 Entwurfskriterien 277
3.5 Pfähle mit kleinen Durchmessern (Mikropfähle) 277
3.5.1 Normung und Definitionen 277
3.5.1.1 Allgemeines 277
3.5.1.2 Geltungsbereich 278
3.5.1.3 Begriffe 279
3.5.1.4 Aspekte für den Einsatz von Mikropfählen 280
3.5.2 Mikropfahl-Systeme 280
3.5.2.1 Ortbetonpfahl 280
3.5.2.2 Verbundpfahl 280
3.5.2.3 Fertigpfahl 281
3.5.2.4 Anwender-Pfahlsysteme 281
3.5.2.4.1 GEWI®-Pfahl, System »DYWIDAG« 281
3.5.2.4.2 Verbundpfahl System Stump 284
3.5.2.4.3 Bauer-SVV-Mikropfahl 285
3.5.2.4.4 Ischebeck-Injektions-Pfahl 285
3.5.2.4.5 Duktilpfahl 286
3.5.2.4.6 MESI-Pfahlsystem 288
3.5.3 Geräte- und Werkzeugtechnik 289
3.5.3.1 Allgemeines 289
3.5.3.2 Bohrgeräte 290
3.5.3.3 Misch- und Verpressgeräte 291
3.5.3.4 Bohrrohre und Bohrgestänge 292
3.5.3.4.1 Allgemeines 292
3.5.3.4.2 Bohr- und Rohrsysteme, Bohrkronen 293
3.5.3.5 Kraftdrehköpfe und Bohrhämmer 294
3.5.3.5.1 Allgemeines 294
3.5.3.5.2 Kraftdrehköpfe 294
3.5.3.5.3 Hydraulik-Bohrhämmer 294
3.5.3.5.4 Doppelkopf-Bohranlagen 296
3.5.4 Verfahrenstechnik und Arbeitsvorbereitung 296
3.5.4.1 Allgemeines 296
3.5.4.2 Anwendungsgebiete der einzelnen Bohrverfahren 298
3.5.4.3 Einbringen des Mikropfahls 298
3.5.4.4 Verpressen 299
3.5.4.5 Nachverpressen 300
3.5.4.6 Herstellprotokoll 300
3.5.4.7 Güteprüfung 300
3.5.4.8 Erkundung des Baugrunds 300
3.5.4.9 Erkundung bestehender baulicher Anlagen 300
3.5.5 Bemessungsgrundlagen 301
3.5.5.1 Innere und äußere Tragfähigkeit 301
3.5.5.2 Nachweis der äußeren Tragfähigkeit 301
3.5.5.3 Nachweis der inneren Tragfähigkeit 303
3.5.5.4 Biegebeanspruchung 303
3.6 Spezielle Gründungselemente 303
3.6.1 Allgemeines 303
3.6.2 Normung und Definitionen 304
3.6.2.1 Normung 304
3.6.2.2 Einbaustoffe und Materialien 304
3.6.3 Systeme und Verfahrenstechnik 304
3.6.3.1 Allgemeines 304
3.6.3.2 Rüttelstopfsäulen 304
3.6.3.3 Vermörtelte Stopfsäulen 305
3.6.3.4 Fertigmörtel-Stopfsäulen (FSS) 305
3.6.3.5 Ortbetonrüttelsäulen 306
3.6.3.6 CMC-Säulen 307
3.6.3.7 Düsenstrahl-(DSV)-Säulen 309
3.6.3.7.1 Allgemeines 309
3.6.3.7.2 Beschreibung des Herstellverfahrens 310
3.6.4 Geräte- und Werkzeugtechnik 311
3.6.4.1 Allgemeines 311
3.6.4.2 Trägergeräte 311
3.6.4.3 Radlader 313
3.6.4.4 Mess-, Kontroll- und Erfassungseinrichtungen 313
3.6.4.5 Schleusenrüttler 313
3.6.4.6 Energie- und Hilfsgeräte 315
3.6.5 Arbeitsvorbereitung 315
3.6.6 Bemessungsgrundlagen 315
3.6.6.1 Äußere Tragfähigkeit 315
3.6.6.2 Innere Tragfähigkeit 316
3.7 Brunnengründungen und offene Senkkastengründungen 316
3.7.1 Allgemeines 316
3.7.2 Normung 317
3.7.3 Geräte- und Werkzeugtechnik 318
3.7.4 Arbeitsvorbereitung 318
3.7.5 Einbaustoffe und Materialien 318
3.7.6 Verfahrenstechnik 320
3.7.6.1 Allgemeines 320
3.7.6.2 Absenkvorgang 320
3.7.6.3 Handschachtung 321
3.7.6.4 Baggerschachtung 321
3.7.6.5 Hydromechanischer Aushub 322
3.7.6.6 Betonieren und Verfüllen 322
3.7.7 Anwendungsbeispiele 323
3.7.8 Bemessungsgrundlagen 325
3.7.8.1 Allgemeines 325
3.7.8.2 Äußere Tragfähigkeit 326
3.7.8.3 Innere Tragfähigkeit 326
3.8 Druckluftgründungen 326
3.8.1 Allgemeines 326
3.8.2 Vor- und Nachteile 328
3.8.3 Normung 328
3.8.4 Geräte- und Werkzeugtechnik 328
3.8.5 Arbeitsvorbereitung 330
3.8.6 Konstruktion der Senkkästen 330
3.8.6.1 Bauteile 330
3.8.6.2 Querschnittsformen 331
3.8.6.3 Schneiden 331
3.8.7 Verfahrenstechnik 331
3.8.8 Wiedergewinnbare Arbeitskammern 332
3.8.9 Bemessungsgrundlagen 332
3.9 Literatur 333
4 Rammen 340
4.1 Herausforderungen der Rammverfahren 343
4.2 Physikalische Grundlagen des Rammens 344
4.2.1 Impuls und Kraftverlauf bei Hämmern und Rüttlern 344
4.2.1.1 Unbeschleunigter Hydraulikhammer 346
4.2.1.2 Dieselhammer 347
4.2.1.3 Beschleunigte (doppelt wirkende) Hämmer 348
4.2.1.4 Vergleich der Schlagfrequenz 350
4.2.1.5 Gerichtete Rüttler 350
4.2.1.6 Rüttler mit Auflast 354
4.2.2 Einfluss der Rüttleramplitude 355
4.2.3 Energiebetrachtung 357
4.2.3.1 Energiebetrachtung beim Hammer 357
4.2.3.2 Energiebetrachtung beim Rüttler 361
4.2.4 Physik der Interaktion zwischen Krafterzeuger, Rammgut und Boden 362
4.3 Arten von Rammgütern 364
4.3.1 Pfähle 365
4.3.2 Wandelemente 366
4.4 Hämmer (Rammbären) 370
4.4.1 Druckluft- bzw. Dampfhämmer 372
4.4.2 Dieselhämmer 372
4.4.3 Einfach wirkende Hydraulikhämmer 379
4.4.4 Beschleunigte (doppelt wirkende) Hydraulikhämmer 381
4.4.5 Rammhaube und Schlagplatte 385
4.4.6 Messeinrichtungen 387
4.5 Rüttler (Vibrationsbären) 389
4.5.1 Baggeranbaurüttler 395
4.5.2 Freireitende Rüttler 396
4.5.3 Mäklerrüttler 398
4.5.4 Gürtelrüttler 401
4.5.5 Seitengriffrüttler 402
4.5.6 Gerichtetes Rütteln 402
4.5.7 Spannzangen 406
4.5.8 Rüttlersteuerung 410
4.5.9 Dokumentation des Rüttelprozesses 411
4.6 Trägergeräte zum Rammen 413
4.6.1 Telemäklergeräte 414
4.6.2 Starrmäklergeräte 418
4.6.3 Gleisgebundene Universalgeräte 421
4.6.4 Universelle Einsätze von Teleskop- und Starrmäklergeräten 422
4.6.5 Rammgeräte für Hammeranbau 423
4.6.6 Anbaumäkler für Kräne 425
4.6.7 Freihängende Mäkler an Kränen 426
4.6.8 Elektrifizierte Trägergeräte 428
4.7 Pressen 430
4.7.1 Schwergewichts-Pressen 430
4.7.2 Selbstschreitende Spundwandpressen 432
4.7.3 Mäklergeführte Spundwandpressen 435
4.8 Verfahrensaspekte 436
4.8.1 Zu hoher Rammwiderstand 436
4.8.2 Bohlenführungen bei Spundwänden 438
4.8.3 Abweichen von Spundwänden von der Soll-Lage 439
4.8.4 Korrektur der Wandlänge einer Spundwand 440
4.8.5 Mitnahme der schon gerammten Nachbarbohle 441
4.8.6 Spundwände unter begrenzter Raumhöhe 441
4.8.7 Verbesserung der Dichtheit von Spundwänden 442
4.8.8 Sicherheitsaspekte 442
4.9 Offshore-Anwendungen 443
4.9.1 Hämmer 446
4.9.1.1 Hämmer für oberflächennahe Anwendungen 446
4.9.1.2 Hämmer für Tiefseeanwendungen 449
4.9.2 Rüttler 452
4.9.3 Unterstützende Maßnahmen 456
4.9.4 Alternative Methoden 462
4.10 Literatur 469
4.11 Danksagung 476
5 Baugruben 478
5.1 Allgemeines 478
5.1.1 Normung und Bemessung 482
5.2 Häufige Planungsfehler 486
5.3 Geböschte Baugruben und geböschte Gräben 487
5.4 Baugrubenwände 491
5.4.1 Allgemeines 491
5.4.2 Grabenverbau 491
5.4.2.1 Grabenverbaugeräte 491
5.4.2.2 Waagerechter Grabenverbau 493
5.4.2.3 Senkrechter Grabenverbau 493
5.4.3 Trägerbohlwände 495
5.4.3.1 Allgemeines 495
5.4.3.2 Ausführungsformen von Trägerbohlwänden 496
5.4.3.3 Verfahrenstechnik 496
5.4.3.3.1 Vorbereitende Maßnahmen 497
5.4.3.3.2 Senkrechte Bohlträger 497
5.4.3.3.3 Ausfachung 499
5.4.3.3.4 Aussteifung bzw. Rückverankerung 508
5.4.3.3.5 Rückbau 514
5.4.3.4 Sonderform Essener Verbau 514
5.4.4 Spundwände 515
5.4.4.1 Allgemeines 515
5.4.4.2 Spundwandprofile und Stahlsorten 518
5.4.4.3 Verfahrenstechnik 523
5.4.4.3.1 Vorbereitende Maßnahmen 523
5.4.4.3.2 Einbringen der Spundbohlen 523
5.4.4.3.3 Aussteifung und Rückverankerung 528
5.4.4.3.4 Rückbau 530
5.4.4.4 Konstruktive Details 530
5.4.4.4.1 Eck- und Abzweigprofile 530
5.4.4.4.2 Wasserdichtheit von Spundwandschlössern 531
5.4.4.4.3 Schlossschäden 533
5.4.4.4.4 Korrosionsschutz 534
5.4.4.5 Sonderformen und Sonderbauweisen (Fangedämme) 535
5.4.5 Pfahlwände 537
5.4.5.1 Allgemeines 537
5.4.5.2 Ausführungsformen von Pfahlwänden 539
5.4.5.3 Verfahrenstechnik 544
5.4.5.3.1 Vorbereitende Maßnahmen 544
5.4.5.3.2 Herstellung der Bohrungen 545
5.4.5.3.3 Bewehren 548
5.4.5.3.4 Betonieren 551
5.4.5.3.5 Aussteifung und Rückverankerung 552
5.4.5.3.6 Nacharbeiten 554
5.4.6 Schlitzwände 555
5.4.6.1 Allgemeines 555
5.4.6.2 Ausführungsformen von Schlitzwänden 558
5.4.6.3 Verfahrenstechnik 558
5.4.6.3.1 Vorbereitende Maßnahmen 559
5.4.6.3.2 Herstellung einer Ortbetonschlitzwand im Zweiphasenverfahren 562
5.4.6.3.3 Herstellung einer Dichtungsschlitzwand mit eingestellten vertikalen Tragelementen im Einphasenverfahren 571
5.4.6.3.4 Aussteifung und Rückverankerung 576
5.4.6.3.5 Nacharbeiten 578
5.4.6.4 Geräte und Werkzeugtechnik 578
5.4.6.4.1 Baustelleneinrichtung 578
5.4.6.4.2 Trägergeräte 578
5.4.6.4.3 Schlitzwandgreifer 580
5.4.6.4.4 Schlitzwandfräsen 583
5.4.6.4.5 Meißel 586
5.4.6.4.6 Abschalelemente 587
5.4.6.4.7 Rohrziehmaschinen 592
5.4.6.4.8 Betoniereinrichtung 593
5.4.6.4.9 Aufbereitungsanlagen 594
5.4.7 Erdbetonwände (Mixed-in-Place) 597
5.4.7.1 Allgemeines 597
5.4.7.2 Ausführungsformen von Erdbetonwänden 599
5.4.7.3 Verfahrenstechnik 600
5.4.8 Elementwände 604
5.4.8.1 Allgemeines 604
5.4.8.2 Ausführungsformen von Elementwänden 605
5.4.8.2.1 Geschlossene Elementwände 605
5.4.8.2.2 Aufgelöste Elementwände 607
5.4.9 Bodenvernagelung 609
5.4.9.1 Allgemeines 609
5.4.9.2 Ausführungsformen von Bodenvernagelungen 610
5.4.9.3 Verfahrenstechnik 611
5.4.10 Injektionswände 612
5.4.10.1 Allgemeines 612
5.4.10.2 Ausführungsformen 614
5.4.10.3 Verfahrenstechnik 615
5.4.11 Gefrierverfahren 616
5.4.11.1 Allgemeines 616
5.4.11.2 Verfahrenstechnik 618
5.4.11.2.1 Verfahrenstechnik 618
5.4.11.2.2 Herstellung der Gefrierlanzen 619
5.4.11.2.3 Gefrierinstallation zur Herstellung des Gefrierkörpers 619
5.4.11.2.4 Herstellung und Aufrechterhalten des Frostkörpers 621
5.4.11.2.5 Messtechnische Überwachung 621
5.5 Horizontale Baugrubenumschließungen bei Baugruben im Grundwasser 622
5.5.1 Allgemeines 622
5.5.2 Grundwasserabsenkung 623
5.5.3 Natürliche Abdichtung 624
5.5.4 Düsenstrahlsohle 625
5.5.5 Unterwasserbetonsohle 628
5.5.6 Weichgelsohle 632
5.6 Besondere Bauweisen 634
5.6.1 Allgemeines 634
5.6.2 Deckelbauweise 634
5.6.3 Baugrubeneinteilung durch Anordnung von Querschotts 636
5.6.4 Baugruben mit besonderem Grundriss 638
5.7 Literaturverzeichnis 639
6 Ankertechnik 646
6.1 Prinzip der Ankertechnik und Geschichte 646
6.2 Geltendes Regelwerk für Verpressanker 647
6.3 Vorgespannte Verpressanker – Definitionen und Abgrenzung von anderen Bauweisen 649
6.3.1 Aufbau und Definitionen 649
6.3.2 Einteilungsmöglichkeiten 651
6.3.2.1 Nutzungsdauer 651
6.3.2.2 Art des Lastabtrags 652
6.3.2.3 Art des Zugglieds 654
6.3.3 Weitere »Anker«-Bauweisen 655
6.3.3.1 Stabverpresspfähle bzw. verpresste Mikropfahl-Zugsysteme 656
6.3.3.2 Boden- und Felsnägel 656
6.3.3.3 Gebirgsanker 656
6.3.3.4 Übersicht – Verpressanker vs. Verpresste Zug-Mikropfähle und Nägel 657
6.4 Komponenten und Materialien von Verpressankern 658
6.4.1 Zugglieder – Materialien, Art und Herstellung 658
6.4.1.1 Stahlzugglieder 658
6.4.1.1.1 Allgemeines 658
6.4.1.1.2 Zugglieder aus Stabstahl (Einstabanker) 658
6.4.1.1.3 Spannstahl-Litzen 661
6.4.1.1.4 Elastizitätsmodul 664
6.4.1.2 Zugglieder aus alternativen Materialien 664
6.4.2 Ankerköpfe & Ankerplatten
6.4.2.1 Allgemeines 664
6.4.2.2 Einstabanker 664
6.4.2.3 Litzenanker 665
6.4.2.3.1 Allgemeines 665
6.4.2.3.2 Winkelabweichungen 667
6.4.3 Verpresskörper 668
6.4.3.1 Allgemeines 668
6.4.3.2 Zementmörtel und Expositionsklassen 668
6.4.4 Korrosionsschutz 669
6.4.4.1 Normative Vorgaben 669
6.4.4.2 Kurzzeitanker 669
6.4.4.3 Daueranker 671
6.4.4.3.1 Litzen-Daueranker 671
6.4.4.3.2 Einstab-Daueranker 675
6.5 Lastabtrag und Herausziehwiderstand 676
6.5.1 Radiale Verspannung und Dilatanz 676
6.5.2 Einfluss von Lagerungsdichte und Relativverschiebung 677
6.5.3 Nachverpressen 679
6.5.4 Vorabschätzung des Herausziehwiderstands 681
6.6 Ausführung von vorgespannten Verpressankern 683
6.6.1 Vorarbeiten 683
6.6.2 Vermessung und Vorbereitung der Ankeransatzpunkte 683
6.6.3 Ankerherstellung – Überblick der einzelnen Arbeitsschritte 684
6.6.4 Herstellen des Bohrlochs & Bohrverfahren
6.6.4.1 Allgemeines 685
6.6.4.2 Drehschlagbohren mit Hydraulikhammer/Drehschlagbohren mit Einfachgestänge 686
6.6.4.3 Überlagerungsbohren mit Hydraulikhammer/Drehschlagen mit Doppelgestänge 687
6.6.4.4 Überlagerungsbohren mit Doppelkopfbohranlage 689
6.6.4.5 Schneckenbohren 691
6.6.4.6 Imlochhammerbohren 692
6.6.4.7 Wahl des richtigen Bohrverfahrens 693
6.6.4.8 Toleranzen 694
6.6.5 Zuggliedeinbau 694
6.6.5.1 Vorarbeiten 694
6.6.5.2 Zuggliedeinbau 695
6.6.6 Primärverpressung/-verfüllung 696
6.6.6.1 Allgemeines 696
6.6.6.2 Innere Verfüllung (Litzendaueranker) 698
6.6.6.3 Begrenzung der Krafteintragungslänge 699
6.6.6.4 Flach geneigte und steigende Anker 700
6.6.7 Nachverpressen 700
6.6.8 Prüfen, Spannen und Festlegen 702
6.6.8.1 Allgemeines 702
6.6.8.2 Arbeitsschritte vor der Ankerprüfung 703
6.6.8.3 Ankerprüfung und Festlegen – Aktives vs. passives Verkeilen 705
6.6.8.4 Sicherheitsaspekte 708
6.6.9 Aufbringen des Korrosionsschutzes 709
6.7 Ankerprüfungen 710
6.7.1 Allgemeines 710
6.7.2 Prüfverfahren und Definitionen 712
6.7.2.1 Ankerprüfung nach Prüfverfahren 1 712
6.7.2.2 Vorlast Pa 716
6.7.2.3 Prüfkraft PP, Prüflastfaktor und Bemessung des Ankerzugglieds 716
6.7.2.4 Kriechmaß ks und Herausziehwiderstand Ra 717
6.7.2.5 Rechnerische freie Stahllänge Lapp 719
6.7.3 Ankerprüfungen nach DIN EN ISO 22477-5 721
6.7.3.1 Untersuchungsprüfung 721
6.7.3.2 Eignungsprüfung 724
6.7.3.3 Abnahmeprüfung 726
6.7.3.4 Empfehlungen für Untersuchungs- und Eignungsprüfungen 727
6.7.4 Messmittel 730
6.7.4.1 Kraftmessung 730
6.7.4.2 Verschiebungsmessung 731
6.7.5 Überwachung 731
6.8 Anker unter Grundwasser 736
6.9 Sonderanker 738
6.9.1 Staffelanker 738
6.9.2 Regulierbare Anker 743
6.9.3 Rückbaubare Anker 744
6.9.4 GFK-Anker 747
6.10 Hinweise zur Planung 748
6.11 Literatur und verwendete Quellen 750
7 Verbesserung des Baugrundes 754
7.1 Einführung 754
7.2 Verdichtung des Bodens 755
7.2.1 Oberflächennahe Verdichtung 755
7.2.2 Tiefe Verdichtung 760
7.2.2.1 Rüttelverdichtung 760
7.2.2.2 Rütteldruckverdichtung 761
7.2.2.3 Rüttelstopfverdichtung 763
7.2.2.4 Fallplattenverdichtung 767
7.2.2.5 Impulsverdichtung 769
7.2.2.6 Sprengverdichtung 770
7.2.2.7 Betonstopfsäulen und Fertigmörtelstopfsäulen 771
7.2.2.8 Betonrüttelsäulen 772
7.3 Vermörtelung des Bodens 773
7.3.1 Oberflächennahe Vermörtelung 774
7.3.2 Mechanische Einbringverfahren für tiefe Vermörtelung 775
7.3.2.1 Mechanische Einbringung von trockenen Bindemitteln 775
7.3.2.2 Mechanische Einbringung von Suspensionen 776
7.3.3 Hydraulische Mischverfahren für tiefe Vermörtelung 780
7.3.3.1 Grundlagen des Düsenstrahlverfahrens 781
7.3.3.1.1 Einphasensystem 784
7.3.3.1.2 Zweiphasensystem 785
7.3.3.1.3 Dreiphasensystem 786
7.3.3.2 Gerätetechnik 787
7.3.3.2.1 Bohr- und Düsgerät 788
7.3.3.2.2 Hochdrucksuspensionspumpe, Hochdruckwasserpumpe 789
7.3.3.2.3 Mischanlage 790
7.3.3.2.4 Zu- und Ableitungen 790
7.3.3.2.5 Düssuspension 790
7.3.3.2.6 Suspensionsrücklauf mit Pumpen und Aufnahmebehältern 791
7.3.3.3 Qualitätssicherung 791
7.3.3.3.1 Kontrolle der Position und der Geometrie 792
7.3.3.3.2 Kontrolle durch Ausgrabung oder Sondierbohrung 793
7.3.3.3.3 Kontrolle durch Tastwerkzeuge 793
7.3.3.3.4 Kontrolle durch Hydrophonverfahren 793
7.3.3.3.5 Kontrolle durch Temperaturmessungen 794
7.3.3.3.6 Kontrolle durch geophysikalische Verfahren 794
7.3.3.4 Maßnahmen bei Abweichungen von geplanter Geometrie, Position oder Materialeigenschaft 795
7.3.3.5 Suspensionsdurchbrüche und Suspensionsausläufer 795
7.3.4 Mechanisch-hydraulische Mischverfahren für tiefe Vermörtelung 797
7.3.4.1 Stabilisierung großer Bodenmassen 797
7.3.4.2 Herstellung von Elementen 797
7.4 Injektionen 798
7.4.1 Injektionsmittel 798
7.4.2 Verringerung der Durchlässigkeit 800
7.4.3 Erhöhung der Festigkeit und Reduzierung der Verformbarkeit 801
7.4.4 Vergrößerung des Volumens 802
7.4.5 Gerätetechnik 803
7.5 Tiefendränage 803
7.6 Bodenvereisung 804
7.6.1 Verfahrensgrundlagen 806
7.6.1.1 Bodenvereisung mit flüssigem Stickstoff 806
7.6.1.2 Bodenvereisung mit Sole 807
7.6.2 Qualitätssicherung 808
7.7 Bewehrung des Bodens 809
7.7.1 Bewehrte Erdkörper 809
7.7.2 Bauausführung 812
7.8 Literatur 814
8 Grabenloser Leitungs- und Tunnelbau 820
8.1 Allgemein 820
8.1.1 Einleitung 820
8.1.2 Planungsgrundlagen und Baugrund 820
8.2 Mikrotunnel- und Tunnelbauverfahren 821
8.2.1 Maschinentechnik 822
8.2.1.1 Tunnelbohrmaschine mit Spülförderung 823
8.2.1.1.1 Stützung der Ortsbrust mit Druckluft 824
8.2.1.1.2 Wasseraufbereitung und Separationstechnik 825
8.2.1.2 Erddruckschilde 826
8.2.1.3 Teilschnittmaschinen 828
8.2.1.4 Hartgesteins-TBMs mit Bandaustrag 828
8.2.1.4.1 Schild-TBMs 829
8.2.1.4.2 Gripper-TBMs 829
8.2.1.5 Regelwerke 830
8.2.2 Tunnelausbau 831
8.2.2.1 Tübbingausbau 831
8.2.2.1.1 Verfahrensbeschreibung 831
8.2.2.1.2 Anwendungsbereiche 833
8.2.2.2 Rohrvortrieb 833
8.2.2.2.1 Verfahrensbeschreibung 834
8.2.2.2.2 Bentonitschmierung 835
8.2.2.2.3 Dehnerstationen 836
8.2.2.2.4 Groß- und Langstreckenrohrvortriebe 837
8.2.2.2.5 Rohrvortrieb als Alternative zum Tübbingausbau 838
8.2.2.2.6 Auslegung von Vortriebsrohren 838
8.2.2.2.7 Kurvenvortriebe mit engen Radien 842
8.2.2.2.8 Spezialanwendungen im Rohrvortrieb 846
8.2.3 Digitalisierung und Automatisierung 848
8.3 Pilotrohrvortrieb 849
8.3.1 Maschinentechnik 849
8.3.1.1 Maschinen 849
8.3.1.2 Bohrausrüstung 851
8.3.2 Verfahrenstechniken 851
8.3.2.1 Pilotrohrvortrieb mit bodenverdrängender Pilotbohrung 851
8.3.2.2 Pilotrohrvortrieb mit bodenentnehmender Pilotbohrung 853
8.3.3 Vermessungssystem und Messdatenerfassung 853
8.3.4 Anwendungsbereiche im Pilotrohrvortrieb 854
8.4 Gesteuerte Horizontalspülbohrtechnik (Horizontal Directional Drilling, HDD) 854
8.4.1 Verfahrensbeschreibung 855
8.4.2 HDD-Rigtypen 856
8.4.2.1 Einordnung nach Zugkraft 856
8.4.2.2 Einordnung nach Bauart 856
8.4.2.2.1 Trailer-Rigs 856
8.4.2.2.2 Crawler-Rigs (Kettenfahrwerk) 857
8.4.2.2.3 Frame-Rig 857
8.4.2.3 Einteilung nach Antriebsart 858
8.4.2.3.1 Dieselhydraulischer Antrieb 858
8.4.2.3.2 Elektrohydraulischer Antrieb 859
8.4.2.3.3 Vollelektrischer Antrieb 859
8.4.3 HDD-Bohrwerkzeuge 860
8.4.3.1 Bohrwerkzeuge für Pilotbohrung 860
8.4.3.2 Aufweitwerkzeuge 860
8.4.3.2.1 Barrel Reamer 861
8.4.3.2.2 Fly Cutter 861
8.4.3.2.3 Hole Opener 861
8.4.3.2.4 Full Face Hole Opener 861
8.4.4 HDD-Zusatzequipment 862
8.4.4.1 Weeper Subs 862
8.4.4.2 Strahlförderpumpe 862
8.4.5 Ortungs- und Steuerungstechnik 863
8.4.5.1 Ortungstechnik 863
8.4.5.1.1 Walk-Over-Verfahren 864
8.4.5.1.2 Wire-Line-Verfahren 864
8.4.5.1.3 Kreiselkompass 864
8.4.5.2 Steuerungstechnik 865
8.4.6 Bohrspülung 865
8.4.7 Einsatzgrenzen im HDD 865
8.4.7.1 Baugrund 865
8.4.7.2 Bau eines Schutzrohrs 866
8.4.8 Spezialanwendungen im HDD 866
8.4.8.1 Uferanlandungen mit HDD 867
8.4.8.1.1 Szenarien für Anlandungen mit HDD 868
8.4.8.2 Aufwärtsbohren 868
8.4.8.3 Intersectbohrungen 869
8.5 Direct Pipe® 869
8.5.1 Einsatzbereich im Pipelinebau 869
8.5.2 Verfahrensbeschreibung 870
8.5.3 Pipe Thruster 871
8.5.4 Sea Outfall mit Direct Pipe 872
8.5.4.1 Bergung der Vortriebsmaschine 872
8.6 E-Power Pipe® 873
8.6.1 Einsatzbereich 873
8.6.2 Verfahrensbeschreibung 874
8.6.3 Kernkomponenten 874
8.6.3.1 Maschinentechnik AVNS 874
8.6.3.2 Stahlvortriebsrohr 875
8.6.3.3 Pressenrahmen 875
8.6.4 Aufweitstufe für größere Rohrdurchmesser 876
8.7 Navigationssysteme für Microtunnelling-Verfahren 877
8.7.1 Übersicht und Funktionsweise der gängigen Navigationstechnologien 877
8.7.1.1 Laser-Zieltafelsystem 877
8.7.1.2 Laser-Zieltafelsystem mit elektronischer Schlauchwasserwaage 878
8.7.1.3 Laser-Totalstation mit aktiver Zieltafel 879
8.7.1.4 Kreiselsystem mit elektronischer Schlauchwasserwaage 880
8.7.2 Einsatzgebiete und Einsatzgrenzen 882
8.7.3 Notwendigkeit von Kontrollmessungen 883
8.7.4 Zusatzsysteme für besondere Herausforderungen 883
8.7.4.1 Multi Station System 884
8.7.4.2 Elektromagnetische Ortungssysteme 884
8.7.4.3 TUnIS.pipelight 885
8.7.4.4 Abgrenzung der Einsatzgebiete der Zusatzsysteme 886
8.8 Schlusswort 887
9 Grundwasserhaltung 888
9.1 Allgemeines 888
9.2 Einsatzgebiete 889
9.2.1 »undichte« Baugruben 889
9.2.2 »teilgedichtete« Baugruben 889
9.2.3 Restwasserdichte Baugruben 890
9.2.4 Rohrgräben 890
9.3 Verfahren der Grundwasserhaltung 890
9.3.1 offene Wasserhaltung 890
9.3.2 geschlossene Wasserhaltung 891
9.3.2.1 Schwerkraftbrunnen 892
9.3.2.2 Vakuumbrunnen 893
9.3.2.2.1 Brunnenanordnung und Ausbau 894
9.3.2.3 Kleinfilteranlagen 895
9.3.2.4 Horizontaldränagen 896
9.3.3 Re-Infiltration 901
9.3.3.1 Düsensauginfiltrationsverfahren (DSI®) 902
9.4 Rohrleitungen 903
9.5 Pumpen 904
9.6 Betrieb und Betriebssicherheit von Wasserhaltungsanlagen 907
9.7 Literatur 907
10 Belastungs- und Qualitätsprüfung Probebelastung und Qualitätskontrolle von Tiefbaukonstruktionen 908
10.1 Allgemeines 908
10.2 Probebelastung von Pfählen 909
10.2.1 Allgemeines 909
10.2.2 Statische Probebelastung von Druckpfählen 911
10.2.3 Probebelastung von Zugpfählen 918
10.2.4 Pseudo-statische Probebelastung 921
10.2.4.1 Statnamic 921
10.2.5 Probebelastung mit dem Osterberg-Verfahren 923
10.3 Integritätsprüfung 927
10.3.1 Low Strain Integrity Testing 927
10.3.2 Cross-hole Sonic Logging 932
10.3.3 Infrarote thermische Integritätsuntersuchung 935
11 Arbeiten in kontaminierten Bereichen 938
11.1 Allgemeines 938
11.2 Spezialtiefbauarbeiten in kontaminierten Bereichen 939
11.2.1 Allgemeines 939
11.2.2 Erkundungsarbeiten 939
11.2.3 Sicherung von Kontaminationen und Deponiebau 942
11.2.4 Sanierung von Altlasten 943
11.2.5 Gründungsarbeiten in kontaminierten Bereichen 945
11.2.5.1 Allgemeines 945
11.2.5.2 Verfahren Centrum-Injektionspfahl 945
11.2.5.3 Verfahren Simplex-Ortbeton-Rammpfahl 947
11.2.5.4 Verfahren Frankipfahl 948
11.2.6 Verdichtungsarbeiten 949
11.2.6.1 Allgemeines 949
11.2.6.2 Fallplattenverdichtung 949
11.2.6.3 Tiefenverdichtung System Brückner 950
11.2.6.4 Seitenverdrängungsverfahren System Leffer 951
11.2.7 Entwässerungs- und Entgasungsarbeiten 952
11.2.7.1 Allgemeines 952
11.2.7.2 Beschreibung des Verfahrens 952
11.2.7.3 Ausführungsbeispiel 954
11.3 Sicherheitstechnik bei Arbeiten in kontaminierten Bereichen 955
11.3.1 Allgemeines 955
11.3.2 Schutzmaßnahmen 955
11.3.2.1 Allgemeines 955
11.3.2.2 Technische Schutzmaßnahmen 956
11.3.2.3 Organisatorische Schutzmaßnahmen 956
11.3.2.4 Persönliche Schutzausrüstung 956
11.3.2.5 Beispiel für eine praktische Maßnahme 957
12 Vertrags- und Rechtsfragen im Spezialtiefbau 958
12.1 Allgemeines 958
12.2 Der Baugrund als terra incognita für Juristen und Ingenieure 959
12.2.1 Begrifflichkeit Baugrund – Gebirge – Deponiegut 959
12.2.2 Rechtsprobleme im Zusammenhang mit dem Baugrund 960
12.2.2.1 Baugrund als „Vorgabe“ des Auftraggebers und „Baustoff“ 960
12.2.2.2 „Baugrund“ ist „(Bau-) Stoff“ im Sinne der §§?644 und 645 BGB sowie der VOB/B und VOB/C! 961
12.2.2.3 Rechtsfolgen für die Baupraxis 962
12.2.3 Kernproblem: Risikoverwirklichung 962
12.2.3.1 Das Baugrundrisiko 962
12.2.3.2 Das Systemrisiko 963
12.3 Die Lösung von Spezialtiefbau-Streitfällen auf der Basis der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes und des Vergaberechts 964
12.3.1 Einführung 964
12.3.2 Der Baugrund als unverzichtbare Baukomponente 965
12.3.3 Ein typischer Baugrund-Fall 966
12.3.3.1 Geotechnische Grundlagen 966
12.3.3.2 Die Regelungskaskaden zur Lösung der Streitfragen 967
12.4 Exkurs: „Der Baugrund ist, wie er ist!“? 974
12.5 Zusammenfassung 978
12.6 Maßgebliche Literatur 979
13 Sicherheit und Gesundheit 980
13.1 Einleitung 980
13.2 Rechtsgrundlagen 980
13.3 Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes 981
13.4 Verantwortung der Unternehmer 981
13.5 Verantwortung der Führungskräfte 981
13.6 Verantwortung der Beschäftigten 982
13.7 Sicherheitsbeauftragte 982
13.8 Betriebsrat 982
13.9 Fachkraft für Arbeitssicherheit (SiFa) 983
13.10 Betriebsarzt 983
13.11 Arbeitsschutzausschuss 983
13.12 Erste Hilfe 984
13.13 Gefährdungsbeurteilung 984
13.14 Rangfolge der Schutzmaßnahmen 987
13.15 Persönliche Schutzausrüstungen 987
13.16 Maßnahmen vor Arbeitsbeginn 988
13.17 Arbeitsplätze und Verkehrswege 989
13.18 Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen – Koordinierung 989
13.19 Absturzsicherungen 989
13.20 Arbeiten am, auf und über Wasser 990
13.21 Baugruben und Gräben 991
13.22 Baugrubenverbau – Trägerbohlwände und Spundwände 992
13.23 Verbaute Gräben 993
13.24 Aushub neben bestehenden Bauwerken – Unterfangen 993
13.25 Einsatz von Maschinen 994
13.26 Arbeiten im Spezialtiefbau 995
13.26.1 Bohrarbeiten 995
13.26.2 Schlitzwandarbeiten 995
13.26.3 Injektionsarbeiten 996
13.26.4 Hochdruckinjektionsarbeiten 996
13.26.5 Ankerarbeiten 997
13.26.6 Arbeiten in Bohrungen 998
13.27 Staatliche Aufsichtsbehörden 1000
13.28 Berufsgenossenschaften 1000
13.29 Gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) 1001
13.30 Ausblick 1002
13.31 Literaturauswahl und Internetadressen 1002
14 Beobachtungsmethode und Messtechnik 1006
14.1 Einleitung 1006
14.2 Ziele einer messtechnischen Überwachung 1006
14.3 Beobachtungsmethode 1008
14.4 Aufstellung eines Messprogramms 1009
14.5 Ausgewählte Messinstrumente und Messverfahren 1011
14.5.1 Geodätische Messungen 1011
14.5.2 Neigungsmessung mit dem Inklinometer 1012
14.5.3 Verschiebungsmessung mit dem Extensometer 1013
14.5.4 Gleitmikrometer 1014
14.5.5 Verschiebungsmessung mit dem induktiven Wegaufnehmer 1015
14.5.6 Dehnungsmessungen 1016
14.5.7 Kraftmessdosen und Druckgeber 1019
14.6 Auswertung, Darstellung und Bewertung von Messdaten 1022
14.7 Literatur 1023
Stichwortverzeichnis 1026
| Erscheint lt. Verlag | 6.1.2025 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Technik ► Bauwesen |
| ISBN-10 | 3-8462-1276-8 / 3846212768 |
| ISBN-13 | 978-3-8462-1276-9 / 9783846212769 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 52,8 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich