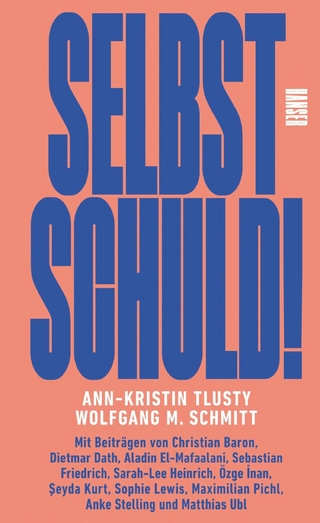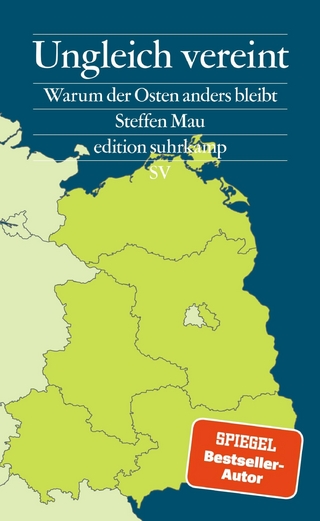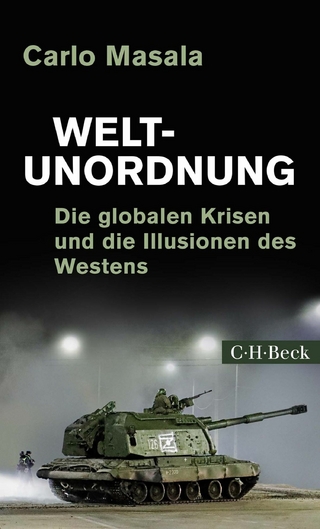Trost (eBook)
208 Seiten
Kein & Aber (Verlag)
978-3-0369-9527-4 (ISBN)
Madeleine Hofmann, geboren 1987, studierte Politikwissenschaften und Soziologie. Sie lebt als Autorin und freie Journalistin in Berlin. Ihre Texte und Beiträge werden u.a. bei Deutschlandfunk Kultur und im ZDF veröffentlicht. 2018 erschien ihr erstes Sachbuch Macht Platz! Als Expertin und Rednerin für die Themen 'Jugend und politisches Engagement' ist sie in den Medien und bei Veranstaltungen präsent. Für ihre Recherchen wurde sie mehrfach mit Preisen und Stipendien ausgezeichnet.
LEIDEN
Das Krankenhaus ist ein hässlicher grauer Betonklotz in bester Berliner Kiez-Lage. Zum ersten Mal waren dieser Klotz und ich uns begegnet, gleich nachdem ich in die Stadt gezogen war und meine neue Nachbarschaft erkundet hatte. Meinen ersten Geburtstag als Neu-Berlinerin feierte ich mit Freund:innen, Kaltgetränken, Straßenmusik und Schwänen auf einer Wiese unweit des Krankenhauses, wo nicht nur die Sonne am längsten hin scheint, sondern sich auch die Besuchstoiletten der Klinik in Laufweite befinden. Das, so mein damaliger Gedanke, sollte hoffentlich die einzige Gelegenheit bleiben, bei der ich dieses Krankenhaus betreten würde. Schon im Eingangsbereich tummelte sich dort die Crème de la Crème der Kiez-Freak-Parade, umhüllt von Zigarettenduft, Anti-Tauben-Musik und neonfarbenen Plüschteddys in Geschenkfolie. Das reinste Gruselkabinett. Wer hier landet, dachte ich, ist wirklich arm dran.
Gut sieben Jahre später saß ich in diesem Gebäude auf einem Holzstuhl mit roten Lederpolstern, blickte auf eine gigantische, in warmen Farben auf eine Leinwand gedruckte Blüte, aufgehängt an der rot tapezierten Wand. Neben mir stand eine Vase mit echten Blumen, daneben eine Wasserkaraffe, Trinkgläser. Hier im Brustzentrum war man bemüht, eine »freundliche« Atmosphäre zu schaffen. Unverschämt kam mir das jetzt vor, angesichts des ganz und gar unfreundlichen Tumors, den die Ärztin in meiner Brust gefunden hatte. »Es tut mir leid«, sagte sie, »aber Sie sind das eine Prozent.«
Meistens ist es erstrebenswert, zum »einen Prozent« zu gehören: die Reichsten, die Ältesten oder Jüngsten, die Schnellsten, die mit der besten Stimme, die mit Doktortitel. Die Gruppe aber, zu der ich jetzt zählte, war die der Menschen, die weder durch hohes Alter noch durch eine familiäre Vorbelastung zur Risikogruppe für eine Brustkrebserkrankung gehörten – und die es trotzdem erwischt. Der ultimative doppelte Pech-Jackpot. Für den Moment also fühlte sich dieser Ort, das Brustzentrum in der klotzigen Klinik, und seine Eigenschaft, die Besucher:innen komplett von der Leichtigkeit, der Freiheit des lebendigen Draußen abzuschirmen, genauso an, wie ich ihn damals an meiner Geburtstagsfeier eingeschätzt hatte: Grau (trotz des vielen Rot), trist, trostlos, ehrlich gesagt, einfach zum Kotzen. Ich war nun Teil dieser Freak-Parade, vor der ich mich damals gegruselt hatte, und ja, im Vergleich zu meinem früheren Leben war ich arm dran.
Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehen konnte: Mit meiner Einschätzung der Trostlosigkeit dieses Ortes lag ich völlig falsch. Klar, Leid gab es hier zuhauf; wo man hinblickte, schrie sie einen an, die Misere. Doch genau deshalb war hier so viel Raum für Hoffnung, so viel Raum für Trost. Vermutlich war das Krankenhaus der zugleich traurigste und hoffnungsvollste Ort, den ich kannte. Die meisten erhielten hier nach einer schlimmen Diagnose einen Ausblick auf Heilung oder zumindest auf Besserung. Die meisten gingen hier lebend wieder raus, oft sogar in besserem oder gesünderem Zustand als zuvor, die meisten konnten ihre Liebsten wieder in die Arme schließen. Einige wurden hier sogar geboren. Trost war hier überall, er war nur nicht so leicht zu erkennen, musste er doch erst einmal ankommen gegen all dieses Leid. Ob das vorüberging, hing von den medizinischen Fakten ab, lag mitunter in den Händen der Expert:innen und Übermittler:innen dieser Fakten; es lag an den Menschen, die hier arbeiteten, die allzu oft über »Trost« oder »trostlos« entschieden. Und so geschah es auch mir, dass ich in meiner tieftraurigen Schock-Trance wie in einer anderen Galaxie Ärzt:innen sagen hörte: »Das ist eine der besten Tumorarten, die man haben kann«, »Dass er so aggressiv ist, heißt, er ist gut behandelbar«, »Die Forschung hierzu ist sehr fortgeschritten«. Ich hörte aber auch Sprüche wie: »Da kommt was auf Sie zu«, oder: »Das ist wirklich Pech.« Empathie ist, das hat vermutlich jeder Mensch schon einmal erfahren, leider nichts, das berufsbegleitend kommt.
»Eine der besten Krebsarten, die man haben kann«, fühlte sich für mich anfangs an wie blanker Hohn. Am besten ist schließlich immer noch der Krebs, den man gar nicht erst bekommt. Und wenn »meine Krebsart« geradezu großartig war, warum reichte dann nicht eine kleine, brusterhaltende OP, warum musste ich trotzdem eine Chemotherapie machen? Es war doch Allgemeinwissen aus Filmen und Romanen, dass es einem dabei nicht gutgehen kann, dass man erst seine Haare, dann sein Gewicht, dann die Lebendigkeit in den Gliedern verliert. Würde sich das alles überhaupt lohnen? Ich war wütend. Ich war geschockt. Ich war traurig. Ich wollte mein altes Leben zurück.
Stattdessen stand mir die unsägliche Aufgabe bevor, meine Mitmenschen über meinen Zustand aufzuklären. Dafür wurde »eine der besten Krebsarten, die man haben kann« zum Strohhalm, an den ich mich klammerte. Und mit dem ich paradoxerweise alle anderen tröstete. Denn während ich das alles nicht glauben konnte und mein größter Horror die Vorstellung einer Chemotherapie war, wollten die mir nahestehenden Menschen schlicht hören, dass ich überlebe. Wahrscheinlich werde ich niemals die Orte vergessen, an denen ich stand, die Hauswände, auf die ich blickte, während ich das Unaussprechliche ins Smartphone sagte: »Ich habe Brustkrebs« – und dann ganz schnell: »Aber es ist einer, der gut heilbar ist, es wird nur ein harter Sommer, der Tumor ist super gut erforscht.« Mein Erklärungseifer konnte die Traurigkeit und die Angst am anderen Ende der Leitung nie übertönen. Das schmerzliche Gefühl, meiner Familie und meinen Freund:innen einen Kummer zu bereiten, den ich selbst nicht fassen konnte, übermannte mich. Mir war schlecht, ich war müde, wollte einfach nur schlafen, so lange, bis all das nicht mehr wahr war.
Ich war aber auch trotzig. Dass ich meinen Friseurtermin zwei Tage nach der Diagnose nicht absagen, meine Konzerttickets für denselben Abend nicht verkaufen wollte, stieß bei meiner Schwester und meinem Mann, mit denen ich gerade die deprimierteste WG der Welt bildete, auf Unverständnis. Aber sollte ich schon jetzt, wo ich gar nichts tun konnte, dieses neue Schicksal alles bestimmen lassen? »Da kommt was auf Sie zu«, hatte die Ärztin bei der Mammographie gesagt. Was das war, war zu abstrakt, zu groß, als dass ich es zu diesem Zeitpunkt hätte einschätzen können. Woher konnte ich wissen, ob ich in wenigen Wochen und Monaten noch in der Lage sein würde, auf Konzerte zu gehen, ob ich noch Haare hatte, die ich frisieren lassen konnte? Deshalb lagen sich an Tag 3 »ac« (after cancer), meiner neuen Zeitrechnung meine Friseurin und ich weinend in den Armen, bevor wir mein langes, dickes, glänzendes Haar in extra schöne Locken legten, die ich zum Konzert von Florence + the Machine trug. Die Aura von Florence Welch haute mich um, ihre Energie, die Songtexte trafen mich wie Blitze, genau wie die Erkenntnis, dass ich seit Jahren wieder anfangen wollte zu tanzen, es nie getan hatte. War diese Krankheit die Strafe dafür, dass ich all meine Träume hatte Träume bleiben lassen? Ich wollte in den Arm genommen und festgehalten werden. Am liebsten von der energiegeladenen Sängerin, so wie die Glücklichen in der ersten Reihe. An ihrer Stelle hätte ich vermutlich nie wieder losgelassen. Aber ich saß weit weg, auf der Tribüne, in Reichweite nur meine Begleitung, die emotional mit mir und meiner Diagnose überfordert war.
Alles erschien surreal. Ich ging mit den Mitgliedern meiner Depri-WG shoppen, weil sie es unbedingt wollten. Schon »bc« (before cancer) ging ich ungern einkaufen, brachte es aber nicht übers Herz, dem Vorschlag zu widersprechen. Ich hatte das Gefühl, es war ihnen wichtig, dass ich irgendein Kleidungsstück kaufte, und ich tat ihnen den Gefallen, schließlich war meine Misere der Grund für ihre Misere. Am Wochenende saß ich an zwei Geburtstagstafeln, an denen ich die Traurigkeit meiner Liebsten lauter hörte als das Stimmengewirr einer ganzen Festtagsgesellschaft. Ich passte Momente ab, in denen ich weiteren engen Familienmitgliedern die Neuigkeiten überbrachte. Ich fühlte mich ausgeschlossen, wenn ich merkte, wie sie in anderen Zimmern zusammenstanden und über »meine Situation« flüsterten. Ich baute eine Höhle mit meiner Nichte, legte mich hinein und schlief.
In der zweiten Woche versuchte ich, den neuen Mittelpunkt meines Lebens zu ignorieren. Während mein Mann Arzttermine für mich vereinbarte, waren meine Tage gefüllt mit Lesungen und Interviews zu meinem aktuellen Buch. Ich wollte keinen Platz machen für etwas, das ich nicht in mein Leben gebeten hatte. Wenn ich auf der Bühne saß, konnte ich die Diagnose vergessen, bis ich abends ins Bett stieg und im Sitzen einschlief, weil ich Angst hatte, beim Liegen den Tumor in meiner Brust zu spüren. Jeden Tag schlug ich die Augen auf mit der Hoffnung, alles sei nur ein unfassbar schrecklicher Traum gewesen. Jeden Tag wurde ich enttäuscht.
Es waren jetzt nur noch mein Mann, ich und eine schier endlose Liste an Arztterminen. Zum ersten Mal traf ich Freund:innen, die noch nichts von meiner Diagnose wussten, und denen es zu erzählen ich nicht die Kraft besaß. Dabei war es rückwirkend genauso anstrengend, nichts zu sagen, denn wie konnte ich erzählen, »was bei uns so los ist«, ohne den Tumor in meiner Brust zu erwähnen? Die Urlaubspläne von Freund:innen zu hören, machte mich traurig. Wann würde ich je wieder Urlaub machen können? Filmabende lenkten mich ab. Wir schauten Frida. Frida Kahlo, die ihr gesamtes Leben von körperlichen und seelischen Schmerzen geplagt war, die trotzdem immer vor Lebenslust strotzte, sie...
| Erscheint lt. Verlag | 14.3.2025 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Bedürftigkeit • Beziehungen • Enttäuschung • Gesellschaft • Heilung • Hoffnung • Krankheit • Krise • Persönlichkeitsentwicklung • Psychologie • Schmerz • Trauer • Trost • Verletzlichkeit • Verlust |
| ISBN-10 | 3-0369-9527-7 / 3036995277 |
| ISBN-13 | 978-3-0369-9527-4 / 9783036995274 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,3 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich