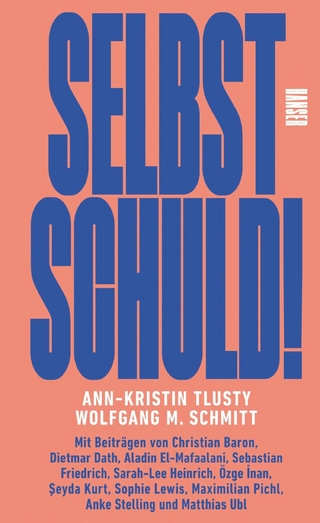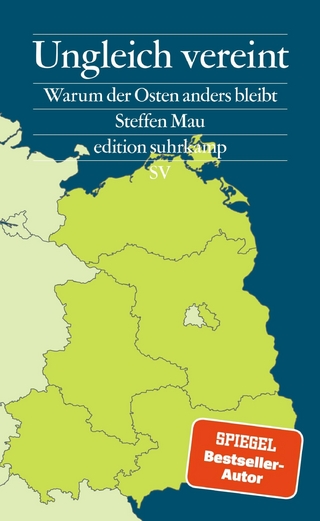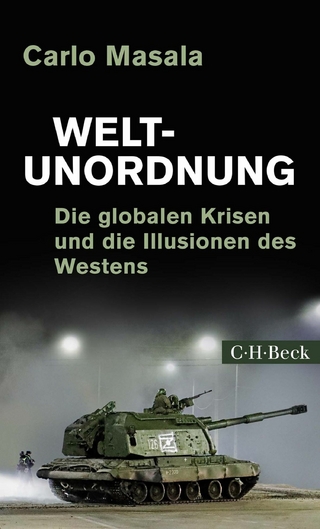Deutsch genug? (eBook)
256 Seiten
Goldmann (Verlag)
978-3-641-32377-6 (ISBN)
Sie wählen rechts, sprechen nur russisch und unterstützen Putin? Solchen und anderen Vorurteilen sehen sich russlanddeutsche (Spät-)Aussiedler*innen ausgesetzt. An aufrichtigem Interesse und Wissen um die bewegte Historie der rund 2,5 Millionen in Deutschland lebenden Russlanddeutschen mangelt es in unserer Gesellschaft.
Ira Peter, die mit ihrer Familie als Neunjährige von Kasachstan nach Deutschland umsiedelte, beschreibt anhand ihrer eigenen bewegten Biografie die Erfahrungen und Konflikte der Russlanddeutschen - von der Scham über die sowjetische Herkunft über die fatalen Folgen kurzsichtiger Integrationspolitik bis hin zur »Anfälligkeit« für russische Einflussnahme wirft sie einen kritischen und zugleich feinfühligen Blick auf die von der Mehrheitsgesellschaft oft als fremd empfundenen Deutschen. Sie erklärt, wie die doppelte Diktaturerfahrung unter Stalin und Hitler Russlanddeutsche bis heute prägt und manche anfällig für völkisches Denken macht. Gleichzeitig zeigt Ira Peter, wie heterogen die Gruppe ist und warum »Deutschsein« für sie heute kein Kriterium mehr ist, um deutsch zu sein.
Ein Buch, das nicht nur die Geschichte der Russlanddeutschen beleuchtet, sondern auch zum Nachdenken über Identität und Integration einlädt.
Ira Peter, 1983 in der Sowjetrepublik Kasachstan geboren und seit 1992 in Deutschland lebend, arbeitet als freie Journalistin unter anderem für Zeit online, taz, FAZ, Frankfurter Rundschau und SWR Radio. Seit 2017 setzt sie sich öffentlich - in journalistischen Beiträgen, sozialen Medien, kulturellen Projekten in Deutschland und der Ukraine, im Aussiedler-Podcast Steppenkinder und als Rednerin bei Veranstaltungen - mit russlanddeutschen Themen auseinander. Deutsch genug? ist ihr erstes Buch.
1
Wir müssen hier weg
Ich würde gern mit diesem Mädchen auf dem Bild sprechen, das ich in den Händen halte. Blond und braun gebrannt steht es hinter einem breiten Bett, auf dem ein aufgeschlagener Koffer liegt. Rechts an der Wand türmen sich Kartons und Wolldecken. Vor ihnen die Mutter des Mädchens. Müde sieht sie aus. Es ist Sommer 1992 und in wenigen Wochen wird die Familie Kasachstan für immer verlassen. Das neunjährige Mädchen bin ich.
»Wie stellst du dir Deutschland vor, kleine Irina?«, würde ich gern wissen und kurz in ihre Welt eintauchen. Durch das Haus gehen, von dem ich noch heute träume, dann aber meist voller Angst erwache. Denn vor der Ausreise waren wir in ständiger Alarmbereitschaft, jemand könnte uns in letzter Sekunde ausrauben oder ermorden – solche Gefühle vergisst man nicht. Und doch flackern auch sorgenfreie Bilder auf meinem Nostalgiebildschirm auf. Dann würde ich mich gern neben Vergangenheitsirina setzen, mit ihr die warme Milch trinken, die meine Mutter jeden Abend aus dem Stall brachte, und mit unserem Hund so lange vor dem Haus sitzen, bis die Sonne am endlosen Horizont ins Ocker der Steppe fällt.
Das Bild von mir ist eins von etwa hundert, die im Sommer 1992 vor unserer Ausreise entstanden sind. Mein Onkel Wowa4 lebte damals schon in Germania, wie wir Deutschland nannten, und hatte uns eine Kamera mit vier Farbfilmen nach Kasachstan geschickt. Papa war begeistert und hielt das Objektiv auf alles drauf. Auch auf den Koffer im Schlafzimmer meiner Eltern, den ich auf dem Bild betrachte. Aus ihm quillt in Folie verpackte Kleidung heraus. Wir hatten uns für Deutschland auf dem Markt in der Stadt neu eingekleidet. Diese Stadt hieß damals Akmola. Als ich dort 1983 geboren wurde, war ihr Name noch Zelinograd, Russisch für Stadt der Neulandgewinnung. Heute trägt sie einen neuen kasachischen Namen: Astana. Der ist etwas einfallslos, denn Astana heißt auf Kasachisch Hauptstadt – was sie seit 1997 ist. Die Namensänderung ins Kasachische drückt das Ende der Sowjetherrschaft mit ihrer Dominanz des Russischen aus. Sie zeigt aber auch, dass das Land sich in seiner politischen Identität noch sucht, denn zwischenzeitlich hieß Astana auch einige Jahre Nur-Sultan, nach dem ehemaligen Präsidenten Nursultan Nasarbajew.
1992 interessierten meine Familie weder die Suche nach Identitäten noch launische Namenswechsel. Wir wollten das Land einfach nur verlassen und dabei möglichst wenig nach Steppe aussehen. Auf dem Kleidermarkt in der Stadt verkauften vor allem Händler aus China alles, was nach Westen aussah und sich wie Osten trug: Jeans und weiße Turnschuhe zum Beispiel, die ich erst am lang herbeigesehnten Tag unserer Ausreise nach Deutschland anziehen durfte. Die Jeanshose, die keine war, riss noch im Durchgangslager Friedland zwei Wochen später, die Turnschuhe auch. Ersatz gab es zunächst beim Deutschen Roten Kreuz, denn ein Großteil unserer Sachen befand sich in einem Container, der uns nachgeschickt wurde. In ihn hatten meine Eltern vor der Abreise auch die Kissen gesteckt, die sich im Bild auf dem Bett stapeln. Zwei Fotoalben und eine kleine Schachtel mit Bildern haben es auf diese Weise ebenfalls nach Deutschland geschafft. Und das, obwohl meine Eltern große Angst hatten, sie in den Container zu legen, der größer klingt, als er mit seinen ein Meter zwanzig auf ein Meter zwanzig war. Unter den ausreisenden Deutschstämmigen war nämlich das Gerücht umgegangen, dass Bilder und Bibeln nicht ausgeführt werden dürften. Für alte Bibeln stimmte das wohl tatsächlich, weil sie als »Kulturgut« galten. Bei Bildern war das eher vom guten Willen der Grenzbeamtinnen und -beamten abhängig, zumindest wenn sie die Koffer bei der Ausreise kontrollierten. Ich kenne viele Familien, die ihre Fotoalben am Flughafen in eine Mülltonne werfen mussten – wenn der Wille kein guter war. Meine sonst obrigkeitshörigen Eltern haben sich in diesem Fall über Gesetze und Gerüchte hinweggesetzt. Dafür bin ich sehr dankbar. Die alten Bilder, die meine Großeltern in bitterer Armut zeigen, sind nämlich Erinnerungsstützen. Und immer dann hilfreich, wenn das kollektive Familiengedächtnis an die »glorreiche« Sowjetunion zu trügen droht.
Auf den Farbfotos, die erst in Deutschland entwickelt wurden, sehe ich Mama lächelnd in Gummistiefeln am Gartenzaun, meinen Vater vor einem Traktor und das ernste Gesicht einer meiner Tanten am Grabstein meiner Oma. Zu den häufigsten Motiven zählen Verwandte, die vor vollen Tellern und Gläsern sitzend in die Kamera grinsen. Besonders viele von ihnen zeigt ein Bild, das Papa in unserem Wohnzimmer gemacht hat, standardmäßig an einem mit Essen voll bepackten Tisch. An der Wand ein roter Teppich, das Must-have einer jeden sowjetischen Einrichtung – nicht nur optisch ein Hingucker, sondern durchaus mit Funktion als Kältedämmung, wenn das Thermometer in der Steppe ab Oktober weit unter null fiel. Auf dem Bild erkenne ich die halbe Nachbarschaft, die uns an diesem Abend feierte, weil wir weggingen. Die meisten waren Deutsche und würden bald nachkommen. Prowody hießen diese Abschiedsfeste, wörtlich abgeleitet von jemanden begleiten.
Seit Ende der Achtziger hing unser ganzes Dorf immer häufiger auf solchen Partys ab. Die Stimmung war top, die Heimat der deutschen Vorfahren zum Greifen nah. Alle waren umhüllt von einer flauschigen Deutschlandverliebtheit, ganz benebelt von den verführerisch duftenden Paketen der Verwandten aus Daitschland, unser zweites Wort für Germania. Schokolade und Vanillezucker aus dem Westen suggerierten unseren Eltern nach Jahrzehnten der sozialistischen Planwirtschaft, die planmäßig unwirtschaftlich verlief, paradiesische Zustände. Wie sehr gönne ich jedem das Lächeln auf diesem Bild. Die Realität in Deutschland würde es bald trüben.
Auf einem anderen Bild ist das Wohnzimmer leer geräumt. Papa und sein Bruder Roman stehen vor einer weißen Wand. Sie lächeln nicht. Papa ist Nostalgiker, bestimmt war er in diesem Moment wehmütig. »Wie hat sich das für dich angefühlt, das Haus so leer zu sehen?«, frage ich ihn, als ich beginne, mit meinen Eltern über damals zu sprechen. Jetzt haben wir ja einen Grund, uns die Vergangenheit genauer anzusehen: dieses Buch. »Man hat schon gedacht, du gehst raus und kommst nie zurück«, erinnert sich mein Vater und die Wehmut von damals klingt ein wenig durch. »Aber man versteht das erst so richtig, wenn die Tür wirklich für immer geschlossen ist.« Er sehe noch genau seinen Schwerlasterführerschein vor sich, wie er auf der Fensterbank des leeren Schlafzimmers lag. Den habe er in der Abreisehektik vergessen, in Deutschland wäre er ihm vielleicht nützlich gewesen. Ich zweifle dran, er wäre vermutlich nie, oder wie die Bildungsabschlüsse meiner Eltern erst nach Jahren, anerkannt worden. Aber an dieses demütigende Gefühl will ich Papa jetzt nicht erinnern und nicke nur.
Eigentlich hatte er gar nicht nach Deutschland gewollt. »Warum nicht?«, will ich wissen. »Ich hatte große Angst vor Heimweh, mich hat es immer schon nach Hause gezogen«, antwortet er. Als Papa mit 16 auf einem Internat war, war er jeden Samstag nach Hause gelaufen, auch bei den für Nordkasachstan typischen Schneestürmen, um wenigstens eine Nacht zu Hause zu verbringen. Was hätte er aber tun sollen, wenn ihn das Heimweh in Deutschland gepackt hätte? »Ein Zurück gab es ja nicht. Ich hatte doch Verantwortung für euch drei Kinder«, zuckt er mit den Schultern. Seine andere Sorge war: »Würde ich gut genug sein? Würde ich genauso gut wie ein echter Deutscher die Arbeit erledigen? Man wusste doch nichts über dieses Land«, sagt er und ich bin überrascht, dass seine Erwartungen an Deutschland ebenso wie die Selbstzweifel so groß gewesen sein müssen.
Mussten wir denn weg? »Ja«, sagt Papa, ohne zu überlegen. 1979 hatte es kurz Hoffnung gegeben auf eine Autonomie der deutschen Minderheit in der UdSSR. Halbherzig hatte die sowjetische Regierung vorgeschlagen, im Norden Kasachstans ein deutsches, sich selbst verwaltendes Gebiet zu gründen. Mein Onkel David Gabriel, ein Politiker, den ich öfter im Fernsehen als bei uns zu Hause gesehen habe, hatte dort Sekretär werden sollen. Dagegen und gegen Deutsche im Allgemeinen hatten aber sofort die Kasachinnen und Kasachen in Zelinograd protestiert. Mama vermutet, dass der Protest gar nicht aus der Bevölkerung heraus entstanden war. Sie hatte viele kasachische Freundinnen, fühlte sich von ihnen immer akzeptiert. Vielmehr hat sie die Politik im Verdacht, damals eine antideutsche Stimmung angeheizt zu haben. Denn auch über dreißig Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs wollte der Staat den »Faschisten«, wie die Sowjetdeutschen manchmal bezeichnet wurden, nichts gönnen. Wir galten damals noch immer als Hitlers »Fünfte Kolonne«. Auch spätere Bestrebungen der Deutschen nach mehr Selbstbestimmung scheiterten.
Dann kamen ab 1985 Gorbatschows Versuche, die wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich marode Sowjetunion aus ihrer langjährigen Krise zu führen. Er setzte auf Transparenz und Umbau, besser bekannt als Glasnost und Perestroika. Für Deutsche bedeutete die politische Öffnung des Landes zwar wieder kein autonomes Gebiet, aber die lang ersehnte Chance, die Sowjetunion endlich Richtung Bundesrepublik verlassen zu können. Das war theoretisch zwar schon vorher möglich gewesen, jedoch nur unter sehr großen Anstrengungen und ausschließlich im Rahmen von Zusammenführungen zwischen Eltern und Kindern. Schnell zeigten sich die neuen Möglichkeiten auch in der Statistik. Sprunghaft stieg die...
| Erscheint lt. Verlag | 19.3.2025 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | AfD • Armut • assimilation • Aussiedler • BdV • Bund der Vertriebenen • Bundestagswahl • Der weiße Fleck • eBooks • EU • Eure Heimat ist unser Albtraum • Europa • Integration • Kasachstan • Migration • Ostblock • Podcast • Polen • pro-russisch • Putin • Rassismus • Rumänien • Russland • Sowjetunion • Spätaussiedler • Stalin • Steppenkinder • Ukraine • Umsiedler • Zuwanderer |
| ISBN-10 | 3-641-32377-0 / 3641323770 |
| ISBN-13 | 978-3-641-32377-6 / 9783641323776 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich