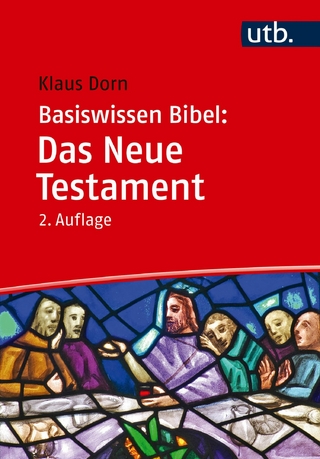Vom Glauben abgefallen (eBook)
163 Seiten
Kösel-Verlag
978-3-641-32227-4 (ISBN)
»Hannah Bethkes kluges Plädoyer geht nicht nur Protestanten etwas an: Unsere Demokratie braucht eine Kirche, die sich selbst ernst nimmt.« Robin Alexander
»Predigten, die mit Jesus am Frühstückstisch enden oder beginnen, weil man sich bürger- und lebensnah geben will, haben mit ernsthafter Religiosität nichts zu tun. Sie sind eine Verballhornung jener so notwendigen Transzendenz, an der es der entkirchlichten Gesellschaft mangelt.«
Die evangelische Kirche in Deutschland befindet sich in einer tiefen Krise - und kaum jemanden scheint es zu kümmern. Dabei ist der Zustand der Kirche ein Spiegel der Gesellschaft. Anstatt zu zeigen, was der christliche Glaube in einer stark säkularisierten Gesellschaft heute noch bedeuten kann, politisiert die Kirche sich und läuft einem Zeitgeist hinterher, der Andersdenkende ausschließt. Gleichzeitig trägt sie durch eine Banalisierung ihrer Theologie selbst dazu bei, als Institution nicht mehr ernst genommen zu werden. Das ist umso dramatischer, als der eklatante Bedeutungsverlust der Kirche in eine Zeit tiefer Umbrüche fällt. Gerade jetzt müsste die Kirche beweisen, wie sie den Menschen Halt und Orientierung geben kann und wo sie als ethisches Korrektiv der Gesellschaft unentbehrlich ist. Dieses Buch ist ein Plädoyer für eine mutige evangelische Kirche, die ihren Glauben lebt - und für modernen Konservatismus in einer offenen Gesellschaft.
Hannah Bethke, 1980 in Hamburg geboren, ist Journalistin und Politikwissenschaftlerin. Sie hat für zahlreiche überregionale Zeitungen gearbeitet, darunter für die FAZ, die NZZ und Zeit Online. Derzeit ist sie Politik-Redakteurin in der Welt und Welt am Sonntag. Sie hat über 'Das politische Denken Arnold Brechts' promoviert und war in Leipzig und Greifswald als Dozentin für Politische Theorie tätig. Hannah Bethke ist gefragter Gesprächsgast im Fernsehen und Hörfunk. Sie ist gläubige Protestantin.
Die Lage – Mitgliederschwund, Bedeutungsverlust, Entkirchlichung
Die Kirche hat sich von der Gesellschaft entfremdet. Mitten in der tiefsten Glaubenskrise wirken die Worte aus dem ersten Brief des Johannes wie aus der Zeit gefallen, und doch erinnern sie daran, was Kirche als Institution und Ort der Gemeinschaft vermitteln könnte: »Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.« Darüber ist viel geschrieben und gepredigt worden, deswegen sei hier nur angedeutet, welchen Stellenwert diese Aussage gerade in einer stark säkularisierten Welt haben kann. Da geht es um die Kraft des Glaubens, mit der man etwas hinter sich lässt und abgibt. »Wer also glaubt, kann nicht verzweifeln«, schreibt Martin Luther in seiner Vorlesung über den ersten Johannesbrief. »Unter ›Welt‹ versteh alles: Sünde, Teufel und Tod. Der Sieg über die ›Welt‹ ist aber unser Glaube.« Die Christen sollten die Welt »nicht durch ihre eigenen Anstrengungen überwinden, und keiner soll sich selbst einen Glauben vormachen«.3
Man kann also sagen: Der Glaube macht den Unterschied. Ähnlich beschreibt es Karl Barth in einer Predigt von 1947: »Und so werden wir gut tun, die Gefühle unseres Herzens – und wenn sie noch so tief wären – und die Überzeugungen unseres Kopfes – und wenn sie noch so wohl überlegt wären – nicht mit unserem Glauben zu verwechseln.« Wenn es in dem hier verstandenen Sinne um die Überwindung der Welt geht, ist damit nicht ein Kampf gemeint, sondern es zeigt sich darin vielmehr ein Weg zur Kirche, eine Vermittlung zum Glauben. Barth betont: »Jesus hat über die Welt gesiegt, nicht gegen sie, sondern für sie.«4
Das Zitat aus dem ersten Johannesbrief ist heute dagegen eher als Kontrast zwischen dem Glauben und der Welt zu verstehen, den die Kirche nicht mehr zu überwinden vermag. Wo sie gegen ihre eigene Bedeutungslosigkeit kämpft, kann sie in einer ungläubig gewordenen Welt kaum als Vermittlerin des Glaubens fungieren. Ein Blick auf die aktuellen Zahlen verwirkt tatsächlich jeden Optimismus, die Kirche könnte durch die Kraft des Glaubens überhaupt noch irgendeinen Sieg erringen.
Kirchenaustritte und finanzielle Situation
Die evangelische Kirche in Deutschland hatte im Berechnungsjahr 2023 rund 18,6 Millionen Mitglieder, die katholische Kirche 20,3 Millionen. Somit sind etwa 21,9 Prozent der Bevölkerung evangelisch, 24 Prozent katholisch. 43 Prozent der deutschen Bevölkerung sind konfessionslos, neun Prozent gehören anderen Religionsgemeinschaften an. Im Jahr 2023 hat die Zahl an Kirchenaustritten bei den Protestanten einen neuen Rekordwert erreicht, und es wird wohl nicht der letzte gewesen sein. Die evangelische Kirche hat über eine halbe Million Mitglieder verloren, aus der katholischen Kirche sind mehr als 400000 Menschen ausgetreten. Nach Angaben der EKD übertraf die Zahl der Kirchenaustritte im Jahr 2022 erstmals die Zahl der Sterbefälle. Der Trend setzt sich verschärft fort. Der Rückgang hat also nicht nur etwas mit der demografischen Entwicklung zu tun. Die EKD schätzt, dass der Anteil an Konfessionslosen im Jahr 2027 50 Prozent überschreiten und dann die absolute Bevölkerungsmehrheit ausmachen wird.
Zu den Spitzenreitern der Kirchenaustritte gehört in der evangelischen Kirche Berlin, deren Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz in den Jahren 2022 und 2023 je knapp 30000 Mitglieder verloren hat. Den Berliner Tagesspiegel verleitet das zu der Erwägung, ob es sich überhaupt noch lohnt, Kirchenmitglied zu sein. In Zeiten knapper Kassen könne ein kritischer Blick auf laufende Abonnements helfen – und dazu zählt der Tagesspiegel auch die Kirche: »Ein Abo, das viele schon im sehr jungen Alter und oft unfreiwillig abschließen, ist die Mitgliedschaft in einer Kirche.«5 Der spielerische Ton des hier zitierten Newsletters ist natürlich Absicht, und doch drückt sich darin die verheerende Lage der Kirche aus. Sie gilt vielen nur noch als »Abo«, ein Abonnement aus Gewohnheit.
Dadurch verschlechtert sich auch die finanzielle Situation der Kirche. Laut aktuellen Kirchenstatistiken und Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft sind die Kirchensteuereinnahmen 2023 im Vergleich zum Vorjahr zwar nominal leicht gestiegen, doch aufgrund der Inflation bleibt von den Mehreinnahmen nichts übrig. So ist das Aufkommen der Kirchensteuer kaufkraftbereinigt um mehr als fünf Prozent gefallen. Die evangelische und die katholische Kirche haben netto insgesamt knapp 12,5 Milliarden Euro eingenommen. Davon entfallen rund 6,5 Milliarden Euro auf die katholische und knapp sechs Milliarden Euro auf die evangelische Kirche. Da mit den anhaltenden Kirchenaustritten die Steuereinnahmen sinken, ist keine Besserung in Sicht.
Erschwert wird die Lage durch die Demografie. Sie habe Auswirkungen auf die Einnahmen der Kirche, erläutert das Wirtschaftsinstitut, weil immer mehr Kirchenmitglieder in Rente gingen und dadurch weniger Steuern zahlten. Die Finanzexperten rechnen nicht mehr mit »rosigen Zeiten« für die Kirchenfinanzen. Der »wirkliche Einbruch bei den Einnahmen« stehe erst noch bevor.6
Trotz ihrer desaströsen Lage ebbt die grundsätzliche Kritik am System der Kirchensteuer in Deutschland nicht ab. Bemängelt wird zumeist die fehlende Trennung zwischen Staat und Kirche, die nicht mehr zeitgemäß sei.7 Richtig ist, dass der Staat die Steuern der Kirche zwar weiter verwaltet, die Einnahmen aber nur an sie gehen. Anders als bei sonstigen Steuern steht es jedem frei, Mitglied der Kirche zu sein und sich dadurch steuerlich zu verpflichten. Von einer Vorrangstellung des Staates kann hier also nicht die Rede sein.
Die Kirchensteuer ist im Grundgesetz geregelt. So gelten im Artikel 140 weiterhin die Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung: »Die Religionsgesellschaften, welche Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, sind berechtigt, […] Steuern zu erheben.« Die Kirchensteuer beträgt neun Prozent der Lohn- und Einkommenssteuer, in Bayern und Baden-Württemberg sind es acht Prozent. Die EKD betont, die Kirchensteuer sei »die wichtigste Ertragsquelle und das Fundament aller kirchlichen Arbeit«.8 Würde man der Kirche diese Mittel entziehen, hätte sie wahrscheinlich keine Zukunft mehr. Die Forderung, gesonderte Kirchensteuerämter zu errichten und die Verwaltung der Steuer nicht mehr an staatliche Behörden zu delegieren, würde ebenfalls unnötigen Aufwand verursachen. In ihrer größten Krise sollte man der Kirche daher nicht noch das finanzielle Fundament nehmen.
Aktuellen Erhebungen zufolge würde dennoch eine Mehrheit der Befragten vom Kirchenaustritt absehen, wenn die Kirchensteuer abgeschafft wird. Fraglich ist allerdings, wie realistisch diese Selbsteinschätzung ist. Denn die Mitglieder treten nicht bloß aus ökonomischen Gründen aus der Kirche aus. Dass die Kirchensteuer überhaupt so negativ ins Gewicht fällt, ist vielmehr bereits eine Folge des eklatanten Bedeutungsverlusts der Kirche. Wenn man mit ihr ohnehin nichts mehr anfangen kann oder sie sogar ablehnt, sinkt erwartungsgemäß die Bereitschaft, für eine solche Institution auch noch Steuern zu entrichten. Fiele die Steuer nicht an, würde es die Kirche in ihrem beschädigten Ansehen mutmaßlich nicht retten, ganz abgesehen davon, dass sie ohne diese Finanzierung ökonomisch nicht überleben könnte. Der Schrumpfungsprozess der Kirche aber scheint unausweichlich zu sein.
Was die Mitglieder denken – und wie die Kirche darauf reagiert
Unter schlechteren Vorzeichen hätte die sechste Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (KMU) der EKD, die 2023 veröffentlicht wurde, also kaum stehen können.9 Alle zehn Jahre führt die evangelische Kirche die Erhebung durch, im Jahr 2023 erstmals unter Beteiligung der Deutschen Bischofskonferenz, die Vergleiche mit Mitgliedern der katholischen Kirche ermöglicht.10 Die wichtigsten Erkenntnisse der KMU lassen sich so zusammenfassen:
- Die empirischen Daten widerlegen die Annahme, man brauche keine Kirche für den Glauben. Zwar gebe es Formen individualisierter Religiosität, weitaus wahrscheinlicher sei jedoch, dass diese an Kirchlichkeit gebunden ist. Die Kirche bleibt für die Überlebensfähigkeit des Glaubens somit essenziell.
- Religiosität ist kein Naturgesetz. Über alle Krisen hinweg wurde das religiöse Bedürfnis des Menschen oftmals als anthropologische Grundkonstante beschrieben. Der Wunsch nach Transzendenz schien sogar im säkularen Zeitalter nie ganz auszusterben. Von dieser Vorstellung weicht die KMU nun interessanterweise ab: Man müsse davon ausgehen, dass Religiosität auch zurückgehen kann. Es gebe kein »anthropologisches Auffangnetz für kirchliches Handeln«: »Wenn Religion aus dem Leben von Einzelnen verschwinden kann, dann kann sie sogar aus Gesellschaften verschwinden.«
- Die Gesellschaft befindet sich in einer tiefen Glaubenskrise. Für eine Trendwende sieht die Studie keine Anhaltspunkte. Die Bilanz fällt ernüchternd aus: »Zu konstatieren ist eine Krise des religiösen Glaubens, der religiösen Praxis, des religiösen Erfahrens und der religiösen Kommunikation, sicherlich mit wechselseitigen Verstärkungseffekten.«
- Nach Einschätzung der Autoren mangelt es der Kirche an...
| Erscheint lt. Verlag | 26.2.2025 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Religion / Theologie ► Christentum |
| Schlagworte | anna-nicole heinrich • annette kurschus • Demokratie und Kirche • eBooks • EKD • Evangelische Kirche in Deutschland • Evangelische Kirche und Politik • Evangelischer Kirchentag • Gott • Hartmut Rosa • Institutionen • Jesus • kirche austreten • kirche langweilig • Neuerscheinung 2025 • Säkularisierung • warum soll ich nicht austreten • was hat die kirche mit mir zu tun • Wozu Glauben • wozu kirche |
| ISBN-10 | 3-641-32227-8 / 3641322278 |
| ISBN-13 | 978-3-641-32227-4 / 9783641322274 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich