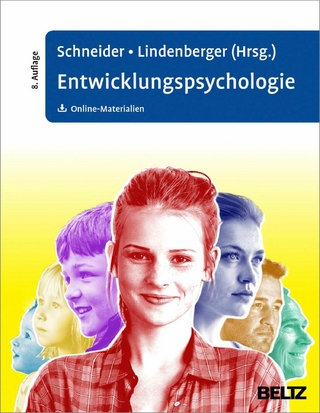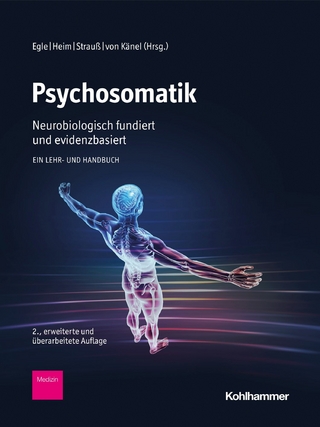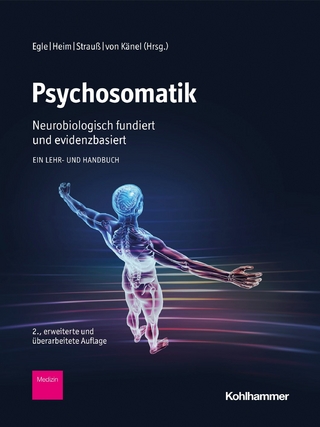Post- (eBook)
396 Seiten
Suhrkamp Verlag
978-3-518-78234-7 (ISBN)
Bei der Vorsilbe Post- handelt es sich um die erfolgreichste Erfindung der Geistes- und Sozialwissenschaften seit 1945. Zum weltweiten Einsatz kommt sie in Großwörtern wie Posthistoire, Postmoderne oder Postkolonialismus sowie in zahllosen weiteren Kombinationen. Offensichtlich ist es Trend geworden, sich in die Nachzeit einer Vorzeit zu versetzen. Doch nicht hinter jedem Erfolg steckt eine gute Idee. Das ist auch hier der Fall, wie Dieter Thomä in seiner aufregenden Kritik jener Geistes- und Lebenshaltung zeigt, die auf den Post-Weg geraten ist.
Nicht nur zeugt es laut Thomä von epochaler Einfallslosigkeit, ein altes Wort mit Post- zu schmücken und als letzten Schrei auszugeben. Darüber hinaus haben die Post-Theoretiker ein grundsätzliches Problem: Sie lassen etwas hinter sich und schleppen es doch weiter mit. Sie fahren in die Zukunft, schauen dabei aber dauernd in den Rückspiegel. Sie bleiben in der Ambivalenz zwischen Anhänglichkeit und Aufbruch stecken. Höchste Zeit also für die Verabschiedung der Postismen unserer Zeit. Dieses Buch ist ihr Nachruf und zugleich ein Plädoyer für etwas von ihnen Verschiedenes: Geistesgegenwart.
<p>Dieter Thomä, geboren 1959, ist emeritierter Professor für Philosophie an der Universität St. Gallen.1996 erhielt er den Joseph-Roth-Preis für internationale Publizistik (Preis für Essayistik). Sein Buch <em>Puer robustus</em> stand 2017 auf der Shortlist des Tractatus-Preises.</p>
3. Einfallslosigkeit
Der große Kulturtheoretiker Stuart Hall sagt über das »Postkoloniale«: »Es ist, was es ist, weil vorher etwas anderes passiert ist, aber es ist auch etwas Neues.«8 Mit diesem Satz ist leider nicht viel gesagt, denn er passt fast auf alles, was irgendwo irgendwann passiert. Ein bisschen mehr Mühe mit dem, was »vorher« war, und mit dem »Neuen« müssen sich Post-Theoretiker schon geben. Ihr Geschäft jedenfalls sind Nachfolgeregelungen. Ein Epochenwechsel wird dekretiert, indem ein Name aus dem Fundus gefischt und ihm eine Vorsilbe verpasst wird. Indem die Post-Theoretiker sich hinter Vorläufern verstecken, unterscheiden sie sich von all denen, die eine Zeit oder Bewegung mit einem eigenen, einem neuen Namen versehen. Man kennt solche Taufen von der berühmten Querelle des Anciens et des Modernes im 17. Jahrhundert, von feindlichen Geschwistern wie Klassik und 16Romantik oder vom Hin und Her zwischen Idealismus einerseits, Empirismus, Realismus und Materialismus andererseits.
Im Lauf der Jahrhunderte sind viele Großwörter aufgetreten, die Epoche gemacht und stilbildend gewirkt haben. Historiker des Sozialen, der Kultur und der Kunst können ein Lied davon singen, und Bildungsbürger haben dieses Lied brav auswendig gelernt, das lange vor der Gotik einsetzt und sich weit über den Jugendstil hinaus fortsetzt. Manche dieser Wörter oder Begriffe klingen inzwischen befremdlich, doch aus der Inflation der Postismen darf man nicht den Schluss ziehen, das epochale name dropping sei erschöpft und Innovation auf diesem Gebiet sei nur per Vorsilbe möglich. Dagegen spricht – nicht nur – die Karriere des Anthropozäns.
In früheren Jahren sind Post-Wörter auf keinen grünen Zweig gekommen.9 Kopernikus ist nicht für die Entdeckung des »postptolemäischen« Weltbilds gerühmt worden, die citoyens haben 1789 nicht »Es lebe der Postfeudalismus!« gerufen, Karl Marx und Friedrich Engels waren klug genug, sich 1848 nicht für den Titel »Manifest der Postkapitalistischen Partei« zu entscheiden. Die Leute damals hätten wohl gegähnt ob solch epochaler Einfallslosigkeit. Theoretiker und Aktivisten der Vergangenheit wären nicht auf die Idee gekommen, ein Post-Wort in den Mund zu nehmen und sich dabei im Vollgefühl einer Großtat zu ergehen. Eher wäre ihnen ein Arm abgefallen, als dass sie der neuen Welt ein Schild mit einem alten Wort umgehängt hätten.
Das ist bei vielen Theoretikern und Aktivisten der Gegenwart anders. Sie sehen eine Großtat darin, sich beim Weg in die Zukunft einen Klotz ans Bein zu binden. Selbst denjenigen, die eines bestimmten Post-Worts überdrüssig sind, fällt manchmal nichts Besseres ein, als ihre proaktive Rolle mit doppelter Vorsilbe zu unterstreichen. So verkündet der Architekt Tom Turner stolz: »Lasst uns die Post-Postmoderne begrüßen«, fügt aber dankenswerterweise hinzu, er werde »für einen besseren Namen« für seine neue Bewegung »beten«. Nicoline Timmer bewundert den 17Schriftsteller David Foster Wallace dafür, eine »post-postmoderne Wende« eingeleitet zu haben, wogegen dieser, wenn er denn noch lebte, wohl scharf protestieren würde. »Terms like ›postmodernist‹ […] send me straight to the bathroom«, hat Wallace mal gesagt, und würde man dies übersetzen, käme man um das Wort »Kotzen« wohl leider nicht herum. Nicole Simek behauptet, es sei eine »›post-postkoloniale‹ Wende« im Gang. Rosalind Gill »bedauer[t]«, »vom Post-Postfeminismus noch weit entfernt« zu sein.10
Unter Akademikern ist das Spiel beliebt, etwas mit einem Poststempel zu versehen. »›Posting‹ things« lautet das entsprechende Wortspiel im Englischen, und dazu passt der Kommentar: »Zweifellos weist diese populäre Praxis einen Mangel an Erfindungsgabe auf.« Da Postismen nichts anderes tun, als dem Vorgegebenen einen Schritt voraus zu sein, müssen sie damit rechnen, ihrerseits überholt werden. Daher bietet sich ein weiteres Wortspiel mit der guten alten Post an: »Ideologische Richtungen und Bewegungen, die mit der Vorsilbe ›post‹ versehen sind, enden häufig im Lagerhaus für nicht zugestellte Post.«11
Dass diverse Postismen ihr Verfallsdatum rasch erreichen, haben sie mit anderen zeitdiagnostischen Fehlversuchen gemeinsam. Dazu gehört die Sequenz der Generationen X, Y, Z und α ebenso wie die sogenannten turns (linguistic, performative, spatial, iconic, affective, ontological etc.), bei denen sich Kulturwissenschaftler so lange um die eigene Achse drehen, bis ihnen schwindlig wird. Auch Zahlenspiele helfen vor Abnutzung nicht, wie Digitalisierung 3.0, Industrie 4.0 oder Marketing 6.0 belegen.
Gelegentlich ist den Post-Theoretikern der Verzicht, die eigene Agenda positiv zu bezeichnen, als Vorzug ausgelegt worden: Sie würden sich der Kraftmeierei des totalen Neuanfangs enthalten oder die Macht einer alles überstrahlenden beziehungsweise überschattenden Vorzeit spürbar machen. An die Stelle des Tadels der Einfallslosigkeit tritt das Lob der Bescheidenheit, zu dem wiederum neigt, wer utopische Energien für verbraucht hält 18und »Zukunftsmüdigkeit« verspürt.12 Hans Ulrich Gumbrecht schreibt:
Die Zukunft [scheint] gegen alle Prognosen und gegen alles handelnde Disponieren verschlossen, während die Vergangenheit im intellektuellen und selbst im materiellen Sinn – etwa als Möglichkeitenüberschuss – präsent bleibt. […] Statt in beständigem Übergang befindlich fühlen wir uns eingeschlossen in eine komplexe, alle Vergangenheiten beinhaltende und die Zukunft verweigernde breite Gegenwärtigkeit.
Dazu passt ein Satz Paul Valérys, »l'avenir est comme le reste: il n'est plus ce qu'il était«, den Alexander Kluge recht frei übersetzt hat: »Auch die Zukunft ist leider nicht mehr das, was sie einmal war.« Als Valéry seinen Satz 1937 niederschreibt, hat er nicht Erwartungsverlust im Sinn, sondern umgekehrt eine unheimliche Aufblähung der Zukunft. Weil so vieles denkbar erscheine, seien seriöse »Vorhersagen« nicht mehr möglich und Verunsicherung sowie Desorientierung die Folge. Valéry hätte Friedrich Nietzsche zitieren können: »Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts nach allen Seiten? Giebt es noch ein Oben und Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts?«13
Nicht nur die Abschließung, auch die Öffnung der Zukunft kann auf verdrehte Weise die Nachfrage nach der Vorsilbe Post- in die Höhe treiben. Dann nämlich entnimmt man ihr die beruhigende Botschaft, dass man sich um all das Unbekannte und Unheimliche, was kommen mag, nicht eigens kümmern muss, weil die Zukunft einfach irgendwann als Nachzeit eintreten wird. Mit Post- weiß man, was man hat – oder meint es zu wissen. Schon Valéry kennt diese Strategie – und nimmt sie auf den Arm: »Wir gehen rückwärts in die Zukunft, und diese Art der Fortbewegung hat einstens ihren Nutzen gebracht und einige glückliche Ergebnisse; doch der Krebs selbst hat davon ablassen müssen.«14
19Das Motiv der Rückwärtsgewandtheit geistert – weit entfernt von Valéry – in der Post-Welt herum. Zygmunt Bauman schreibt: »Das ist es letztlich, wofür die Idee der Postmoderne steht: eine Existenz, die völlig durch die Tatsache bestimmt und definiert ist, dass sie post ist (hinterher kommt) und überwältigt ist vom Bewusstsein, sich in einer solchen Lage zu befinden.« Anne McClintock sieht diese Haltung in ihrer Analyse des Postkolonialismus wesentlich kritischer: »Wir laufen Gefahr, in einem geschichtlich leeren Raum stillgestellt zu werden, in dem uns eine einzige Richtung offen steht, wir gebannt auf die vergangene Epoche blicken und in einer auf Dauer gestellten Gegenwart gefangen sind, die nur als ›post‹ gekennzeichnet ist.«15 Im Extremfall führt dies zu einer defensiven Haltung, mit der man den Forderungen des Tags entgeht und der Unsicherheit über das Kommende ein Schnippchen schlägt. Nur eine Freiheit interessiert in diesem...
| Erscheint lt. Verlag | 16.3.2025 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften |
| Schlagworte | aktuelles Buch • Bestseller bücher • Bestsellerliste • buch bestseller • Bücher Neuerscheinung • Geistesgeschichte • Neuerscheinung 2025 • neues Buch • Posthistoire • Posting things • Postismen • Postismus • Postkolonialismus • Postmoderne • Post-Theoretiker • Post-Theorie • Post-Wörter • Sachbuch-Bestenliste • Sachbuch-Bestseller-Liste |
| ISBN-10 | 3-518-78234-7 / 3518782347 |
| ISBN-13 | 978-3-518-78234-7 / 9783518782347 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,8 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich