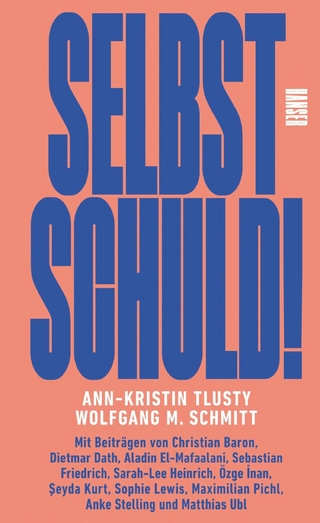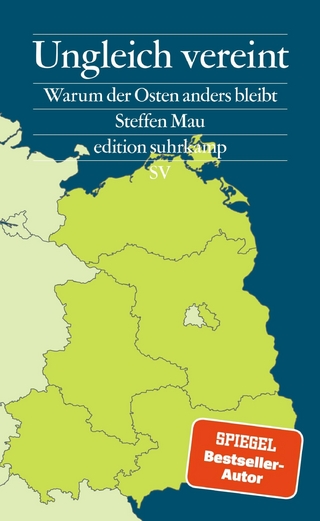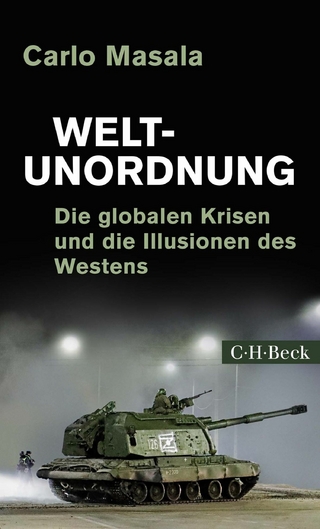Die Welt nach Gaza (eBook)
304 Seiten
S. Fischer Verlag GmbH
978-3-10-492220-1 (ISBN)
Pankaj Mishra, geboren 1969 in Nordindien, schreibt seit vielen Jahren regelmäßig für die »New York Review of Books«, den »New Yorker« und den »Guardian« über den indischen Subkontinent, über Afghanistan und China. Er gehört zu den großen Intellektuellen des modernen Asien und hat zahlreiche Essays in »Lettre International« und »Cicero« veröffentlicht; auf Deutsch sind darüber hinaus der Roman »Goldschakal« und der Essayband »Lockruf des Westens. Modernes Indien« erschienen. Pankaj Mishra war u. a. Gastprofessor am Wellesley College und am University College London. Für sein Buch »Aus den Ruinen des Empires«, das 2013 bei S. Fischer erschien, erhielt er 2014 den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung. Bei S. Fischer sind von ihm außerdem »Begegnungen mit China und seinen Nachbarn«, »Das Zeitalter des Zorns. Eine Geschichte der Gegenwart« und »Freundliche Fanatiker« erschienen. Er lebt abwechselnd in London und in Mashobra, einem Dorf am Rande des Himalaya. Literaturpreise: 2014 Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2014 Windham Campbell Literature Prize der Yale University 2013 Crossword Book Award for Nonfiction
Pankaj Mishra, geboren 1969 in Nordindien, schreibt seit vielen Jahren regelmäßig für die »New York Review of Books«, den »New Yorker« und den »Guardian« über den indischen Subkontinent, über Afghanistan und China. Er gehört zu den großen Intellektuellen des modernen Asien und hat zahlreiche Essays in »Lettre International« und »Cicero« veröffentlicht; auf Deutsch sind darüber hinaus der Roman »Goldschakal« und der Essayband »Lockruf des Westens. Modernes Indien« erschienen. Pankaj Mishra war u. a. Gastprofessor am Wellesley College und am University College London. Für sein Buch »Aus den Ruinen des Empires«, das 2013 bei S. Fischer erschien, erhielt er 2014 den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung. Bei S. Fischer sind von ihm außerdem »Begegnungen mit China und seinen Nachbarn«, »Das Zeitalter des Zorns. Eine Geschichte der Gegenwart« und »Freundliche Fanatiker« erschienen. Er lebt abwechselnd in London und in Mashobra, einem Dorf am Rande des Himalaya. Literaturpreise: 2014 Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2014 Windham Campbell Literature Prize der Yale University 2013 Crossword Book Award for Nonfiction Laura Su Bischoff, geboren 1984, studierte Amerikanistik, Anglistik und Neuere Geschichte. Seit 2014 übersetzt sie Sachbücher und Literatur aus dem Englischen, u.a. von Arthur Conan Doyle, Bee Wilson, Daniel Immerwahr, David Abulafia und Pankaj Mishra.
Ein streitbarer Debattenbeitrag, der eine westliche Deutungshoheit aufzubrechen versucht.
Prolog
Denken Sie an das Unmaß von Brutalität, Grausamkeit und Verlogenheit, das sich jetzt in der Kulturwelt breitmachen darf. Glauben Sie wirklich, daß es einer Handvoll gewissenloser Streber und Verführer geglückt wäre, all diese bösen Geister zu entfesseln, wenn die Millionen von Geführten nicht mitschuldig wären?
Sigmund Freud
Am 19. April 1943 griffen ein paar Hundert junge Jüdinnen und Juden im Warschauer Ghetto nach jeder Waffe, die sie finden konnten, und schlugen zurück gegen ihre Nazi-Verfolger. Die Kämpferinnen und Kämpfer versuchten, wie Marek Edelman, einer ihrer Anführer sich später erinnerte, ihre Würde zu retten: »Es ging darum, uns nicht abschlachten zu lassen, wenn wir an der Reihe waren. Eine Wahlmöglichkeit bestand allenfalls hinsichtlich der Art zu sterben.«
Nach einigen verzweifelten Wochen wurden die Widerstandskämpfenden überwältigt. Die meisten von ihnen starben. Einige derer, die am letzten Tag des Aufstands noch lebten, begingen in ihrem Befehlsbunker Selbstmord, während die Nazis Gas hineinpumpten. Nur einigen wenigen gelang eine Flucht durch die Kanalisation. Dann brannten deutsche Soldaten das Ghetto Block für Block nieder, wobei sie Flammenwerfer einsetzten, um die Überlebenden »auszuräuchern«.
Der polnische Dichter Czesław Miłosz erinnerte sich später, dass er »an einem wunderbar ruhigen Abend in ländlicher Umgebung am Stadtrand von Warschau« aus dem Ghetto Schreie gehört habe.
Diese Schreie bereiteten uns eine Gänsehaut. Es waren die Schreie Tausender Menschen, die ermordet wurden. Ich fuhr durch die stillen Räume der Stadt, ein roter Feuerschein unter gleichgültigen Sternen, hinaus in die wohltuende Stille von Gärten, in denen Pflanzen eifrig Sauerstoff ausstießen, die Luft duftete und ein Mensch spürte, dass es gut war, am Leben zu sein. Es lag etwas besonders Grausames in diesem friedvollen Abend, dessen Schönheit zugleich mit menschlichem Verbrechen das Herz berührte. Wir sahen einander nicht in die Augen.
In einem Gedicht, das Miłosz im besetzten Warschau schrieb, »Il Campo dei Fiori«, evoziert er das Kettenkarussell ganz in der Nähe der Ghettomauer, auf dem Jahrmarktsbesuchende hinauf in den Himmel fliegen, durch den Rauch brennender Leichen hindurch, während fröhliche Musik die Todesschreie und die Verzweiflung überdeckt. Als er später im kalifornischen Berkeley lebte, während das US-Militär Hunderttausende von Vietnamesen und Vietnamesinnen bombardierte und tötete, eine Gräueltat, die er mit den Verbrechen Hitlers und Stalins verglich, empfand er erneut eine beschämende Komplizenschaft mit extremer Barbarei – »Wenn wir zum Mitgefühl fähig und zugleich machtlos sind, leben wir in einer verzweifelten Gereiztheit.«
Es ist der von den westlichen Demokratien geförderten Vernichtung Gazas durch Israel zu verdanken, dass diese körperlichen Qualen über Monate hinweg Millionen von Menschen zugefügt wurden – unfreiwillige Zeuginnen und Zeugen eines Akts politisch Bösen, die es sich erlaubt hatten, gelegentlich der Ansicht zu sein, dass es gut sei, am Leben zu sein, und die dann die Schreie einer Mutter hörten, die zusehen musste, wie ihre Tochter in einer weiteren von Israel bombardierten Schule verbrannte.
Die Shoah hinterließ ihre Narben bei mehreren jüdischen Generationen. Jüdische Israelis erlebten 1948 die Geburt ihres Nationalstaats als eine Frage von Leben und Tod, und das Gleiche geschah nochmals 1967 und 1973 inmitten einer Vernichtungsrhetorik seitens ihrer arabischen Feinde. Vielen Jüdinnen und Juden, die mit dem Wissen aufgewachsen sind, dass die jüdische Bevölkerung Europas nahezu vollständig ausgelöscht wurde, und zwar nur deshalb, weil sie Juden waren, kann die Welt nur zerbrechlich erscheinen. Bei ihnen entfachten die am 7. Oktober 2023 von der Hamas und anderen palästinensischen Gruppen in Israel begangenen Massaker und Geiselnahmen erneut die Angst vor einem weiteren Holocaust.
Von Anfang an war jedoch klar, dass die fanatischste israelische Führung der Geschichte nicht davor zurückscheuen würde, einen allgegenwärtigen Eindruck der Verletzung, des Verlusts und des Schreckens für sich auszunutzen. Die israelische Führung beanspruchte das Recht auf Selbstverteidigung gegenüber der Hamas, doch Omer Bartov, ein wichtiger Historiker des Holocaust, erkannte im August 2024, dass sie von Anfang an die Absicht hatte, »den ganzen Gazastreifen unbewohnbar zu machen und dessen Bevölkerung derart zu entkräften, dass sie entweder ausstarb oder mit allen Mitteln versuchte, aus dem Gebiet zu fliehen«. So wurden denn Milliarden von Menschen in den Monaten nach dem 7. Oktober Zeuginnen und Zeugen eines außergewöhnlichen Angriffs auf Gaza, dessen Opfer, wie Blinne Ní Ghrálaigh, eine irische Anwältin und Vertreterin Südafrikas beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag, es ausdrückte, »ihre eigene Vernichtung über die Medien in Echtzeit übertrugen, in der bislang vergeblichen Hoffnung, die Welt werde etwas tun«.
Die Welt oder genauer: der Westen, tat nichts. Hinter den Mauern des Warschauer Ghettos hatte Marek Edelman »fürchterliche Angst […], dass niemand in der Welt Notiz davon nahm« und »nichts, keine Nachricht über uns, jemals hinausdrang«. In Gaza war das nicht der Fall. Dort sagten Opfer über die sozialen Medien ihren Tod Stunden vor ihrer Hinrichtung voraus und ihre Mörder verbreiteten die Bilder ihrer Taten fröhlich auf TikTok. Doch die Liquidierung Gazas wurde mit Hilfe der Instrumente der militärischen und kulturellen Hegemonie des Westens Tag für Tag vernebelt oder sogar geleugnet – von den Führenden der Vereinigten Staaten und Großbritanniens, die den Internationalen Strafgerichtshof und den Internationalen Gerichtshof angriffen, bis hin zu den Herausgebern der New York Times, die ihre Redaktion in einem internen Memo anwiesen, die Ausdrücke »Flüchtlingslager«, »besetzte Gebiete« und »ethnische Säuberung« zu vermeiden.
Jeder Tag wurde vergiftet von dem Wissen, dass Hunderte ganz gewöhnlicher Menschen ermordet wurden oder die Ermordung ihrer Kinder mitansehen mussten, während wir weiterhin unser Leben führten. Flehentliche Bitten von Leuten in Gaza, oft von bekannten Schriftstellern und Journalisten, die warnten, dass ihnen oder ihren Angehörigen der Tod drohte, gefolgt von der Nachricht über ihren Tod, verbanden sich zu einem demütigenden Gefühl physischer und politischer Ohnmacht. Wer sich aufgrund der Schuld hilfloser Verstrickung getrieben fühlte, in Joe Bidens Gesicht nach irgendeinem Zeichen von Erbarmen, irgendeinem Anzeichen für eine Beendigung des Blutvergießens suchte, fand dort nur eine gespenstisch glatte Härte, gebrochen allenfalls von einem nervösen Grinsen, wenn er die israelische Lüge nachplapperte, Palästinenser hätten israelische Säuglinge geköpft. Berechtigte Hoffnungen aufgrund der einen oder anderen Resolution der Vereinten Nationen, verzweifelter Appelle von Hilfsorganisationen, der Kritik von Richtern und Gutachtern in Den Haag und Bidens in letzter Minute erklärtem Verzicht auf eine erneute Präsidentschaftskandidatur wurden brutal zunichtegemacht.
Ende 2024 hatten viele Menschen, die weit entfernt von den Schlachtfeldern Gazas lebten, zumindest entfernt das Gefühl, sie wären durch eine epische Landschaft des Elends und des Scheiterns, der Angst und der Erschöpfung gezogen worden. Das mag bloßen Zuschauerinnen und Zuschauern wie ein übertriebener emotionaler Zoll erscheinen. Doch der Schock und die Empörung, die Picasso hervorrief, als er sein Gemälde Guernica mit all seinen schreienden Personen und Pferden angesichts der Bombardierung aus der Luft vorstellte, werden heute von einer Momentaufnahme aus Gaza ausgelöst, auf der ein Mann zu sehen ist, der die kopflose Leiche seines Kindes hält.
Der Krieg wird eines Tages Teil der Vergangenheit sein, und die Zeit wird möglichweise dessen haushohen Berg an Schrecken etwas einebnen. Doch Zeichen der Katastrophe werden für Jahrzehnte in Gaza erhalten bleiben: in den verstümmelten Körpern, den zu Waisen gemachten Kindern, dem Schutt der Städte, den heimatlos gewordenen Menschen und in der tiefgreifenden Präsenz und dem allgegenwärtigen Bewusstsein massenhaften Verlusts. Und wer dem Töten und Verstümmeln Zehntausender in einem kleinen Küstenstreifen hilflos aus der Ferne zuschaute und auch den Beifall oder die Gleichgültigkeit der Mächtigen sah, wird mit einer inneren Wunde und einem Trauma weiterleben, die viele Jahre nicht heilen und vergehen werden.
Der Streit über die Frage, wie man die von Israel ausgeübte Gewalt bezeichnen soll – als legitime Selbstverteidigung, als gerechten Krieg in schwieriger städtischer Umgebung, als ethnische Säuberung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit –, wird niemals beigelegt werden. In der Konstellation moralischer und rechtlicher Verstöße Israels lassen sich jedoch einfach Anzeichen für eine überaus schwere Gräueltat erkennen: etwa die von führenden israelischen Politikern offen und routinemäßig geäußerte Entschlossenheit, Gaza auszuradieren; deren implizite Billigung durch eine öffentliche Meinung, die sich über eine unzureichende Vergeltung durch die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (Israel Defense Forces, IDF) in Gaza beklagt; ihre Gleichsetzung der Opfer mit dem unversöhnlich Bösen; die Tatsache, dass die meisten Opfer vollkommen unschuldig waren, in ihrer Mehrzahl Frauen und Kinder; das Ausmaß der Verwüstung, um ein Vielfaches größer als die durch die Bombardierung...
| Erscheint lt. Verlag | 26.2.2025 |
|---|---|
| Übersetzer | Laura Su Bischoff |
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | 7. Oktober Israel • Bewaffneter Konflikt • Debattenbuch • Dekolonialisierung • Der Westen • Gaza • Gaza-Krieg • Geopolitik • Globaler Süden • HAMAS • Hisbollah • Historische Hintergründe Nahostkrieg • Holocaust • Imperialismus • Israel • Israel-Gaza Konflikt • israelisch-Palästinensischer Konflikt • Kolonialismus • Libanon • Naher Osten • Palästina • Politische Analyse • Politisches Sachbuch • Postkolonial • Postkoloniale Perspektive auf Nahost • Terrorismus • Westliche Dominanz und neue Ordnungen |
| ISBN-10 | 3-10-492220-9 / 3104922209 |
| ISBN-13 | 978-3-10-492220-1 / 9783104922201 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 4,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich