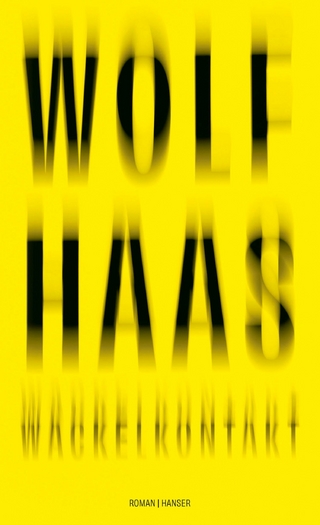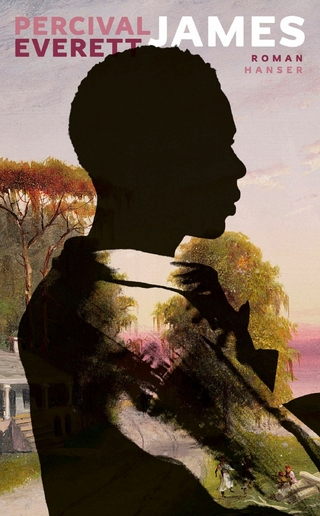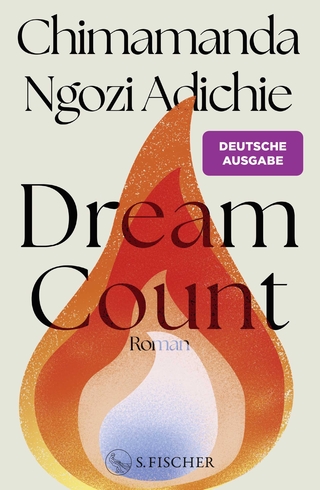Was du nie sehen wirst (eBook)
320 Seiten
Arche Literatur Verlag AG
978-3-03790-155-7 (ISBN)
Sacha Bronwasser ist Autorin, Speakerin, Kunsthistorikerin und Kuratorin. Bevor sie 2019 ihren vielgelobten Debütroman Niets is gelogen veröffentlichte, arbeitete sie zwanzig Jahre lang als freie Kunstkritikerin für De Volkskrant, eine der größten niederländischen Tageszeitungen. Von 2016 bis 2022 war sie Redakteurin und Gastgeberin der Kunsttalkshow Stampa in Amsterdam. Im Februar 2023 erschien ihr zweiter Roman Was du nie sehen wirst, der von der Presse hymnisch besprochen, für den LIBRIS-Preis nominiert und zu einem großen Bestseller wurde.
Sacha Bronwasser ist Autorin, Speakerin, Kunsthistorikerin und Kuratorin. Bevor sie 2019 ihren vielgelobten Debütroman Niets is gelogen veröffentlichte, arbeitete sie zwanzig Jahre lang als freie Kunstkritikerin für De Volkskrant, eine der größten niederländischen Tageszeitungen. Von 2016 bis 2022 war sie Redakteurin und Gastgeberin der Kunsttalkshow Stampa in Amsterdam. Im Februar 2023 erschien ihr zweiter Roman Was du nie sehen wirst, der von der Presse hymnisch besprochen, für den LIBRIS-Preis nominiert und zu einem großen Bestseller wurde. Lisa Mensing, geboren 1989, studierte in Utrecht und Münster Interdisziplinäre Niederlandistik und Literarisches Übersetzen. Heute übersetzt sie Prosa, Theaterstücke sowie Lyrik aus dem Niederländischen. Darüber hinaus arbeitet sie als Literaturwissenschaftlerin an der Universität Münster und widmet sich dort vor allem übersetzungsrelevanten Themen.
*
Wenn Philippe später an diese Jahre zurückdenkt, die ersten drei Jahre mit Nicolas, kommen sie ihm vor wie ein leichtes, aus der Zeit gefallenes Intermezzo. Die Tage reihen sich in gemächlichem Glück aneinander. Er geht zur Arbeit, verbringt die Stunden mit verantwortungsvollen, angenehm abstrakten Beschäftigungen: Er ist für die Kostensenkung zuständig. Die Planung einer neuen Fertigungsstraße, die Verlegung von Arbeitsplätzen an andere Produktionsstätten, vor allem nach Asien – das alles sind mächtige Dynamiken; Tausende Arbeitsstellen, verpackt in Zahlen und pastellfarbene Balkendiagramme, die er in den wöchentlichen Sitzungen am Overheadprojektor bespricht.
Abends kehrt er in eine aufgeräumte und frisch duftende Wohnung zurück. Sein Sohn ist gebadet und gefüttert worden, und Philippe sagt »bis morgen« zu dem Au-pair, das am anderen Ende der Stadt im Dienstbotenzimmer seines Elternhauses wohnt, angenehm außer Sichtweite. Er wartet auf Laurence, sie wärmen etwas von Picard Surgelés in der Mikrowelle auf, trinken ein Glas Wein. Mindestens zweimal pro Woche schläft er mit seiner Frau; sie hat ihre schüchterne Begeisterung aus der Zeit vor der Geburt zurückerlangt und läuft gern nackt durch die Wohnung, was ihn erregt. Manchmal rauchen sie danach einen Joint – der Koch in der Brasserie um die Ecke verkauft niederländisches Gras – und lüften anschließend das Schlafzimmer.
Nach ein paar Monaten hat Philippe vergessen, wie er davor war. Er vergisst die ständigen Nackenverspannungen, die Kopfschmerzen, die Nächte, in denen er am Schlaf nur entlanggeschrammt ist. Er vergisst die aufflammenden Schreckensbilder, die ihn seine ganze Jugend und auch danach jederzeit überfallen konnten. Bilder, von denen er nie jemandem erzählt hat, von denen auch Laurence nichts weiß: tote Tiere am Wegesrand, abgerissene Gliedmaßen, ein im Fluss treibender Körper, ganze Häuser mit sich reißende Fluten, das an einem Bonbon erstickende Kind, unaufhaltsam aus der Fußbodenleiste wuselnde Kakerlaken, von umgekippten Bücherregalen erschlagene Babys, Massenkarambolagen, von einer Krankheit schwarz gefärbte Zungen. Er vergisst, dass diese Bilder immer da waren. Er vergisst die Angst vor diesen Bildern. Er vergisst sogar, wie sich Angst anfühlt. Dieser Lebensabschnitt ist hell, fast ausgeblichen, eine sonnenüberflutete Impression. Zum ersten Mal in seinem dreißigjährigen Leben tritt er der Zukunft arglos, voller Vertrauen entgegen, und langsam gewöhnt er sich daran. Philippe glaubt allmählich, dass es immer so bleiben wird.
Das alles müsste gar nicht merkwürdig sein. Ängste können wachsen, aber auch schrumpfen, sie können auf genauso unerklärliche Weise verschwinden, wie sie gekommen sind. Aber um Philippe herum, außerhalb von seinem strahlend hellen Kokon des Glücks, bewegt sich die Stadt in eine andere Richtung. Paris, so wird man später sagen, gerät gerade in jenen Jahren in die Fänge der Angst.
Mitte Juli 1983 explodiert am Flughafen Orly eine Bombe vor dem Schalter von Turkish Airlines. Acht Tote, fünfzig Verletzte – es ist ein Blutbad, zu dem sich der syrische Zweig der armenischen Befreiungsfront ASALA bekennt, weshalb kaum jemand versteht, worum es überhaupt geht. Ein paar Wochen lang ist »Paris in fear«, wie die Titelstory des Time Magazine behauptet. Der Flugverkehr kommt zum Erliegen (nicht lange, es sind Sommerferien, gerade findet der Exodus der Pariser statt, die vor der Hitze der Stadt flüchten), und in den Gängen der Métro sieht man mehr Polizisten. Aber es ist auffällig, wie schnell der Anschlag abgetan wird. Hier wurde die Türkei angegriffen, nicht Frankreich. Zwar auf französischem Boden, aber: Der Hass richtete sich gegen andere. Auch Laurence, die zu dem Zeitpunkt noch im Mutterschutz ist, fährt am Ende des Sommers wieder täglich zum Flughafen und geht zur Arbeit. Philippe betrachtet seinen Sohn, wähnt sich durch seinen Schutzschild der stupiden Glückseligkeit unverwundbar. Die Monate ziehen geräuschlos ins Land. Nicolas bekommt Zähne, fängt an zu krabbeln, stellt sich auf seine molligen Beinchen, macht seine ersten Schritte im Beisein des Au-pairs, das ihn das Kunststück für seine Eltern wiederholen lässt. Er wächst, beginnt zu sprechen, nie zuvor hat es auf französischem Boden ein klügeres oder hübscheres Kind gegeben.
Niemand weiß, wann Frösche merken, dass das Wasser den Siedepunkt erreicht. Niemand legt den Wendepunkt fest, der kann erst im Nachhinein bestimmt werden. Kurz vor Weihnachten 1983 explodiert eine Bombe in der Klimaanlage des Dreisternerestaurants Le Grand Véfour im Palais Royal. Die zehn Verletzten werden vom Glas, Kristall und Porzellan der Fenster, Kronleuchter und Teller durchsiebt. Es gibt keine Toten, man findet keine Täter.
Es folgen Anschläge im Kaufhaus Marks & Spencer im Februar 1985 und einen Monat später im Kino Rivoli Beaubourg. Zielgerichtete Aktionen gegen einen ehemaligen zionistischen Vorstandsvorsitzenden der Kaufhauskette, gegen ein jüdisches Filmfestival, heißt es. »Einfach schrecklich«, hört man in der Kaffeepause und beim Aperitif, »da sieht man, dass es bei uns immer noch Antisemitismus gibt.« Das »uns« fühlt sich für viele Pariser allerdings weit weg an, auch wenn sie das nicht laut aussprechen. Auf ihren Minitels, die die Neuigkeiten schneller zu ihnen nach Hause bringen, als es die Zeitungen vermögen, werden die Ereignisse auf weiße Blockschrift vor schwarzem Hintergrund reduziert. Sie haben Angst, aber noch nicht genug. Das kommt erst später.
Vielleicht liegt es an den Bildern, die mit jedem Anschlag schneller gemacht, manchmal sogar schon in Farbe abgedruckt werden. Vielleicht hängt es mit den Reportern zusammen, die immer zügiger vor Ort sind und extra dafür ausgebildet werden, über solche Ereignisse zu berichten. Die gelernt haben, nicht erst zu den Einsatzleitern zu gehen, sondern sich gleich ihre O-Töne zu holen. Erstens: von ansprechbaren Opfern, zweitens: von den aufgelöstesten Augenzeugen, drittens: von den Einsatzkräften, am liebsten mit Verbandszeug und Blutkonserven in Aktion.
Vielleicht hat irgendwer einfach irgendwann das richtige Wort benutzt, ein Wort, das sich tief in das Bewusstsein der Bevölkerung einbrennt, das dafür sorgt, dass Menschen auf der Straße ihren Schritt beschleunigen und sich die Angst nicht mehr durch den Schlaf vertreiben lässt – wie auch immer, im Laufe des Jahres 1985 sind die Zwischenfälle zu einer »Welle« geworden. Und eine Welle kommt nie allein.
Am 7. Dezember 1985, die Stadt bereitet sich auf Weihnachten vor, explodieren Bomben inmitten der Kundschaft von Galeries Lafayette und Printemps Haussmann. Mehr als vierzig Verletzte liegen zwischen den zersplitterten Services im Untergeschoss des einen Kaufhauses und in der Parfumabteilung des anderen. Als ein »höllisches Odorama« bezeichnet es einer der ersten Berichterstatter vor Ort: Parfum vermischt mit dem Geruch von Blut, Urin und Schweiß. Das Fernsehen zeigt immer wieder Bilder von herabgestürztem Weihnachtsschmuck, von Einkaufenden im Schockzustand, besudelten Marmorböden und herumfliegenden Tragetaschen mit aufgedruckten Logos.
»Lafayette und Printemps« fühlt sich wie dieser Wendepunkt an. Jetzt kann es wirklich überall passieren, es kann jeden treffen, man kann sich nicht dagegen wappnen, es sei denn, man gibt das öffentliche Leben auf, und damit »würden wir Franzosen unsere Seele aufgeben«, sagt der Pariser Bürgermeister Jacques Chirac. Die Regierung bittet darum, nach verlassenen Gepäckstücken Ausschau zu halten, verdächtige Pakete zu melden, auf »auffälliges Verhalten« zu achten, auch wenn niemand weiß, was genau damit gemeint ist. Der libanesische Zweig der Hisbollah ist plötzlich allen ein Begriff, schleicht sich in alltägliche Gespräche.
Der Februar 1986 besteht aus einer Aneinanderreihung von schwarzen Tagen. In dem Monat, den alle auf dem Weg zum Frühling lieber überspringen würden, explodiert neben einem Hotel auf den Champs-Élysées eine Bombe, wird mit knapper Not ein Sprengsatz in den Toiletten auf der dritten Etage des Eiffelturms entschärft, explodieren Pakete in der Buchhandlung Gibert Jeune und bei fnac. Die Absicht dahinter ist diffus und gerade deshalb so beängstigend. Seht nur, hört man jetzt, das französische Leben wird geknechtet. Unsere Kultur, unsere Musik, unsere Lebensweise.
Es kommt zu einer Explosion im TGV von Paris nach Lyon, der Zähler steht mittlerweile bei siebenundachtzig Verletzten. Der Frühling ist rau und bleich wie das Gesicht von Präsident Mitterand, der nicht die richtigen Worte findet, um die Bevölkerung zu beruhigen. Am 20. März ist der Schrecken größer, weil es wieder Tote zu vermelden gibt – so schnell setzt die Gewöhnung ein; wenn es bei Verletzten bleibt, ist es nur halb so schlimm. Niemand behält amputierte Beine oder verlorene Augen im Gedächtnis. Niemand erinnert sich an die Frau, die für den Rest ihres Lebens nicht mehr sprechen kann, oder an den Mann, der für immer in diesem Moment gefangen bleibt.
Am Eingang der Einkaufspassage Galerie Point Show auf den Champs-Élysées explodiert eine Bombe. Die Besucher des angrenzenden Kinos flüchten nach dem dumpfen Knall nach draußen und finden sich auf dem Gehweg in einem Horrorfilm wieder. »Die Schaufenster, das Glas, das ganze Blut«, stammelt ein...
| Erscheint lt. Verlag | 12.3.2025 |
|---|---|
| Übersetzer | Lisa Mensing |
| Verlagsort | Zürich |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | Achtzigerjahre • Angst • Attentat • Au-pair • Erwachsenwerden • Fotografie • Identität • Kunst • Macht • Machtmissbrauch • Paris • Studentin • Terror • Universität |
| ISBN-10 | 3-03790-155-1 / 3037901551 |
| ISBN-13 | 978-3-03790-155-7 / 9783037901557 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 778 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich