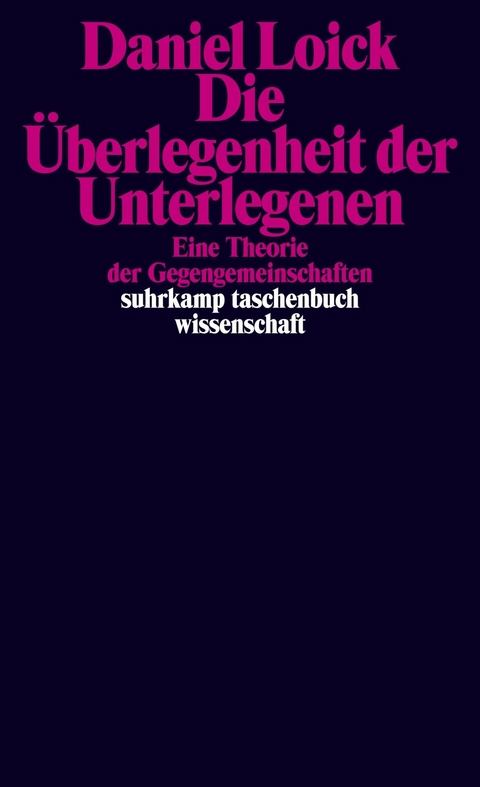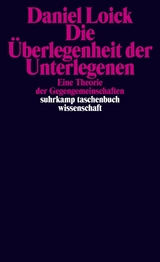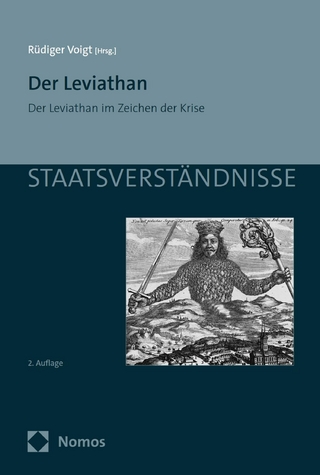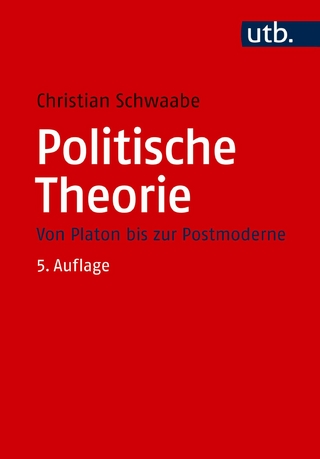Die Überlegenheit der Unterlegenen (eBook)
297 Seiten
Suhrkamp (Verlag)
978-3-518-77916-3 (ISBN)
Aus der Perspektive unterdrückter Gruppen ist das Leben der Reichen und Mächtigen nicht unbedingt begehrenswert, ja, es erscheint oft ignorant, korrupt, hässlich oder traurig. Menschen, deren Lebensrealität durch Erfahrungen der Gewalt und des Leids geprägt sind, besitzen häufig einen Zugang zu epistemischen Einsichten, ethischen Haltungen und ästhetischen Ausdrucksweisen, der privilegierten Subjekten fehlt. Ob sie diese Ressourcen erschließen können, hängt jedoch von bestimmten kollektiven Praktiken ab: davon, ob sie Mitglieder von Gegengemeinschaften sind. Befreiung kann daher nie durch Inklusion oder Integration in dominante Institutionen zustande kommen. Der Kampf um Befreiung ist vielmehr ein Kampf um Abolition.
Daniel Loick ist Associate Professor für Politische Philosophie und Sozialphilosophie an der Universität Amsterdam.
46
2. Die Überlegenheit der Unterlegenen
1968 gründete der Community-Aktivist Frank Critchlow im Londoner Stadtteil Notting Hill das Restaurant The Mangrove. Das Mangrove war nicht nur eine Gaststätte für karibisches Essen, sondern auch ein Treffpunkt für zahlreiche Intellektuelle, Aktivist:innen und Künstler:innen; zu den berühmten Gästen zählten Diana Ross, Jimi Hendrix, Nina Simone, Vanessa Redgrave und Selma und C.L.R. James. Der Ort entwickelte sich schnell zu einem zentralen Bezugspunkt einer schwarzen Gegenkultur im von Rassismus und kolonialen Kontinuitäten geprägten Großbritannien. Kurz nach seiner Eröffnung wurde das Restaurant immer wieder Objekt von Polizeischikanen wie willkürlichen Razzien und Kontrollen, die zum Ziel hatten, das Restaurant zum Schließen zu zwingen. 1970 kam es zu einer öffentlichen Demonstration gegen die Polizeigewalt, bei dem neun Demonstrierende festgenommen und wegen Verschwörung und Aufwiegelung angeklagt wurden. Der Prozess, der von einem weißen Staatsanwalt vor einem weißen Richter und einer mehrheitlich weißen Jury gegen die »Mangrove Nine« geführt wurde, hat breite öffentliche Aufmerksamkeit erregt. Nachdem es den Angeklagten gelungen war, die Prozessführung zu politisieren und als Bühne zu nutzen, um ihrem Protest über den grassierenden Rassismus der britischen Polizei Ausdruck zu verleihen, wurden die Beschuldigten letztlich in den meisten Anklagepunkten freigesprochen. In den folgenden Jahren wurde das Mangrove jedoch weiterhin Zielscheibe regelmäßiger polizeilicher Schikanen; 1992 musste es schließen. Knapp dreißig Jahre später widmete der Regisseur Steve McQueen dem Mangrove einen gleichnamigen Film, in dem eindrücklich die Verknüpfung sittlicher Praktiken von unterdrückten Gruppen und deren politische Bedeutung gezeigt wird: Die Konfrontation zwischen Critchlow und seinem Gegenspieler, dem Polizei-Constable Pulley, findet nicht nur auf der Straße und im Gerichtssaal, sondern auch im Restaurant statt. Als Pulley zum ersten Mal ins Restaurant kommt und provokativ Würstchen und Eier bestellt, entgegnet ihm Critchlow: »Das Mangrove macht sowas nicht … es gibt bei uns nur scharfes Essen. Für eine bestimmte Art von Gaumen.«[1]
47Das Mangrove ist ein klassisches Beispiel für die Orte von Gegengemeinschaften. Die Bedeutung solcher Orte für die Artikulation moralischer Empörung und politischer Gleichstellungsforderungen wird zumeist auch in der Soziologie und der Sozialphilosophie anerkannt. In seinem Essay »Das Ich im Wir« untersucht etwa Axel Honneth die Bedeutung der Gruppensozialisation für die individuelle Persönlichkeitsentwicklung. Gemäß seinem anerkennungstheoretischen Ansatz geht er davon aus, dass die in Gruppen gemachte Erfahrung positiver Wertschätzung essentiell für eine gelungene Identitätsformierung ist. Für Honneth übernimmt die Gruppe insbesondere eine ausgleichende Funktion, wenn einzelnen Subjekten der Status als gleiche Rechtssubjekte vorenthalten wird. In Anlehnung an einen Begriff von Richard Sennett spricht Honneth davon, dass marginalisierte oder ausgeschlossene Gruppen häufig »Gegenkulturen des Respekts«[2] herausbilden, die von spezifischen Regeln der Verantwortung und Achtung geprägt sind, worunter etwa Familien, Gangs, Jugendkulturen oder breite politische und soziale Bewegungen zu rechnen sind. Für Honneth ist die Form des Respekts und das daraus resultierende Selbstwertgefühl ausdrücklich »kompensatorisch«: Gegenkulturen gleichen das Anerkennungsdefizit der Gesamtgesellschaft aus, indem sie ihre Mitglieder mit einer Art behelfsmäßiger Not-Anerkennung versorgen. Diese Sichtweise ist gesellschaftstheoretisch weit verbreitet; Gegengemeinschaften werden häufig in einem derivativen Vokabular beschrieben, wonach gegengemeinschaftliche Normen diejenigen der Mehrheitsgesellschaft nur imitieren und substituieren. Diese Perspektive übersieht aber die konfrontativen Aspekte gegengemeinschaftlicher Sittlichkeit und damit auch die Spezifik der Emotionen und Affekte, die sie bei ihren Mitgliedern erzeugt. Die normative Struktur von Gegengemeinschaften ist weder kompensatorisch noch defizitär, sondern antagonistisch und kontestatorisch. Ihre Verwirklichung zielt daher nicht auf Gleichstellung, Inklusion, Integration oder Assimilation, sondern auf Abolition.
Eine Darstellung, die die Bedeutung der Sittlichkeit von Gegengemeinschaften als Ausgleichung eines Defizits beschreibt, deckt 48sich nicht mit dem Selbstverständnis vieler unterdrückter und ausgeschlossener Gruppen. Immer wieder haben diese darauf bestanden, dass ihre Lebensformen denen ihrer Unterdrücker:innen in einem bestimmten Sinne überlegen sind: So gehen epistemische Standpunkttheorien davon aus, dass Unterdrückungserfahrungen (wie sie etwa die Arbeiter.innen oder die Frauen machen) die Voraussetzungen für eine bessere Einsicht in die Natur gesellschaftlicher Ungerechtigkeit bieten; feministische care-Ethiken haben spezifische Moraleinstellungen und Handlungsorientierungen von Frauen zu identifizieren versucht, welche die Beschränkungen traditioneller, gerechtigkeitsorientierter Normkonzeptionen transzendieren; in Anlehnung an Foucaults Konzept der Ästhetik der Existenz haben etwa queere Subkulturen auf dem transgressiven Charakter der eigenen Lebensform gegenüber den bornierten Kulturpraktiken des Bürgertums insistiert; schwarze Communities haben ihren Selbstwert und ihre Würde durch eine eigene ästhetische Tradition und durch Slogans wie Black is Beautiful affirmiert – die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Diese Überlegenheit lässt sich in verschiedene Facetten auffächern, sie besitzt eine epistemische, eine normative und eine ästhetische Dimension und sie hat einen spezifischen affektiven Ertrag. All diese Komponenten sind dabei in denselben Ermöglichungsbedingungen verankert, nämlich in den realen sittlichen Praktiken von Gegengemeinschaften. Wie kann es jedoch sein, dass jemand ökonomisch, politisch, kulturell oder sozial beherrscht ist, aber zugleich über epistemische, normative, ästhetische oder affektive Vorteile verfügt? Wie kann diese Umkehrung genauer verstanden werden?
Die Überlegenheit des knechtischen Bewusstseins
Die Bestimmung des Menschen als zoon politikon, als ein politisches oder soziales Tier, gehört zu den leitenden Prämissen einer Reihe von philosophischen Traditionen, vom (Neo-)Aristotelismus über den Hegelianismus bis zum Kommunitarismus und Republikanismus. Dieser Definition zufolge hat Sozialität für das menschliche Leben nie nur einen instrumentellen, sondern auch einen inhärenten Wert; »deshalb verlangen die Menschen«, schreibt Aristoteles in der Politik, »auch wenn sie durchaus keiner gegenseitigen Hilfe 49bedürfen, nichtsdestotrotz nach dem Zusammenleben«.[3] Aristoteles’ Bestimmung zeichnet zum einen die menschliche Lebensform gegenüber anderen Lebensformen aus: Nur der Mensch besitzt das Sprachvermögen und die Vernunft, die für politisches Handeln nötig sind. Zum anderen ist die aristotelische Definition auch in einem normativen Sinne informativ; sie beinhaltet Exzellenzkriterien und gibt somit Auskunft über ideale Formen des menschlichen Lebens und Zusammenlebens. Die normativen Implikationen der aristotelischen Anthropologie lassen sich in objektiver und in subjektiver Hinsicht ausbuchstabieren. Aus der Grundannahme, dass der Mensch sich nur durch die Partizipation an sozialen Praktiken verwirklichen kann, wurde etwa die Schlussfolgerung gezogen, dass die objektiven Verhältnisse so eingerichtet werden sollen, dass sie eine solche Teilnahme zulassen. Zu den Bedingungen eines der menschlichen Lebensform angemessenen Gemeinwesens wurden in der politischen Philosophie unter anderem eine gemeinsame Hintergrundkultur, eine ausreichende Bildung und der Zugang zu kulturellen Gütern identifiziert. Um seinem Wesen als zoon politikon gerecht zu werden, muss der Mensch sich aber auch subjektiv eine soziale Handlungsorientierung zu eigen machen. Hierfür ist es nötig, den insbesondere für die Moderne typischen Individualismus zu überwinden und eine habitualisierte Gemeinwohlorientierung herauszubilden, die man als Tugend bezeichnen kann. Das optimale Zusammenspiel der objektiven und subjektiven Dimensionen hat zudem, so eine weitere Implikation der anthropologischen ...
| Erscheint lt. Verlag | 15.4.2024 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung ► Politische Theorie |
| Schlagworte | Abolitionismus • aktuelles Buch • Befreiung • Bücher Neuererscheinung • Bücher Neuerscheinung • Krimi Neuerscheinungen 2024 • Neuererscheinung • neuer Krimi • neuerscheinung 2024 • neues Buch • Privilegien • STW 2439 • STW2439 • suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2439 |
| ISBN-10 | 3-518-77916-8 / 3518779168 |
| ISBN-13 | 978-3-518-77916-3 / 9783518779163 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich