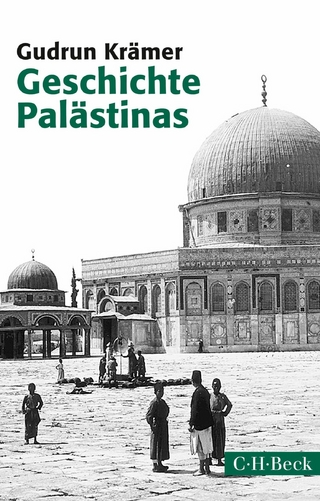Geschichte Chinas (eBook)
662 Seiten
Reclam Verlag
978-3-15-960694-1 (ISBN)
Kai Vogelsang, geb. 1969, ist Professor für Sinologie an der Universität Hamburg und Leiter der dortigen Abteilung für Sprache und Kultur Chinas.
Kai Vogelsang, geb. 1969, ist Professor für Sinologie an der Universität Hamburg und Leiter der dortigen Abteilung für Sprache und Kultur Chinas.
Einleitung
Mythen und Vorgeschichte (ca. 8. Jahrtausend –13. Jahrhundert v. Chr.). Regionale Kulturen und Herrschaft durch Gewalt
Die Entstehung Chinas (13.–6. Jahrhundert v. Chr.). Stratifizierung und die Ordnung durch Sitten
Das Klassische Altertum (5. Jahrhundert v. Chr. –23 n. Chr.). Zentrum, Peripherie und die Herrschaft der Schreibstube
Das chinesische Mittelalter (25–755). Das Zeitalter des Buddhismus
Der Beginn der Neuzeit (755-1270). Wirtschaftliche Revolution und die Erfindung der Kultur
Die Späte Kaiserzeit (1271–1793). Soziale Mobilität und staatliche Despotie
Das lange 19. Jahrhundert (1793–1911). Funktionale Differenzierung und die Erfindung der Nation
Das moderne China (1912–1978). Massengesellschaft und Totalitarismus
Chinas zweite Moderne (1978 bis heute). Weltgesellschaft und Nationalismus
Literaturhinweise
Dank
Nachweis der Karten und Abbildungen
Register
Zum Autor
Einleitung
Etwa 1200 v. Chr., Frühling, am achten Tag des Zyklus. Wu Ding, Herrscher der Dynastie Shang, steht im königlichen Ahnentempel, um ihn reich verzierte Opfergefäße aus Bronze, gefüllt mit Fleisch, Getreide und Hirsewein für die Geister der Ahnen. Einer von ihnen muss erzürnt sein, denn Wu Ding hat Zahnschmerzen. Ein Orakelpriester, der neben einem Feuer hockt, nimmt den polierten Brustpanzer einer Schildkröte vom Altar, bohrt einen glühenden Stab hinein und ruft: »Es ist Vater Jia!« – »Pock«, entsteht ein langer Sprung in dem Panzer. Vor den Augen der königlichen Familie versengt der Priester einen anderen Panzer: »Es ist Vater Geng!« – »Pock«, ein weiterer Sprung. Wu Ding befiehlt, ein Schaf und einen Hund als Opfer zu schlachten; mit blutigen Händen hält er die Panzer und sucht in den Sprüngen die Antwort auf die Frage, welcher Ahnengeist seine Zahnschmerzen verursacht.
Um das Jahr 510 v. Chr. Konfuzius steht in der Halle, als sein Sohn, Li, vorbeieilt. »Hast du die Lieder studiert?«, fragt Konfuzius ihn. »Noch nicht«, kommt die Antwort. »Wenn du die Lieder nicht studierst, hast du nichts zu sagen« – woraufhin Li umkehrt, um die Lieder zu studieren. Anderntags will sein Sohn wieder vorbeieilen, doch Konfuzius hält ihn an: »Hast du die Sitten studiert?« »Noch nicht«, entgegnet dieser. »Wenn du die Sitten nicht studierst«, bescheidet ihn Konfuzius, »besitzt du nichts, um zu bestehen.« So kehrt Li abermals um und lernt die Sitten.
873 n. Chr., 8. Tag des 4. Monats. In einer prachtvoll geschmückten Sänfte wird ein Fingerknochen des Buddha feierlich in die Hauptstadt der Tang verbracht. Die Luft ist gefüllt von Weihrauch und dem betörenden Gesang der Mönche, Tausende von Gläubigen säumen die Straßen, um die hochheilige Reliquie zu begrüßen. Der Kaiser selbst erweist ihr, tränenüberströmt, die Ehre. Von allen Seiten drängt das Volk herbei: Männer und Frauen, Arme und Reiche, Junge und Alte. Sie haben gefastet, um der Gnade Buddhas teilhaftig zu werden, nun öffnen sie ihrer Begeisterung alle Ventile. Ihre Rufe lassen die Erde erbeben. Viele kriechen auf Ellbogen und Knien, um Buddha zu ehren, ein Soldat hackt sich in besinnungsloser Hingabe den Arm ab, Mönche stecken sich die Kopfhaut in Brand. Eine Lawine von Ekstatikern wälzt sich durch die Stadt, bis der Knochen den Palast erreicht, wo er in ein kostbar behängtes, vorgewärmtes Bett gelegt wird.
1852, Jahr der Ratte, 9. Tag des 8. Monats. Zehntausend junge (und nicht mehr ganz so junge) Männer sind nach Nanjing gekommen, um die Provinzprüfung abzulegen. Seit ihrem 4. Lebensjahr haben sie für diese Prüfung studiert. Sie haben die Anfangsgründe der chinesischen Schrift erlernt, den Tausend-Zeichen-Text und andere Fibeln studiert und schließlich die Vier Bücher und die Fünf Kanonischen Schriften auswendig gelernt, fast eine halbe Million Zeichen. Mindestens drei Prüfungen haben sie schon hinter sich, doch die schwerste steht ihnen noch bevor: nur jeder Zwanzigste wird sie bestehen. Um ein Uhr nachts signalisieren drei Kanonenschüsse den Beginn der Prüfung: die Kandidaten betreten, beladen mit Tusche, Pinseln, Proviant und Bettzeug, das Prüfungsgelände, wo sie dreimal drei Tage und zwei Nächte in zugigen Einzelzellen verbringen werden. Streng bewacht und kontrolliert, müssen sie dort Fragen zu den kanonischen Schriften beantworten, Aufsätze zu Verwaltungsfragen und politischen Themen schreiben. Die Glücklichen, die diese Prüfung bestehen, haben Aussicht auf einen niedrigen Beamtenposten – oder auf die nächsthöhere Prüfung in der Hauptstadt.
Donnerstag, 18. August 1966. Um fünf Uhr morgens betritt Mao Zedong in grüner Uniform den Platz des Himmlischen Friedens. Die Hymne »Der Osten ist rot« schallt über den Platz, auf dem sich mehr als eine Million Menschen drängen: Jugendliche, Schüler und Studenten, die in vollgestopften Zügen aus dem ganzen Land nach Beijing gekommen sind, um ihr Idol zu sehen. Sie halten das rote Büchlein mit Maos Worten hoch, aus dem sie auswendig rezitieren; viele von ihnen tragen stolz die Armbinde der ›Roten Garden‹, die sie als Speerspitze der Großen Proletarischen Kulturrevolution ausweist. Ein Meer von roten Fahnen bedeckt den Platz, »Lang lebe die glorreiche Kommunistische Partei Chinas!«, »Lang lebe der Große Vorsitzende Mao! Zehntausend Jahre! Zehntausend Jahre!«, gellt es aus Hunderttausenden Kehlen, während Mao sein Bad in der Menge nimmt. Keiner der jungen Leute wird dieses Erlebnis vergessen. Wer besonderes Glück hatte, erhaschte einen Blick des geliebten Führers, wer ihn gar berührte, wusch sich wochenlang nicht mehr die Hände.
Fünf Szenen aus der Geschichte Chinas. Fünf Szenen, die zeigen, wie radikal unterschiedlich die Erfahrungen der Chinesen in drei Jahrtausenden waren. Mehrfach sind die Chinesen sich im Laufe ihrer Geschichte selbst fremd geworden. Konfuzius kannte die Riten der Shang nicht mehr – und hätte er sie erlebt, er wäre entsetzt gewesen. Die Chinesen des 9. Jahrhunderts wiederum trennten Welten von der Kultur des Konfuzius: die Weisen der Alten seien seit 1000 Jahren in Vergessenheit geraten, hieß es, und selbst ihre Sprache war unverständlich geworden. Die Buchgelehrten der späten Kaiserzeit hinwieder hätten das zügellose Treiben der buddhistischen Prozession verteufelt; sie suchten ihr Heil in »konfuzianischen« Prüfungen – die Konfuzius selbst niemals bestanden hätte. Intellektuelle des 20. Jahrhunderts schließlich ziehen die gesamte alte Gesellschaft der »Menschenfresserei«, und die Roten Garden zogen aus, um alle alten Gewohnheiten mit Stumpf und Stiel auszurotten.
Warum dieser Hinweis? Dass Geschichte vom Wandel der Dinge handelt, ist eine Binsenweisheit. Geschichtsbewusstsein ist nichts anderes als die Einsicht in die grundlegende Unbeständigkeit aller Formen. Nur in China scheint das anders zu sein. Der alte Topos vom »ewigen China« wirkt noch immer in vielfacher Gestalt: die Lehren des Konfuzianismus und Daoismus, die rätselhafte Schrift, die listigen »Strategeme« und viele andere Merkmale der ›chinesischen Kultur‹ erscheinen uns in zeitenthobener Würde – als ob sie keine Geschichte hätten. Populäre Darstellungen – auch und gerade von Chinesen geschriebene – tragen zu dieser Verklärung bei, aber selbst gestandene Wissenschaftler heben auf Kontinuität und Beständigkeit der chinesischen Kultur ab.
Paradoxerweise scheint diese ahistorische Perspektive ein Effekt der Geschichtsschreibung selbst zu sein. Geschichtsschreibung – nicht nur die chinesische – hat die Funktion, die verstörende Unbeständigkeit der Welt zu kompensieren, indem sie Kontinuitäten konstruiert. Sie verkürzt teleskopisch, rückt disparate Ereignisse nachträglich zusammen und stiftet ihnen einen sinnvollen Zusammenhang. Dadurch verleiht sie ihrem Gegenstand eine Kohärenz, die ihm an sich nicht innewohnt, schärfer noch: dadurch bringt sie ihren Gegenstand allererst hervor.
Die chinesische Geschichtsschreibung vermittelt seit 2000 Jahren das Bild einer homogenen Hochkultur, die sich im Rahmen eines mächtigen Einheitsreichs entfaltet hat. Reichsgeschichten der Kaiserzeit erzählten, wie Herrscher im zyklischen Auf und Ab der Dynastien kamen und gingen, auch Grenzen sich hier und da verschoben – doch die Einheit der Tradition erschien unerschütterlich. Die Nationalgeschichten des 20. und 21. Jahrhunderts erzählen die Geschichte Chinas als Aufstieg des chinesischen Volkes und seiner Selbstfindung im Nationalstaat. 5000 Jahre soll diese Geschichte überspannen! Die Chinesen hätten schon im 3. Jahrtausend v. Chr. am Mittellauf des Gelben Flusses eigene Staaten – die »Drei Dynastien«: Xia, Shang, Zhou – gegründet und ihren Einfluss von dort aus in Auseinandersetzung mit »Minderheitenvölkern« sukzessive auf fast einen ganzen Kontinent ausgedehnt. So sei zusammengekommen, was zusammengehört, und die chinesische Nation zu dem geworden, was sie immer schon war.
Was aber ist der Grund für dieses monolithische Geschichtsbild? Warum das Beharren auf Einheit und Beständigkeit? Wenn Geschichte auf das Problem von Kontinuitätsbrüchen reagiert, indem sie Kontinuitäten beschreibt, so ist zu vermuten, dass sie dies umso nachdrücklicher tut, je gravierender das Problem ist. Mit anderen Worten, der Erzählung von Einheit und Kontinuität dürfte eine zutiefst prägende Erfahrung von Haltlosigkeit und Diskontinuität zugrunde liegen. Wenn Geschichte ihren Gegenstand selbst hervorbringt, so heißt das: nicht die nationale Geschichte mündete in den Nationalstaat, sondern erst Chinas Selbstverständnis als Nationalstaat erforderte eine Geschichte, die diese neugefundene Identität legitimierte.
›China‹ und die ›Chinesen‹ sind Geschöpfe der Geschichtsschreibung. Das chinesische Wort für China, Zhongguo, war ursprünglich ein Plural: es meinte die »Mittleren Staaten« der Nordchinesischen Ebene. Später wurde daraus ein Singular: das »Reich der Mitte«, Siedlungsgebiet der Chinesen. Im 17. bis 19. Jahrhundert nahm Zhongguo schließlich eine Bedeutung an, die weit über das chinesische Kernland hinausging und ein Vielvölkerreich bezeichnete. Damit erst wurde es plausibel, unterschiedliche ethnische, religiöse und regionale Gruppen, die sich zuvor als eigenständig definiert hatten, pauschal ›Chinesen‹ zu nennen. Am besten versteht man ›China‹ als Kollektivsingular, der eine Vielfalt von Verschiedenem in einem Begriff...
| Erscheint lt. Verlag | 13.10.2023 |
|---|---|
| Verlagsort | Ditzingen |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Regional- / Landesgeschichte |
| Naturwissenschaften ► Geowissenschaften ► Geografie / Kartografie | |
| Schlagworte | Belt and Road Initiative • China • China 18. Jahrhundert • China 20. Jahrhundert • China Kommunismus Geschichte China im 20. Jahrhundert • China Kultur Geschichte • China verstehen • Chinesische Geschichte • Covid-19 • Die Geschichte von China • Entstehung China • Geschichte Chinas • Geschichte Chinas Buch • Geschichte Chinas Kurzfassung • Geschichte China Taiwan • Geschichte der Volksrepublik China • Hongkong • Hu Xintao • Landesgeschichte • MAO • Ming-Dynastie • No-Covid-Strategie • Peking • Reclam Sachbuch premium • Seidenstraße • Shanghai • Tibet • Uiguren • Ursprung China • Volksrepublik • Xi Jinping |
| ISBN-10 | 3-15-960694-5 / 3159606945 |
| ISBN-13 | 978-3-15-960694-1 / 9783159606941 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 21,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich