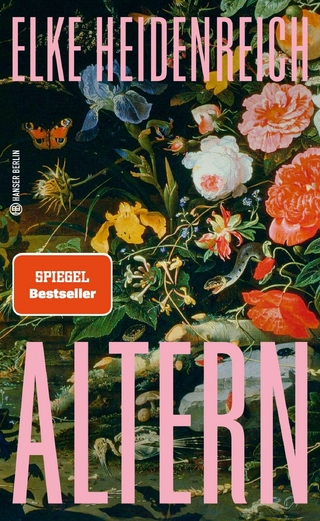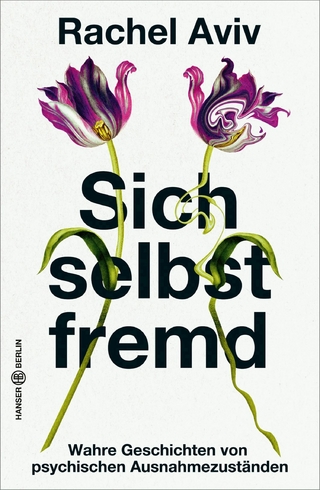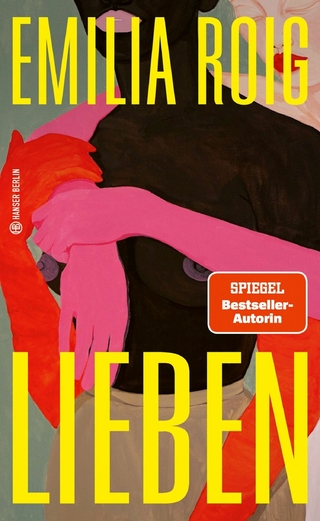Überlegungen zur Judenfrage (eBook)
288 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-644-01887-7 (ISBN)
Geboren am 21.06.1905, wuchs er nach dem frühen Tod seines Vaters im Jahre 1906 bis zur Wiederheirat seiner Mutter im Jahre 1917 bei seinen Großeltern Schweitzer in Paris auf. 1929, vor seiner Agrégation in Philosophie, lernte er seine Lebensgefährtin Simone de Beauvoir kennen, mit der er eine unkonventionelle Bindung einging, die für viele zu einem emanzipatorischen Vorbild wurde. 1931-1937 war er Gymnasiallehrer in Philosophie in Le Havre und Laon und 1937-1944 in Paris. 1933 Stipendiat des Institut Français in Berlin, wo er sich mit der Philosophie Husserls auseinandersetzte. Am 02.09.1939 wurde er eingezogen und geriet 1940 in deutsche Kriegsgefangenschaft, aus der er 1941 mit gefälschten Entlassungspapieren entkam. Noch 1943 wurde unter deutscher Besatzung sein erstes Theaterstück «Die Fliegen» aufgeführt; im selben Jahr erschien sein philosophisches Hauptwerk «Das Sein und das Nichts». Unmittelbar nach dem Krieg wurde Sartres Philosophie unter dem journalistischen Schlagwort «Existenzialismus»zu einem modischen Bezugspunkt der Revolte gegen bürgerliche Lebensformen. 1964 lehnte er die Annahme des Nobelpreises ab. Zahlreiche Reisen führten ihn in die USA, die UdSSR, nach China, Haiti, Kuba, Brasilien, Nordafrika, Schwarzafrika, Israel, Japan und in fast alle Länder Europas. Er traf sich mit Roosevelt, Chruschtschow, Mao Tse-tung, Castro, Che Guevara, Tito, Kubitschek, Nasser, Eschkol. Sartre starb am 15.4.1980 in Paris. Auszeichnungen: Prix du Roman populiste für «Le mur» (1940); Nobelpreis für Literatur (1964, abgelehnt); Ehrendoktor der Universität Jerusalem (1976).
Geboren am 21.06.1905, wuchs er nach dem frühen Tod seines Vaters im Jahre 1906 bis zur Wiederheirat seiner Mutter im Jahre 1917 bei seinen Großeltern Schweitzer in Paris auf. 1929, vor seiner Agrégation in Philosophie, lernte er seine Lebensgefährtin Simone de Beauvoir kennen, mit der er eine unkonventionelle Bindung einging, die für viele zu einem emanzipatorischen Vorbild wurde. 1931-1937 war er Gymnasiallehrer in Philosophie in Le Havre und Laon und 1937-1944 in Paris. 1933 Stipendiat des Institut Français in Berlin, wo er sich mit der Philosophie Husserls auseinandersetzte. Am 02.09.1939 wurde er eingezogen und geriet 1940 in deutsche Kriegsgefangenschaft, aus der er 1941 mit gefälschten Entlassungspapieren entkam. Noch 1943 wurde unter deutscher Besatzung sein erstes Theaterstück «Die Fliegen» aufgeführt; im selben Jahr erschien sein philosophisches Hauptwerk «Das Sein und das Nichts». Unmittelbar nach dem Krieg wurde Sartres Philosophie unter dem journalistischen Schlagwort «Existenzialismus»zu einem modischen Bezugspunkt der Revolte gegen bürgerliche Lebensformen. 1964 lehnte er die Annahme des Nobelpreises ab. Zahlreiche Reisen führten ihn in die USA, die UdSSR, nach China, Haiti, Kuba, Brasilien, Nordafrika, Schwarzafrika, Israel, Japan und in fast alle Länder Europas. Er traf sich mit Roosevelt, Chruschtschow, Mao Tse-tung, Castro, Che Guevara, Tito, Kubitschek, Nasser, Eschkol. Sartre starb am 15.4.1980 in Paris. Auszeichnungen: Prix du Roman populiste für «Le mur» (1940); Nobelpreis für Literatur (1964, abgelehnt); Ehrendoktor der Universität Jerusalem (1976).
III
Wir stimmen mit dem Antisemiten in einem Punkt überein: wir glauben nicht an die menschliche «Natur», wir lehnen es ab, die Gesellschaft als eine Summe isolierter oder isolierbarer Moleküle zu betrachten; wir glauben, die biologischen, psychischen und gesellschaftlichen Erscheinungen müssen synthetisch betrachtet werden. Wir kennen kein jüdisches «Prinzip», und wir sind keine Manichäer, wir lassen auch nicht gelten, daß der «wahre» Franzose so leicht aus der Erfahrung oder den Überlieferungen seiner Vorfahren Nutzen zieht, wir sind hinsichtlich der psychologischen Vererbbarkeit überaus skeptisch und sind nur dort bereit, ethnische Begriffe zu benutzen, wo sie experimentell bestätigt wurden, das heißt in der Biologie und in der Pathologie; für uns ist der Mensch vor allem als ein Sein «in Situation» definiert. Das heißt, er bildet ein synthetisches Ganzes mit seiner biologischen, ökonomischen, politischen, kulturellen usw. Situation. Man kann ihn nicht von ihr unterscheiden, denn sie formt ihn und entscheidet über seine Möglichkeiten, doch umgekehrt ist er es, der ihr ihren Sinn gibt, indem er sich in ihr und durch sie wählt. In Situation sein bedeutet unserer Ansicht nach sich in Situation wählen, und die Menschen unterscheiden sich untereinander so, wie ihre Situationen es untereinander tun und auch nach der Wahl ihrer eigenen Person. Gemeinsam ist ihnen allen nicht eine Natur, sondern eine conditio, das heißt eine Gesamtheit von Schranken und Zwängen: die Notwendigkeit, zu sterben, zu arbeiten, um zu leben, in einer Welt zu existieren, die bereits von anderen Menschen bewohnt ist. Und diese conditio ist im Grunde nichts anderes als die grundlegende menschliche Situation oder, wenn man will, die Gesamtheit der abstrakten Merkmale, die allen Situationen gemeinsam sind. Ich stimme also dem Demokraten zu, daß der Jude ein Mensch wie die anderen ist, doch das lehrt mich nichts Besonderes, außer daß er frei ist, daß er zugleich Sklave ist, daß er geboren wird, genießt, leidet und stirbt, daß er liebt und daß er haßt wie alle Menschen. Ich kann diesen zu allgemeinen Angaben nichts anderes entnehmen. Wenn ich wissen will, wer der Jude ist, muß ich, da er ein Wesen in Situation ist, zunächst seine Situation über ihn befragen. Ich schicke voraus, daß ich meine Beschreibung auf die Juden Frankreichs beschränken werde, denn unser Problem ist das des französischen Juden.
Ich leugne nicht, daß es eine jüdische Rasse gibt. Doch wir müssen uns recht verstehen. Wenn man unter Rasse diesen undefinierbaren Komplex versteht, in den man kunterbunt somatische Merkmale und intellektuelle wie moralische Wesenszüge hineinpackt, glaube ich daran nicht mehr als an das Tischrücken. Was ich mangels Besserem ethnische Merkmale nennen würde, sind bestimmte ererbte physische Formen, denen man bei Juden häufiger begegnet als bei Nichtjuden. Aber auch da muß man vorsichtig sein: man sollte lieber von jüdischen Rassen sprechen. Bekanntlich sind nicht alle Semiten Juden, was das Problem erschwert; es ist auch bekannt, daß manche blonden Juden aus Rußland von einem kraushaarigen algerischen Juden entfernter sind als von einem ostpreußischen Arier. In Wahrheit hat jedes Land seine Juden, und unsere Vorstellung vom Juden entspricht nicht der unserer Nachbarn. Als ich zu Beginn des Naziregimes in Berlin lebte, hatte ich zwei französische Freunde, einen Juden und einen Nichtjuden. Der Jude war ein «betont semitischer Typ»; er hatte eine gebogene Nase, abstehende Ohren, dicke Lippen. Ein Franzose hätte ihn, ohne zu zögern, als Juden erkannt. Da er jedoch blond, hager und phlegmatisch war, hatten die Deutschen davon keinen blauen Dunst; er machte sich einen Spaß daraus, manchmal mit SSLeuten auszugehen, die nichts von seiner Rasse ahnten, und einer von ihnen sagte ihm eines Tages: «Ich erkenne einen Juden auf hundert Meter Entfernung.» Mein anderer Freund dagegen, Korse und Katholik, Sohn und Enkel von Katholiken, hatte schwarzes, leicht krauses Haare, eine Bourbonennase, einen blassen Teint und war klein und dick: die Jungen bewarfen ihn auf der Straße mit Steinen und riefen ihm «Jude!» nach. Er entsprach eher einem bestimmten Typ orientalischer Juden, der in der Vorstellung der Deutschen verbreiteter ist. Wie dem auch sei, und sogar angenommen, alle Juden hätten bestimmte physische Züge gemein, kann man daraus nicht schließen, es sei denn mittels vagester Analogie, sie müßten auch dieselben Charakterzüge haben. Mehr noch: die physischen Merkmale, die man beim Semiten feststellen kann, sind räumlich, bestehen also nebeneinander und sind voneinander trennbar. Ich kann im nächsten Augenblick eines von ihnen vereinzelt bei einem Arier wiederfinden. Werde ich daraus schließen, daß dieser Arier auch jene psychische Eigenschaft hat, die man gewöhnlich Juden zuspricht? Natürlich nicht. Aber dann stürzt die ganze Rassentheorie in sich zusammen: sie setzt voraus, der Jude sei eine nichtzerlegbare Ganzheit, dabei macht man aus dieser ein Mosaik, bei der jedes Element ein Steinchen ist, das man herausnehmen und in eine andere Ganzheit einfügen kann; wir können weder vom Physischen auf das Moralische schließen noch einen psychophysiologischen Parallelismus postulieren. Wenn man sagt, die Gesamtheit der somatischen Merkmale müsse berücksichtigt werden, antworte ich: entweder ist diese Gesamtheit die Summe der ethnischen Züge, und diese Summe kann in keinem Fall das räumliche Äquivalent einer psychischen Synthese darstellen, nicht mehr als eine Gruppe von Gehirnzellen einem Gedanken entsprechen kann, oder man versteht, wenn man vom physischen Aussehen des Juden spricht, darunter eine synkretistische Totalität, die von der Anschauung erfaßt wird. In diesem Fall kann es tatsächlich eine Gestalt[6] im Sinne Köhlers geben, und eben das meinen die Antisemiten, wenn sie behaupten, «eine Nase» oder «einen siebenten Sinn» usw. für den Juden zu haben. Nur ist es unmöglich, somatische Elemente getrennt von sich mit ihnen vermengenden psychischen Bedeutungen wahrzunehmen. Da ist ein Jude, der in der Rue des Rosiers vor seiner Tür sitzt. Ich erkenne ihn sofort als Juden: er hat einen schwarzen, gekräuselten Bart, eine leicht gebogene Nase, abstehende Ohren, ein eisernes Brillengestell, eine bis zu den Augen heruntergezogene Melone, einen schwarzen Anzug, schnelle, nervöse Gesten und ein seltsam schmerzlich-gütiges Lächeln. Wie soll man das Physische vom Moralischen trennen? Sein Bart ist schwarz und gekräuselt: das ist ein somatisches Merkmal. Doch was mir besonders auffällt, ist, daß er ihn wachsen läßt; dadurch drückt er seine Bindung an die Traditionen der jüdischen Gemeinschaft aus, er gibt sich als jemanden zu erkennen, der aus Polen gekommen ist und einer ersten Generation von Einwanderern angehört; ist sein Sohn weniger Jude, weil er sich rasiert? Andere Züge, wie die Nasenform oder der Abstand der Ohren, sind rein anatomisch, wieder andere rein psychisch und sozial, wie die Wahl der Kleidung und der Brille, das Mienenspiel und die Gesten. Was kennzeichnet ihn für mich als Juden, wenn nicht diese unzerlegbare Gesamtheit, bei der das Psychische und das Physische, das Soziale, das Religiöse und das Individuelle sich gegenseitig durchdringen, wenn nicht diese lebende Synthese, die natürlich nicht durch Vererbung weitergegeben werden kann und die, im Grunde, identisch mit seiner gesamten Person ist? Wir betrachten also die somatischen und erblichen Züge des Juden als einen Faktor seiner Situation unter anderen, nicht als determinierende Bedingung seiner Natur.
Können wir den Juden, da wir ihn nicht durch seine Rasse determinieren, durch seine Religion oder eine rein jüdische nationale Gemeinschaft definieren ? Hier wird die Frage komplizierter. Gewiß gab es in fern zurückliegender Zeit eine religiöse und nationale Gemeinschaft, die man Israel nannte. Doch ist die Geschichte dieser Gemeinschaft die einer fünfundzwanzig Jahrhunderte währenden Auflösung. Sie verlor zuerst ihre Souveränität; es folgte die Babylonische Gefangenschaft, dann die Perserherrschaft, schließlich die römische Eroberung. Man darf darin nicht die Wirkung eines Fluches sehen, es sei denn, es gibt geographische Verfluchungen: die Lage Palästinas, Schnittpunkt aller antiken Handelswege, eingeklemmt zwischen mächtigen Reichen, genügt, diese langsame Enteignung zu erklären. Das religiöse Band zwischen den Juden der Diaspora und denen, die auf ihrem Boden geblieben waren, verstärkte sich: es nahm den Sinn und den Wert eines nationalen Bandes an. Aber diese «Übertragung» brachte, wie man sich denken kann, eine Vergeistigung der kollektiven Bindungen hervor, und Vergeistigung bedeutet trotz allem Schwächung. Wenig später kam übrigens die Spaltung durch das Christentum: das Auftauchen dieser neuen Religion bewirkte eine große Krise der jüdischen Welt, indem es die ausgewanderten Juden zu den Juden Judäas in einen scharfen Gegensatz brachte. Gegenüber der «starken Form», als die das Christentum von vornherein auftrat, erwies sich die hebräische Religion sofort als schwache, in Auflösung begriffene Form; sie hält sich nur durch eine komplexe Politik aus Zugeständnissen und Hartnäckigkeit. Sie widersteht den Verfolgungen und der großen Zerstreuung der Juden in der mittelalterlichen Welt; sie widersteht viel weniger den Fortschritten der Aufklärung und des kritischen Denkens. Die Juden unserer Umgebung haben zu ihrer Religion nur noch eine zeremonielle und Höflichkeitsbeziehung. Ich fragte einen von ihnen, warum er seinen Sohn habe beschneiden lassen. Er antwortete mir: «Weil es meiner Mutter...
| Erscheint lt. Verlag | 17.10.2023 |
|---|---|
| Übersetzer | Vincent von Wroblewsky |
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Essays / Feuilleton |
| Schlagworte | Antisemitismus • Essay • Frankreich • Juden • Les Temps modernes • Nationalsozialismus • Philosophie • Zweiter Weltkrieg |
| ISBN-10 | 3-644-01887-1 / 3644018871 |
| ISBN-13 | 978-3-644-01887-7 / 9783644018877 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 6,9 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich