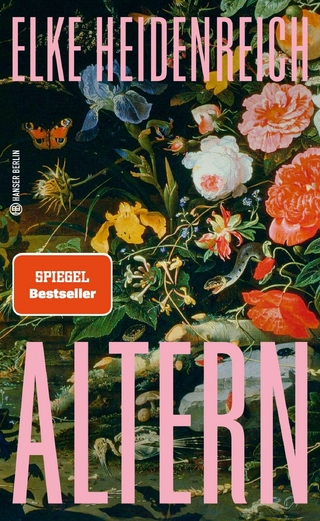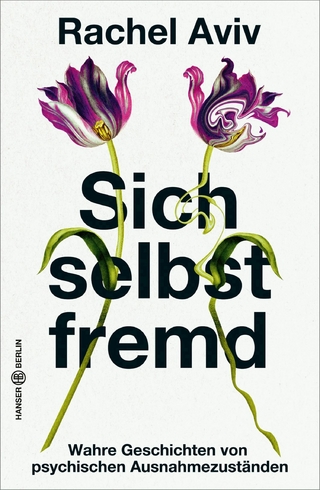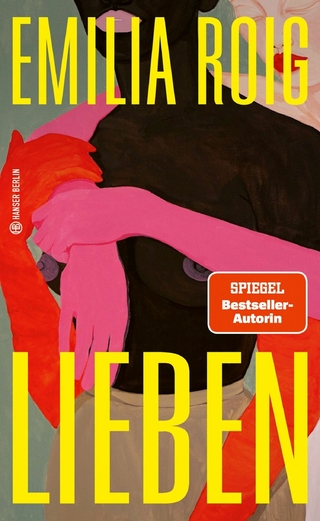Leben, Denken, Schauen (eBook)
496 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-644-00482-5 (ISBN)
Siri Hustvedt wurde 1955 in Northfield, Minnesota, geboren. Sie studierte Literatur an der Columbia University und promovierte mit einer Arbeit über Charles Dickens. Bislang hat sie sieben Romane publiziert. Mit «Was ich liebte» hatte sie ihren internationalen Durchbruch. Zuletzt erschienen «Die gleißende Welt» und «Damals». Zugleich ist sie eine profilierte Essayistin. Bei Rowohlt liegen von ihr die Essaybände «Nicht hier, nicht dort», «Leben, Denken, Schauen», «Being a Man», «Die Illusion der Gewissheit» und «Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen» vor.
Siri Hustvedt wurde 1955 in Northfield, Minnesota, geboren. Sie studierte Literatur an der Columbia University und promovierte mit einer Arbeit über Charles Dickens. Bislang hat sie sieben Romane publiziert. Mit «Was ich liebte» hatte sie ihren internationalen Durchbruch. Zuletzt erschienen «Die gleißende Welt» und «Damals». Zugleich ist sie eine profilierte Essayistin. Bei Rowohlt liegen von ihr die Essaybände «Nicht hier, nicht dort», «Leben, Denken, Schauen», «Being a Man», «Die Illusion der Gewissheit» und «Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen» vor. Uli Aumüller übersetzt u. a. Siri Hustvedt, Jeffrey Eugenides, Jean Paul Sartre, Albert Camus und Milan Kundera. Für ihre Übersetzungen erhielt sie den Paul-Celan-Preis und den Jane-Scatcherd-Preis. Erica Fischer wurde als Tochter von Emigranten in England geboren, die 1948 nach Wien zurückkehrten. Dort studierte sie Sprachen, wurde zu einer der Gründerinnen der österreichischen Frauenbewegung und arbeitete als Journalistin. Heute lebt Erica Fischer als freie Schriftstellerin und Übersetzerin in Berlin. Ihre dokumentarische Erzählung "Aimée & Jaguar" (1994) wurde ein Bestseller, sie ist mitlerweile in zwanzig Sprachen übersetzt. Zuletzt erschienen "Himmelstraße" (2007) und "Mein Erzengel" (2010).
Vorwort der Autorin
Beim nochmaligen Lesen der in diesem Band gesammelten Essays wurde mir klar, dass sie, obwohl sie eine ganze Reihe von Themen behandeln, durch die beständige Neugier, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, miteinander verbunden sind. Wie sehen, erinnern, fühlen wir, wie gehen wir mit anderen um? Was bedeutet es, zu schlafen, zu träumen und zu sprechen? Wovon sprechen wir, wenn wir das Wort selbst gebrauchen? Jedes Zeitalter hatte seine eigenen Platituden, Binsenwahrheiten, Volksweisheiten und Dogmen der unterschiedlichsten Art, die vorgaben, solche Fragen zu beantworten. Das unsere ist da nicht anders. Tatsächlich ertrinken wir in Antworten. Angefangen bei grob vereinfachenden Selbsthilfefibeln, die in jeder Buchhandlung angeboten werden, über den Reißen-Sie-sich-zusammen-Ratschlag von Talkshow-Therapeuten zu den komplexeren Argumenten der evolutionären Soziobiologie, der analytischen und europäischen Philosophie, der Psychiatrie und der Neurowissenschaften sind Theorien in unserer Kultur reichlich vorhanden. Es ist wichtig, trotz des Überangebots von Lösungen im Kopf zu behalten, dass, wer wir sind und wie wir so geworden sind, nicht nur in den Geisteswissenschaften offene Fragen bleiben, sondern auch in den Naturwissenschaften.
Über einen Zeitraum von sechs Jahren geschrieben, reflektieren diese Essays meinen Wunsch, Erkenntnisse aus vielen Disziplinen zu verwenden, und zwar einfach deshalb, weil ich zu der Überzeugung gelangt bin, dass kein einzelnes theoretisches Modell die Komplexität der menschlichen Realität erfassen kann. Einige Denker tauchen mehrfach auf: Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty, Martin Buber, Sigmund Freud, D.W. Winnicott, A.R. Lurija, Mary Douglas und Lev Vygotsky. Neurowissenschaftliche Forschungsergebnisse ziehen sich durch das ganze Buch, insbesondere aus Untersuchungen zur Wahrnehmung, Erinnerung, Emotion und zur Beziehung zwischen dem Selbst und dem Anderen.
Ich bekenne mich zum Gebrauch der Alltagssprache in meinen Aufsätzen. Esoterische Fachsprachen entstehen jedoch nicht, weil die Eingeweihten Snobs wären. Spezialisierte Sprachen machen bestimmte Gespräche möglich, weil die Sprechenden ihre Definitionen ausdifferenziert haben und sich dann austauschen und damit arbeiten können. Das Problem ist, dass der Kreis der Sprechenden in sich geschlossen und die Fachkenntnis auf dem einen Feld der auf einem anderen nicht zugänglich ist, ganz zu schweigen von Laien, die gar nichts verstehen. Ich glaube, dass ein echter Dialog zwischen den Disziplinen, jedenfalls bis zu einem gewissen Grad, möglich ist und dass unterschiedliche Diskurse durch eine transparente Darstellung von Ideen vereinheitlicht werden können. Gleichwohl muss redlicherweise darauf hingewiesen werden, dass diese Essays zuerst in einem breiten Spektrum von Printmedien veröffentlicht wurden, angefangen bei Literaturzeitschriften, wie Granta, Conjunctions, Salmagundi und The Yale Review, über Zeitungen und Magazine, wie den Londoner Guardian, die New York Times und den Nouvel Observateur, bis hin zu Fachzeitschriften, einschließlich der Contemporary Psychoanalysis und der referierten Neuropsychoanalysis. Daher haben einige der Aufsätze umfangreiche Anmerkungen, während andere ohne auskommen. Einige der Texte wurden ursprünglich als Vorträge gehalten. Der Essay über Morandi war für eine Vortragsreihe im Metropolitan Museum: Sunday Lectures at the Met. «Warum Goya?» wurde im Prado vorgetragen. «Mit dem Körper sehen: Was bedeutet es, ein Kunstwerk zu betrachten?» war die dritte Internationale Schelling-Vorlesung an der Akademie der Bildenden Künste München, und «Freuds Tummelplatz» wurde für die XXXVIII. jährlich stattfindende Sigmund-Freud-Vorlesung geschrieben, die ich im Mai 2011 in Wien hielt. In manchen Fällen konnte ich bei den Zuhörern bestimmte Kenntnisse voraussetzen, in anderen nicht. Gleichwohl ist jeder Text in diesem Band ein Essay – vom französischen Wort essayer, versuchen –, und alle sind in der ersten Person geschrieben.
Der persönliche Essay entstand im 16. Jahrhundert mit Montaigne; die Gattung wird auch heute noch oft und gern verwendet. Wie beim Roman ist seine Form elastisch und anpassungsfähig. Er macht Gebrauch von Geschichten wie von Argumenten. Er kann streng präzise vorgehen oder Abstecher auf überraschendes Terrain unternehmen. Seine Form wird ausschließlich von den Denkbewegungen des Schreibers bestimmt, und anders als in Beiträgen für wissenschaftliche Zeitschriften oder in Zeitungsartikeln ist die Ich-Perspektive nicht verpönt, sondern wird befürwortet. Für mich ist das mehr als eine Frage der Gattung. Mein Schreiben in der ersten Person stellt eine philosophische Position dar, der zufolge die Idee einer Dritte-Person-Objektivität bestenfalls eine Arbeitsfiktion ist. «Objektives» Forschen und Schreiben in der dritten Person ist das Resultat eines kollektiven Konsenses – eine Übereinkunft über die Methode sowie gemeinsame Grundannahmen dazu, wie die Welt funktioniert –, sei es in den Neurowissenschaften oder im Journalismus. Niemand kann seiner Subjektivität wirklich entgehen. Da ist immer ein Ich oder ein Wir, das sich irgendwo im Text verbirgt, selbst wenn es als Pronomen nicht in Erscheinung tritt.
Doch wer ist das Ich auf dem Papier? Warum gebrauche ich es? Einige der Essays in diesem Buch sind anekdotisch, handeln ausdrücklich von meinem eigenen Erleben; andere vertreten Argumente, die ich ohne weiteres herausarbeiten könnte, ohne selbst in den Text einzugehen. Ich will mich aber selbst einbringen. Ich will mich nicht hinter den Konventionen eines akademischen Beitrags verstecken, weil der Rückgriff auf meine subjektive Erfahrung die Probleme, die ich zu klären hoffe, erhellen kann und, denke ich, erhellen wird. In einer Zeit der Lebensbeichten ist es vielleicht nicht überraschend, dass es Leser gibt, die, immer wenn sie ein in der ersten Person geschriebenes Sachbuch aufschlagen, einen Strom von intimem Stoff erwarten. Ich fürchte, das ist mir charakterlich fremd. Meine Essays sind eine Form von geistigen Reisen, von einem Zugehen auf Antworten, wobei ich mir intensiv dessen bewusst bin, dass ich nie ans Ende der Straße gelangen werde. Ich benutze meine eigenen Erfahrungen auf dieselbe Art, wie ich die Erfahrungen anderer benutze – als Einblicke, um eine Idee weiterzuentwickeln. In den folgenden Essays komme ich als Person vor und nicht vor. Meine Präsenz beziehungsweise meine Abwesenheit hängen davon ab, womit ich mich jeweils auseinandersetze.
Eine derartige Herangehensweise ist nichts Neues. In den Bekenntnissen des Augustinus bringen wir viel über ihn in Erfahrung, doch was er uns über die quälenden Kämpfe erzählt, die er mit sich selbst führt, ist nie überflüssig. Es veranschaulicht eine tiefgehende philosophische Erkundung, mit der der Leser zu seinem eigenen spirituellen Erwachen gebracht werden soll. Ein modernes und viel zurückhaltenderes Beispiel des Selbst als Vehikel für Ideen findet sich in Freuds Traumdeutung. Bei der Analyse seiner eigenen Träume offenbart der Neurologe genug von sich selbst, um mit seinen Argumenten durchzudringen und den Leser von seiner neuen Theorie über Schlaf und Träume zu überzeugen. Zugegebenermaßen Geistesgrößen, sind diese zwei Autoren dennoch exemplarisch.
1986 habe ich an der Columbia University in Anglistik promoviert, aber ich wurde nicht Professorin. Ich hatte die Freiheit, meine Ausbildung so weiterzuführen, wie ich es für angebracht hielt, und ich schätze mich glücklich, dass ich mich in meinem Fach nicht «auf dem Laufenden halten» muss. Weil mein Schreiben selbstbestimmt ist, konnte ich zahllose Stunden mit dem Studium von neurowissenschaftlichen Veröffentlichungen, von Ästhetik, Psychoanalyse, Medizingeschichte und Philosophie verbringen, neben weiteren Fächern, die mich interessieren. Ich war in vielen Vorlesungen und auf vielen Kongressen und habe in den letzten Jahren auch selbst Vorlesungen gehalten und auf Kongressen gesprochen. Es besteht kein Zweifel, dass ich eine Außenseiterin, eine nicht zugehörige intellektuelle Vagabundin bin, die, ihrer Nase folgend, plötzlich auf unerwartetem Terrain gelandet ist und über Landschaften blickt, von denen sie sehr wenig wusste, ehe sie vor Ort ankam. Diese geistigen Reisen waren eine Freude für mich, genauso wie meine Begegnungen mit den Bewohnern dieser einst fremden Welten, den Wissenschaftlern, Ärzten und Denkern unterschiedlicher Art, die ich bei meinen Abenteuern getroffen habe.
Das Buch ist in drei Teile gegliedert: Leben, Denken, Schauen. Wie alle Kategorien dieser Welt sind sie nicht absolut, aber sie sind auch nicht willkürlich gewählt. Es wäre zum Beispiel schwierig, viel zu denken oder zu schauen, wenn wir nicht lebten. Trotzdem habe ich «Leben» für die persönlichsten Essays gewählt, diejenigen, die auf die eine oder andere Weise unmittelbar aus meinem Leben hervorgegangen sind. Die Texte im Teil «Denken» dagegen waren alle von einem intellektuellen Rätsel angetrieben. Worin besteht der Unterschied zwischen dem Schreiben von erzählender Literatur und dem Schreiben von Lebenserinnerungen? Welche Rolle spielt Erinnerung für die Phantasie? Sind sie ein und dieselbe Fähigkeit oder zwei verschiedene? Wie können wir gestalten, was zwischen einer Person und einer anderen vor sich geht? Erschaffen zwei Personen zwischen sich eine dritte Realität? Die Essays im Teil «Schauen» handeln alle von Kunst und Künstlern. Ich schreibe seit nahezu zwanzig Jahren über Bildende...
| Erscheint lt. Verlag | 18.4.2023 |
|---|---|
| Übersetzer | Uli Aumüller, Erica Fischer |
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Essays / Feuilleton |
| Schlagworte | Die zitternde Frau • Grundfragen • Kunsttheorie • Literarische Essays • Literatur • Philosophie • Psychoanalyse • Sommer ohne Männer • US-Literatur |
| ISBN-10 | 3-644-00482-X / 364400482X |
| ISBN-13 | 978-3-644-00482-5 / 9783644004825 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 7,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich