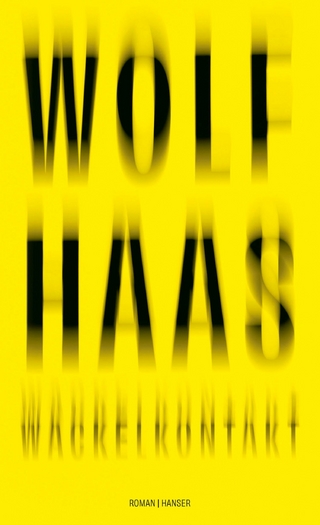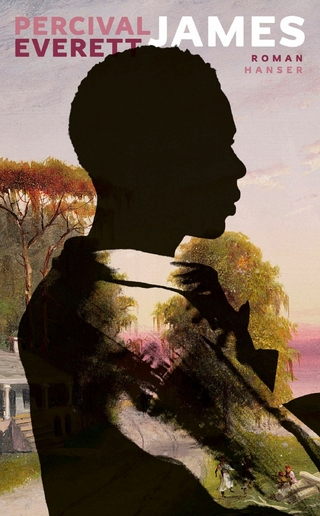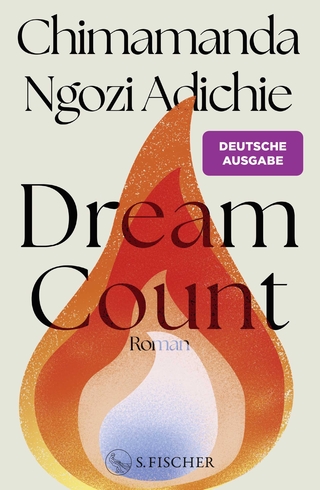Gespräch über die Trauer (eBook)
304 Seiten
S. Fischer Verlag GmbH
978-3-10-491760-3 (ISBN)
Olga Martynova, geboren 1962 in Sibirien, aufgewachsen in Leningrad, wo sie in den 1980er-Jahren die Dichtergruppe »Kamera Chranenia« mitbegründete. 1991 zog sie zusammen mit Oleg Jurjew (1959-2018) nach Deutschland. Von 1999 an schrieb sie literarische Texte auf Russisch und Deutsch. Seit 2018 schreibt sie nur noch in deutscher Sprache. Olga Martynova ist Vizepräsidentin der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, außerdem Mitglied des PEN und der Akademie der Wissenschaften und der Literatur (Mainz). Sie erhielt u. a. den Ingeborg-Bachmann-Preis (2012) und den Berliner Literaturpreis (2015). Zuletzt erschienen von ihr bei S. FISCHER: »Der Engelherd« (Roman, 2016), »Über die Dummheit der Stunde« (Essays, 2018) und »Gespräch über die Trauer« (2023). Für den Gedichtband »Such nach dem Namen des Windes« (2024) wurde Olga Martynova mit dem Peter-Huchel-Preis 2025 ausgezeichnet.
Olga Martynova, geboren 1962 in Sibirien, aufgewachsen in Leningrad, wo sie in den 1980er-Jahren die Dichtergruppe »Kamera Chranenia« mitbegründete. 1991 zog sie zusammen mit Oleg Jurjew (1959–2018) nach Deutschland. Von 1999 an schrieb sie literarische Texte auf Russisch und Deutsch. Seit 2018 schreibt sie nur noch in deutscher Sprache. Olga Martynova ist Vizepräsidentin der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, außerdem Mitglied des PEN und der Akademie der Wissenschaften und der Literatur (Mainz). Sie erhielt u. a. den Ingeborg-Bachmann-Preis (2012) und den Berliner Literaturpreis (2015). Zuletzt erschienen von ihr bei S. FISCHER: »Der Engelherd« (Roman, 2016), »Über die Dummheit der Stunde« (Essays, 2018) und »Gespräch über die Trauer« (2023). Für den Gedichtband »Such nach dem Namen des Windes« (2024) wurde Olga Martynova mit dem Peter-Huchel-Preis 2025 ausgezeichnet.
Ein Buch voller Poesie [...] berührend mal mehr auf stark schmerzhafte, mal mehr auf tröstliche Weise.
Martynova ist eine genaue Beobachterin noch der kleinsten Regungen im eigenen Innern - aber auch des Verhaltens der sie umgebenden Menschen.
Olga Martynova hat der nicht gerade kleinen Bibliothek der Trauerliteratur ein gewichtiges Buch hinzugefügt.
[...] ganz und gar authentisch [...].
Zu den großen Stärken der Erzählerin und Lyrikerin Olga Martynova gehört seit Jahren, dass sie das Schwere leicht werden lässt, ohne es zu vereinfachen.
[...] ein großartiges Buch [...].
[...] wirken Martynovas Gedichte leicht, spielerisch und elegant.
[...] viele[] bemerkenswerte[] Sätze.
Olga Martynova hat ein tiefgründiges, sensibles und reich nuanciertes Buch über Trauer vorgelegt [...].
Man liest Olga Martynovas Buch mit Anteilnahme, Respekt und Gewinn [...].
Beim Versuch, Klarheit zu erlangen, wird auch die Sprache klar. Das macht das «Gespräch über die Trauer» zu einem hoch philosophischen, eben gerade nicht privatistischen Buch.
6. November
Einer der wenigen Gedanken, dem etwas Kraft abzugewinnen ist: Das ist ganz normal, dass es mir schlecht geht.
10. November 2018–2022
Sprachverlust
Neapel.
Die neapolitanischen Gassen sind auf den ersten Blick ein Wirrwarr, auf den zweiten sind sie eine mit Farben und Tönen übersättigte Ordnung. Ich kaufe mir eine Babà, das mit Rum oder Madeira getränkte Hefegebäck, das wir als Kinder in Leningrad unter dem Namen »ромовая баба« oder »ромбаба« (Rum-Babà) in jedem Brotladen kaufen konnten. Mitten in der Mangelwirtschaft gab es Einsprengsel von ehemaligem Luxus, die im Laufe aller sowjetischen Jahrzehnte nicht vollständig ausgerottet worden waren. An »ромовая баба« dachten wir bei späteren Begegnungen mit der Babà in Frankreich oder Italien. Der chaotische Stoff der Welt wird durch solche Muster zusammengehalten.
Ich sehe diese Muster jetzt vielleicht noch deutlicher, aber:
In dem Roman »Die Erben« von William Golding bleibt am Ende ein Neandertaler als Letzter seiner Gattung übrig. Er hat keinen mehr, der seine Sprache spräche, und wird zu einer unbestimmten Kreatur, stumm, seine Sprache ist tot geworden. Ohne Oleg bin ich wie jener Neandertaler. Ein ungefähres Wesen mit einer Babà in der Hand, die keine Bedeutung mehr hat.
In einem Gedicht von Jelena Schwarz schreit ein solch ungefähres Wesen die Sprachfetzen vor sich hin – ein schiffbrüchiger Papagei auf einem Brett:
[…]
Er singt ein Lied über eine Mulattin, oder
Schreit plötzlich mit ganzer Kraft
Ganz oben auf der Woge, auf dem Wellenkamm –
Dass das Vögelchen, das arme, Wodka will.
Und er schaut mit so viel Stolz
Auf dieses gekräuselte Tal.
Wie sehr berührt im Herzen
Die Hochmut hilfloser, schwacher Wesen.
[…]
Er murmelt nickend:
Da stimm ich zu, jedoch …
Allerdings … wohl kaum … außer …
Ausnehmend … und außerdem …
[…]
Er schielt mit schläfrigem Auge,
Um das Meer auszutricksen.
God damn! … In einem gewissen
Maße, und strenggenommen …
[…]
Via Wi-Fi ins Nichts. Eine Freude mit jemandem zu teilen, für den diese Freude in keiner Weise mehr von Bedeutung ist. In Neapel fühlt sich das weniger absurd an als anderswo. Neapel meint es mit Toten und Trauernden gut. Es spielt seine sinnliche Fülle nicht gegen den Tod aus. Verkaufsstände mit Babàs, Weihnachtskrippen, Spaghettidosierern (ein schmales Brettchen mit drei Löchern von verschiedenen Durchmessern); Innenhöfe mit Springbrunnen und blühenden Zitronen; Menschen, die Kaffee trinken im Gehen oder mit Mobiltelefonen aus ihren Fenstern hängen, weil Wände aus dem porösen neapolitanischen Tuff den Empfang verhindern; und natürlich Motorroller – all das birst vom Leben und grenzt an die Totenwelt, die hier nicht verdrängt wird.
Die Ähnlichkeit, wenn nicht gar Verwandtschaft, von Petersburg und Neapel liegt nicht auf der Hand. Beide Städte scheinen das Gegenteil voneinander zu sein. Neapel ist südlich offen und durchlässig. Nicht nur Walter Benjamin vergleicht es mit einem afrikanischen Dorf, wo innen und außen nahtlos ineinander übergehen würden. Dagegen ist Petersburg nördlich zugeknöpft. Was Neapel in seiner theatralischen Natur zur Schau stellt, muss man in Petersburg noch erraten. Dabei ist Petersburg ebenso theatralisch, nur äußert sich seine Theatralik in den kalten klassizistischen und eitlen barocken Fassaden, hinter denen seine groteske Welt versteckt ist. Dieses Versteckte, die Bresche ins Jenseits brachte den Philosophen Wladimir Toporow auf den genialen Begriff »Petersburger Text«: Als würden Dichter an einem gemeinsamen grotesken Kunstwerk arbeiten. Der treue Begleiter des Petersburger Textes ist der Tod.
Als würde ich Neapel nicht zum ersten Mal begegnen, sondern mich an es erinnern.
Den neapolitanischen Totenkult hat die katholische Kirche Ende der 1960er Jahre verboten. Es ist zu bezweifeln, dass solche Verbote befolgt werden. Hier sieht es nicht danach aus.
Die Kirche Santa Maria delle Anime del Purgatorio ist laut Reiseführer der Haupttempel des Totenkultes (später werde ich lernen, dass solche Stätten über die ganze Stadt verstreut sind). Hier: Glanzlichter auf den bronzenen Schädeln beidseitig der Vortreppe und barocker Glanz drinnen. Um in die Unterkirche hinabzusteigen, zahlt man Eintritt: Als wäre das bloß ein Museum des gewesenen Kultes. Unten keine Pracht mehr, kahle Steinwände und nicht mehr bronzene, sondern wirkliche Schädel und Knochen, geordnet in Kästchen, ausgeziert mit Blumen, Bändchen, Spitzen, Broschen, Rosenkränzen, Bildchen. Man wird beobachtet. Nicht von den Toten (oder sie machen das diskret), sondern von den Frauen, die oben Tickets verkaufen, der ganze untere Raum ist mit Überwachungskameras versehen, selbst die hinterste Krypta, und kaum holt man das Mobiltelefon zum Fotografieren heraus, mahnt der Lautsprecher, das zu unterlassen. An einer Wand leuchtet die Zahl 16753. Wieder oben, frage ich nach deren Bedeutung und erfahre, dass das eine Kunstinstallation ist: So viele Flüchtlinge sind in den letzten fünf Jahren unterwegs zu uns ertrunken. Man kann sich kaum ein Kunstwerk vorstellen, das zum neapolitanischen Totenkult besser passen würde.
Wenn die Toten einen ordentlichen Abschied nicht nur brauchen, damit wir hier Menschen bleiben, sondern weil die Seelen der Unbeweinten sonst keinen sicheren Weg durchs Fegefeuer finden würden – was für eine Verwirrung muss im Jenseits herrschen, wenn nach Seuchen, Hungersnöten, Kriegen, Erdbeben und Vulkanausbrüchen Gebeine zusammengeschart oder gar verschollen bleiben. Nicht nur in Neapel, immer und überall sind wir auch im Tod nicht alle gleich, und in Zeiten der Not reicht der Platz nicht für alle Leichen. Neapel allerdings erklärt alle verwahrlosten Knochen zu Reliquien. Man »adoptiert« herrenlose Gebeine und betet für die Seelen, die dazu gehör(t)en, damit sie das Fegefeuer glimpflich passieren und im Gegenzug zu himmlischen Patronen ihrer Fürsorger werden. Eine anonyme Seele von Neapel bekommt die Illusion, für jemanden (die Person, die ihre sterblichen Überreste, den Schädel pflegt) der wichtigste Tote zu sein. Schafft sie es, daran zu glauben? Im Idealfall würden alle Gebeine ihre letzte Ruhe finden und alle Seelen bekämen ihr Geleit. Erlösung für alle! Genauso utopisch wie Champagner für alle.
Die Tuffhöhlen des Friedhofs Fontanelle in dem aus den Filmen des italienischen Neorealismus bekannten Viertel Sanità. Dass der neapolitanische poröse Tuff die Mobilfunksignale nicht durchlässt, heißt noch nicht, dass das auch für die Seelen und Gebete gilt. Sie gleiten auf und ab und hängen an den Sonnenstrahlen, die aus den Rissen oben kommen und silberne staubige Luft durchschießen. Die Gewölbe sind verstörend hoch, seltsam hell, bieten viel (Schau-)Platz für Gebeine. Schädel in den Puppenhäuschen. Knochenstapel in Fächern und Nischen wie weiland bei einer tüchtigen Hausfrau die Einweckgläser mit Marmelade und eingelegtem Gemüse.
»Die Wahl eines Schädels wird nicht leichtgenommen: die Leute gehen bedächtig auf die Suche, von einem Sarg zum anderen, während ihr Blick die traurigen Überreste mustert. Jäh bleiben sie stehen und beugen sich vor, um einen Schädel zu ergreifen, auf dem sie noch keinen Namen entdecken.
Sie betrachten ihn von allen Seiten, prüfen Konsistenz und Resonanz, indem sie ihn immer weiter herumdrehen und abklopfen […]. Ein an einer Mütze erkenntlicher Aufseher, der durch die Gänge schlendert, dient manchmal als Ratgeber und sogar als Lieferant. Ich hörte, wie ein Herr in Schwarz ihn fragte, ob er keinen Damenschädel zu finden wüsste. ›Keiner frei!‹ erwiderte er. ›Aber wir erwarten morgen eine Sendung Skelette, und dann werde ich wohl das Gewünschte für Sie haben.‹ Er half einer Frau bei der Wahl, doch das begleitende kleine Mädchen protestierte: ›Mama, nimm nicht diesen Schädel, ich will einen mit Zähnen haben.‹ Kinderschädel sind nicht aufzutreiben. ›Alle fragen danach‹, sagte der Aufseher zu mir.« (Roger Peyrefitte, »Vom Vesuv zum Ätna«.)
Roger Peyrefitte war hier 1952, als der Totenkult noch nicht verboten war. Warum hat die katholische Kirche ihn untersagt? Weil er an Heidentum erinnert? Aber was erinnert an den christlichen Bräuchen nicht daran? Oder teilt die Kirche die Abneigung gegen die Toten, die die...
| Erscheint lt. Verlag | 26.7.2023 |
|---|---|
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | Abschied • Anspruchsvolle Literatur • Ehe • Ein Buch von S. Fischer • Elisabeth Kübler-Ross • erinnerung an verstorbene • Essay • Kummer • Reise • Russland • Sterben • Tod • Trauer • Trauerbewältigung • Ukraine-Krieg • Witwe |
| ISBN-10 | 3-10-491760-4 / 3104917604 |
| ISBN-13 | 978-3-10-491760-3 / 9783104917603 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 6,6 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich