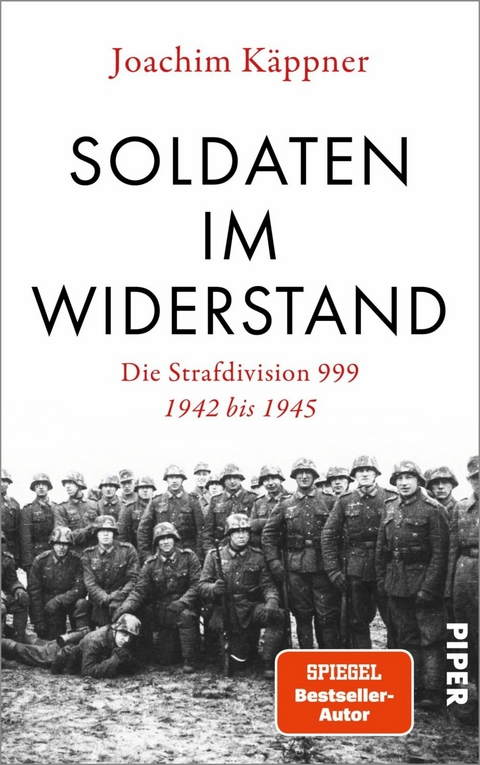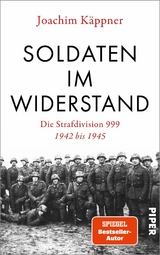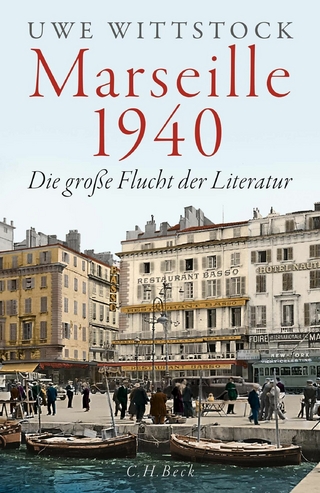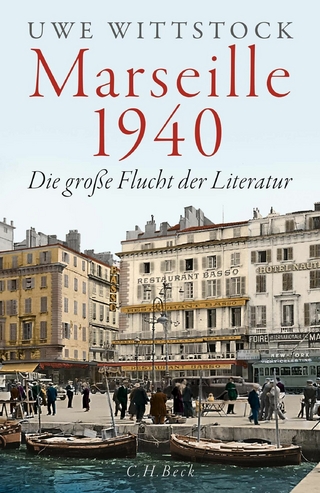Soldaten im Widerstand (eBook)
416 Seiten
Piper Verlag
978-3-492-60079-8 (ISBN)
Joachim Käppner ist Redakteur und Autor bei der Süddeutschen Zeitung. Der promovierte Historiker veröffentlichte u.a. »Erstarrte Erinnerung. Der Holocaust im Spiegel der DDR-Geschichtswissenschaft« (1999) und ist Herausgeber und Mitautor von »Die letzten 50 Tage: 1945 - als der Krieg zu Ende ging« (2005) und »Befreit, besetzt, geteilt. Deutschland 1945-1949« (2006). Im Berlin Verlag erschienen von ihm »Die Familie der Generäle. Eine deutsche Geschichte« (2007) und »Berthold Beitz« (2010). Joachim Käppner lebt in München.
Joachim Käppner ist Redakteur und Autor bei der Süddeutschen Zeitung. Der promovierte Historiker veröffentlichte u.a. »Erstarrte Erinnerung. Der Holocaust im Spiegel der DDR-Geschichtswissenschaft« (1999) und ist Herausgeber und Mitautor von »Die letzten 50 Tage: 1945 – als der Krieg zu Ende ging« (2005) und »Befreit, besetzt, geteilt. Deutschland 1945–1949« (2006). Im Berlin Verlag erschienen von ihm »Die Familie der Generäle. Eine deutsche Geschichte« (2007) und »Berthold Beitz« (2010). Bei Piper erschein von ihm zuletzt »1918 - Aufstand für die Freiheit«. Joachim Käppner lebt in München.
Vorwort
Ich weiß nicht, wie ich aus diesem Krieg kommen werde. Es wäre zu irrsinnig, wenn ich für den Wahnsinn Hitlers sterben müsste. Es müssen Menschen übrig bleiben, die … gegen das Furchtbare, das mit dem Namen Hitler über die Welt kam, kämpften. Die vor 1933 warnten und aufrüttelten. Die es nach 1933 illegal fortsetzten. Wenn auch mit der Hilflosigkeit von Zwergen, die vor einen rollenden Panzer Kieselsteine werfen, um ihn aufzuhalten. Die trotzdem nicht aufhörten mit den Kieselsteinen …[1]
Das schrieb ein heute fast vergessener Schriftsteller, Emil Rudolf (»Erge«) Greulich, im April 1943; er hatte gerade um Haaresbreite einen Angriff britischer Jagdflugzeuge auf die Transportmaschine überlebt, die ihn und seine Kameraden an die Tunesienfront bringen sollte. All diese nicht mehr ganz jungen Männer an Bord trugen die Uniform der deutschen Wehrmacht. Und sie alle hatten nicht freiwillig in dem Flugzeug gesessen, wie sie auch höchst unfreiwillig zu den Soldaten gekommen waren. Ihre Truppe, die 1942 gegründete Strafdivision 999, bestand zu erheblichen Teilen aus Widerstandskämpfern gegen den Nationalsozialismus: Kommunisten und Sozialdemokraten vor allem, aber auch unabhängige Sozialisten, tiefreligiöse Ernste Bibelforscher und bürgerliche Nonkonformisten. Sie hatten Jahre in den Zuchthäusern und Konzentrationslagern der Nazis abgesessen oder waren gar direkt von dort eingezogen worden.
Die NS-Diktatur hatte ihre eigenen Todfeinde bewaffnet.
Und welch eine Geschichte das ist: Auf diese Weise wurden Tausende von Widerstandskämpfern zu Soldaten des Terrorsystems, dessen Uniform sie trugen. Bis heute sind das Schicksal dieser Strafsoldaten, ihr Mut und ihr Eintreten gegen den Zivilisationsbruch der Naziherrschaft erstaunlich wenig bekannt. Diese Menschen und ihr Kampf gegen die Tyrannei und für die Freiheit, den viele von ihnen noch in Uniform wo immer möglich fortsetzten, sind das Thema dieses Buches.
In der Strafdivision 999 mussten insgesamt etwa 28 000 Männer dienen. Als Sträflinge hatten sie jahrelang als »Wehrunwürdige« gegolten, für nicht wert betrachtet, in der Wehrmacht zu dienen, wie ihnen ein amtlicher blauer Schein bestätigte. 1942 aber, als der Krieg, den Deutschland über die Welt gebracht hatte, tatsächlich zum Weltkrieg geworden war, Hunderttausende gefallen waren und den deutschen Armeen immer mehr Soldaten fehlten, berief sie sogar jene Männer, die sie zuvor gar nicht hatte haben wollen, in eine eilig geschaffene Strafdivision ein. Gut ein Drittel dieser Soldaten hatten als »Politische« Widerstand gegen das Regime gewagt.
Zu den »999ern« gehört hatten ein Vizekanzler der Bundesrepublik (Egon Franke, SPD), ein von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem als »Gerechter unter den Völkern« ausgezeichneter Retter von verfolgten Juden (Michael »Mike« Jovy) sowie der von seinem Schüler Jürgen Habermas als »Partisanenprofessor« verehrte Philosoph und Mitbegründer der »Marburger Schule« Wolfgang Abendroth. In der DDR gab es etliche Funktionsträger aus Politik und Kultur, die in der Strafdivision gedient hatten: unter ihnen Emil Rudolf Greulich, der Volksmarine-Admiral Erwin Bartz und, als wohl Bekanntester, Karl-Eduard von Schnitzler, jahrzehntelang Moderator der SED-Propagandasendung »Der Schwarze Kanal«.
Und da waren, in beiden Teilen Deutschlands, so viele andere, deren Namen lange vergessen sind; auch deshalb, weil jenseits der Militäropposition des 20. Juli 1944 und ähnlicher Kreise Resistenz und Widerstand einfacher Soldaten jahrzehntelang ein Tabuthema gewesen sind. So lange bestimmte der Mythos von der »sauberen Wehrmacht« als Lebenslüge von nicht unerheblichen Teilen der Kriegsteilnehmer das öffentliche Bewusstsein in der Bundesrepublik, dass das Verhalten von Deserteuren, Fahnenflüchtigen und ähnlichen Verweigerern, die nicht im Vernichtungskrieg hatten kämpfen wollen, »als Zeichen von Angst, Feigheit und Verrat gewertet wurde«, so der Zeithistoriker Wolfgang Benz.[2] Und Ähnliches galt für die früheren Strafsoldaten, sofern man überhaupt etwas über sie wusste.
Leider muss man es so hart sagen wie die Historiker Norbert Haase und Gerhard Paul, welche 1995, fünf Jahrzehnte nach Kriegsende, über die Opfer der Nazimilitärjustiz schrieben:
Im Traditionsbild deutscher Volkstrauertage, in den unzähligen Regimentsgeschichten der Kriegervereine haben jene, die sich auf die ein oder andere Weise dem Kriegsdienst in den nationalsozialistischen Angriffskriegen entzogen und dafür verfolgt wurden, keinen Platz. Die deutsche Gesellschaft hat in den zurückliegenden Jahrzehnten den Deserteuren, Verweigerern und »Zersetzern« Respekt und Anerkennung versagt.[3]
Dabei hätte die Bundesrepublik stolz auf sie sein können – zumindest dem eigenen Anspruch nach. In scharfer theoretischer Abgrenzung zur Wehrmacht gab die Bundeswehr zwar das Leitbild des Staatsbürgers in Uniform aus. Doch jene, die noch als Hitlers Zwangssoldaten im Herzen verantwortungsbewusste Staatsbürger geblieben waren, werden bis heute kaum gewürdigt. Fast während der gesamten vier Jahrzehnte der deutschen Teilung diente die Erinnerung an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus auch dazu, den jeweiligen deutschen Staat historisch zu legitimieren. Unweigerlich führte dies hier wie dort zu einer Verengung des Widerstandsbildes auf jene Gruppen, die sich am besten dafür eigneten: im Osten natürlich auf die Kommunisten, in der Bundesrepublik lange Zeit auf die Weiße Rose, den mit Namen wie August Graf Galen und Dietrich Bonhoeffer verbundenen kirchlichen Widerstand und die Männer des 20. Juli 1944, also bürgerliche Jugend, christliche Identität und das Militär – was die neue Bundeswehr nicht im Geringsten daran hinderte, ihre Kasernen sehr lange Zeit lieber nach Hitlers Heerführern und Ritterkreuzträgern zu benennen.
Freilich musste auch in der DDR ein früherer 999er wie Emil Rudolf Greulich erfahren, dass wirklichkeitsnahe Sichtweisen nicht erwünscht waren. Sein so anschaulicher wie weltanschaulich nüchterner Erlebnisbericht von 1949 (Zum Heldentod begnadigt) durfte in der DDR nach 1949 kein zweites Mal erscheinen. Es ist zu befürchten, dass genau dies für einen lebenslang Überzeugten wie Emil Rudolf Greulich, der so viel erlebt und erlitten hatte, die schlimmste Strafe von allen war. Aber das ist auch der Grund, warum er eine der Hauptfiguren dieses Buches ist.
Entzog sich also die Geschichte der 999er solchen Kategorien des Kalten Krieges, so waren die Leidtragenden oft die früheren Zwangssoldaten selbst. Johannes Tuchel, der Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Berliner Benderblock, überliefert ein typisches Beispiel: Ein Berliner Sozialdemokrat, nach 1933 von den Nazis über Jahre im Zuchthaus eingekerkert, wurde von ihnen zum Dienst in der Strafdivision gezwungen. 1946 trat er in die SED ein, weil er hoffte, der Zusammenschluss der so lange feindlichen Schwesterparteien SPD und KPD sei Deutschlands Rettung und Zukunft, so wie Kommunisten und Sozialdemokraten bei den 999ern oftmals Kampf- und Leidensgefährten waren oder zumindest sein mussten. Durch die brutale kommunistische Machtpolitik in der späten Stalin-Ära verlor der Mann seine Illusionen, er wendete sich ab und wurde schließlich als unbotmäßig und verdächtig aus der SED ausgeschlossen. Der Westen machte es nicht besser. 1955 erkannten ihm auch die Behörden der Bundesrepublik seinen Status – und damit seine Rente – als politisch Verfolgter ab, »weil Sie als Anhänger eines totalitären Regimes betrachtet werden müssen«. Das war der Dank des Sozialismus im Osten und der jungen parlamentarischen Demokratie im Westen an einen Menschen, der sein Leben für die Freiheit riskiert hatte.[4]
So sind die historische Rezeption und der Forschungsstand über die 999er sehr überschaubar. Zwar hinterließen nicht wenige Strafsoldaten Briefe oder, so weit sie heimkehrten, mitunter Berichte ihrer Erlebnisse. Sie schrieben sie für sich selbst, für Freunde, Angehörige oder ehemalige Kameraden auf, mit der Hand oder der Schreibmaschine und vielleicht einigen Kopien auf dünnem Durchschlagpapier. Eine beeindruckende, aber wenig ausgewertete Sammlung davon befindet sich im Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn und ist eine wichtige Grundlage für dieses...
| Erscheint lt. Verlag | 10.3.2022 |
|---|---|
| Zusatzinfo | Mit farbigem Bildteil |
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Zeitgeschichte ab 1945 |
| Geschichte ► Allgemeine Geschichte ► 1918 bis 1945 | |
| Schlagworte | Bataillon 999 • Bestsellerautor • Bewährungsbataillon • Blauer Schein • Buch zweiter Weltkrieg • Deserteure • Drittes Reich • erzählte Geschichte • Folter • Helden • Kampf • Menschenmaterial • Nationalsolzialismus • Nazis • NS Geschichte • Ostfront • Soldaten • Strafbataillon • Strafdivision • Wehrmacht • wehrunwürdig • Widerstand |
| ISBN-10 | 3-492-60079-4 / 3492600794 |
| ISBN-13 | 978-3-492-60079-8 / 9783492600798 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 14,7 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich