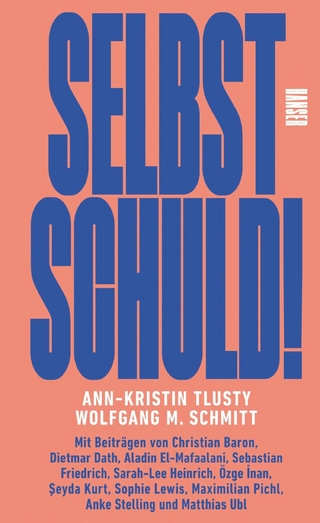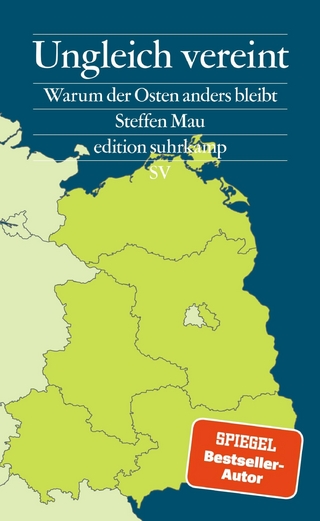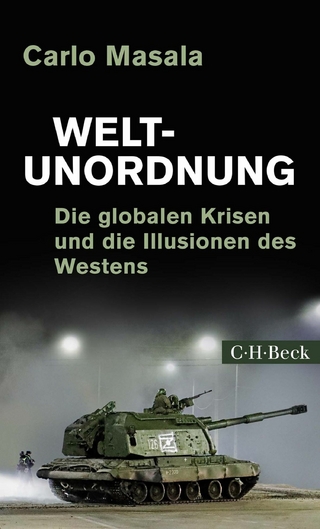Gemeinschaft der Ungewählten (eBook)
160 Seiten
Suhrkamp (Verlag)
978-3-518-77046-7 (ISBN)
Frei ist, wer an der sozialen Praxis einer Gemeinschaft teilhat und sich als Teil eines »Wir« verstehen kann. Ein in unserer Gegenwart vielfach bestrittenes Menschenrecht. Doch ein gutes Leben ist nur das mit anderen geteilte Leben.
In diesem Essay erzählt Sabine Hark die Geschichte von Zugehörigkeit und Gleichheit ausgehend von den Leben jener, deren Gemeinschaften mit Gewalt zertrennt werden, deren Hoffnungen auf ein gutes Leben an den Grenzzäunen der Macht zerschellen, deren Stimmen unerhört bleiben und deren Gleichheit mit Füßen getreten wird. Hark entwirft in einer zwischen Theorie und Dichtung oszillierenden Sprache ein machtsensibles politisches Ethos für ein plurales, demokratisches Zusammenleben, das Räume zum Atmen für die Vielen entstehen lässt.
<p>Sabine Hark, geboren 1962, ist Soziolog:in und Professor:in für Gender Studies. Hark ist Mitherausgeber:in der Zeitschrift <em>Feministische Studien</em> und leitet das Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung (ZIFG) an der TU Berlin.</p>
Einleitung
Eine Bemerkung von Audre Lorde begleitete mich beim Schreiben dieses Buches. »Ein Lernprozess ist etwas, das du anstiften, buchstäblich anstiften kannst, wie einen Aufstand«, sagt sie in einem Gespräch mit Adrienne Rich, geführt im Sommer 1979.1 Lorde berichtet von ihrer Erfahrung als Dozentin am John Jay College of Criminal Justice in Manhattan in den frühen 1970er Jahren. Politisch bewegte Jahre in den USA. Post-Civil-Rights-Movement-Jahre. Aufbruchsjahre. Aufständische Jahre. Kriegsjahre. Landesweit protestieren Studierende gegen die Beteiligung der USA am Krieg in Vietnam. Viele Universitäten sind deshalb im Frühjahr 1970 geschlossen. John Jay gehört nicht dazu. In Chicago hat die Polizei im Dezember 1969, wenige Monate bevor Lorde in Manhattan zu unterrichten beginnt, Fred Hampton und Mark Clark, zwei Schwarze Bürgerrechtler und Black-Panther-Aktivisten, im Schlaf erschossen.2 Hampton ist 21 Jahre alt, als die tödlichen Kugeln ihn treffen, Clark 22. Zwei von 40 Black Panthers, die zwischen 1967 und 1970 von Polizei und FBI getötet werden.
In New York hatte John Jay sich im Rahmen des »Open Admissions«-Programms der City University für alle ortsansässigen High-School-Absolvent_innen[1] geöffnet, unabhängig von Testergebnissen, Noten oder ähnlichen traditionellen Leistungskriterien. Binnen weniger Jahre vervierfachte sich dadurch die Zahl der Studierenden am College und auch der Anteil Schwarzer und of Color Student_innen stieg deutlich an. Lorde hatte den Rektor der Hochschule davon überzeugen können, dass Seminare zu Rassismus angeboten werden müssten. Ihre Studierenden – mehrheitlich männlich, weiß, Schwarz, puerto-ricanisch, etliche davon auch im Seminarraum waffentragend, aber auch einige Schwarze Frauen, fast alle aus Lower Manhattan, working-class background – seien affiziert und agitiert gewesen von den politischen Ereignissen und Veränderungen auf dem Campus und darüber hinaus, berichtet Lorde. In ihren Seminaren sei es ihr vor diesem Hintergrund daher eher darum gegangen, Denkprozesse in Gang zu setzen, als »ganze Stöße von Informationen« weiterzugeben. Confrontation teaching nennt Lorde das – »Konfrontationsunterricht«.
Zu einem Aufstand anstiften, der ein Lernen ist. Zu einem Lernprozess anstiften, der ein Aufstand ist. Das Bild bleibt – bei mir – hängen. Weniger, weil wir jeden Aufstand gutheißen können oder gar sollten, im Gegenteil. Nicht jeder Aufstand ist ein demokratischer Aufstand. Auch nicht, weil ein Aufstand wild und verwegen ist, weil er den Geschmack von Freiheit und Abenteuer ahnen lässt – er ist und tut auch all das –, sondern weil das Bild des Lernprozesses, der ein Aufstand ist, darauf aufmerksam macht, dass ein Aufstand Ausdauer und Beharrlichkeit erfordernde Arbeit an der Freiheit ist. Aufbrechen-Können mag die »ursprünglichste Gebärde des Frei-seins« sein, wie Hannah Arendt 1959 in Hamburg in ihrer Rede anlässlich der Verleihung des Lessing-Preises feststellt.3 Aufstehen und gehen und neue Fluchtlinien bahnen ist dennoch nur der erste Schritt. Schon dieser erste Schritt ist alles andere als einfach. Nicht alle können aufstehen und gehen. Bereits diesem ersten Schritt geht also voraus, dass wir etwas zu tun haben, es etwas zu lernen gibt: über die Bedingungen und Verhältnisse, die uns daran hindern, aufzustehen und zu gehen. Lorde hatte ihre Schwarzen Student_innen vor Augen, die sie befähigen wollte, ihre Situation in einer rassistischen, heterosexistischen und von rassifizierter sozialer Ungleichheit geprägten Gesellschaft zu begreifen – damit sie Verhältnisse würden verlassen können, die sie erniedrigen und verletzen, damit sie überleben. Survival skills. Für weiß positionierte und als ›einheimisch‹ eingeordnete Personen, die, wie ich selbst, in männlich dominierten, mehrheitlich weißen Institutionen lehren und schreiben, an diesen Orten aber als Subjekte nicht vorgesehen sind (weil ›weiblich‹ positioniert, weil geschlechtlich uneindeutig gelesen, weil lesbisch lebend, weil als ›Bildungsaufsteiger_in‹ und Klassenwechsler_in, weil …), stellt sich die Aufgabe heute etwas anders dar. Denn neben die Aufgabe, das Erlernen solcher survival skills zu ermöglichen – skills, die wir brauchen, um die Verhältnisse der Verhinderung verstehen und verlassen zu können –, tritt die komplexe und komplizierte Aufgabe, zu vermitteln, wie wir je unterschiedlich in Dominanzkultur und in Verhältnisse von Über- und Unterordnung verwickelt sind. Wie Dominanzkultur also die einen privilegiert und schützt, während sie die anderen relegiert und ihre Existenz bedroht. Anstiften zum Verlernen von Dominanzkultur, zu undoing dominance, ist, mit anderen Worten, das Programm. Und das heißt: intersektional organisierte Verhältnisse der Unter- und Überordnung erkennen und verstehen lernen, uns mit ihnen konfrontieren und sie konfrontieren und ihnen die Loyalität verweigern. Das ist, was von uns verlangt ist. Dass wir dazu fähig sind, ist nur eine der Lektionen, die von Audre Lorde zu lernen ist. Dismantle the master’s house.
***
Gemeinschaft der Ungewählten ist einer Frage gewidmet, die zu den dringlichen Fragen unserer Gegenwart gehört: der in allen Gesellschaften intensiv verhandelten Frage von Differenz und Zugehörigkeit. In der Sprache dieses Buches formuliert: Wem ist es gegeben, zu kommen, um zu bleiben und in Gemeinschaft mit anderen zu leben, sich also als Teil eines ›Wir‹ verstehen zu können? Es ist nicht das erste Buch zu dieser Frage und es wird gewiss nicht das letzte sein. Mich beschäftigt sie seit Langem. Bis in die Anfänge meiner wissenschaftlichen und politischen Auseinandersetzung mit der Welt lässt sie sich zurückverfolgen. Wissen wollen, wer Eine ist und wie sie geworden ist, wer zu wem und wozu gehört, wer von hier ist und warum, wer an welchen Orten vorgesehen ist oder nicht, was uns wie verbindet und trennt, wer wem Rechenschaft und Antwort schuldet, also Fragen nach dem Zusammenhang von Identität, Zugehörigkeit und Handeln, von Herkunft und Zukunft, treiben meine Neugier an.4
Wer sich als Teil eines ›Wir‹ verstehen kann, ist dabei eine Frage, die so ziemlich jeden Aspekt berührt, der unser Zusammenleben als endliche Wesen auf einem endlichen, dicht besiedelten und um Atem ringenden Planeten betrifft. Wie wir wirtschaften und haushalten, mit unseren eigenen Kräften und mit denen, die wir uns aneignen. Wie wir wohnen und arbeiten, konsumieren und uns fortbewegen. Wer sich wo ansiedeln kann, wer Zugang zu welcher Infrastruktur hat, vom Zugang zu sauberem Wasser und Brennstoff über den Anschluss an die digitale Infrastruktur und die Müllentsorgung bis hin zur Versorgung bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit. Wie wir uns zueinander und füreinander in Beziehung setzen, wie wir für den Planeten, mit dem wir leben, und für die Arten, mit denen wir ihn uns teilen, sorgen. Woran wir glauben, wofür wir politisch streiten und wen wir wertschätzen. Wie und wovon wir wissen wollen und welches Wissen wir teilen. Wen und was wir für normal und schützenswert halten. Wie wir leben, lieben und sterben wollen. Kurz: wie wir in der Welt sind und wie wir unser Zusammenleben gestalten. Ich nenne das ein Ethos der Kohabitation, also eine Weise des Zusammenlebens. Erste Umrisse eines solchen Ethos zu zeichnen, ist, was ich mir mit diesem Buch vorgenommen habe.
Seinen Ausgang nimmt dieses Buch von Judith Butlers Ethik der Kohabitation. Während ich einige Implikationen dieser Ethik zu durchdenken suche, möchte ich allerdings auch eine Verschiebung vorschlagen. Indem ich nämlich nicht den Weg der Ethik wähle, sondern mich an den Entwurf eines Ethos wage. Es ist ein Anfang. Nicht mehr, nicht weniger. Angeboten wird keine ausgereifte Theorie, die auf all diese Fragen eine Antwort weiß; darauf, wie Gesellschaften am besten einzurichten wären. Was stattdessen hier auf dem Tisch liegt, ist eine Skizze für eine ganz und gar praktische, machtsensible demokratische Lebensweise. Eine Lebensweise, die auf der Sorge um uns selbst, um andere und um die Welt gründet und die ihre Richtschnur in der letztlich schlichten Einsicht gefunden hat, dass Menschen im Plural...
| Erscheint lt. Verlag | 12.9.2021 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Antirassismus • Arbeiter-Klasse • Armut • Audre Lorde • edition suhrkamp 2774 • ES 2774 • ES2774 • Feminismus • Intersektionalität • Judith Butler • Klassismus • Prekariat • Prekarität • Proletariat • Ungleichheit |
| ISBN-10 | 3-518-77046-2 / 3518770462 |
| ISBN-13 | 978-3-518-77046-7 / 9783518770467 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich