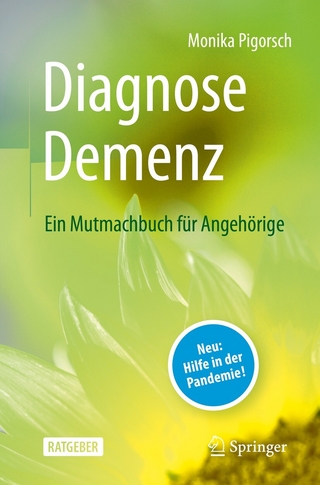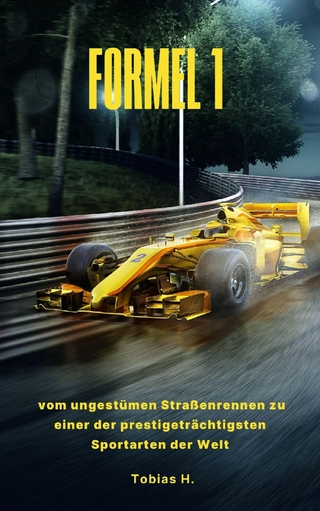Soziale Arbeit mit Muslimen (eBook)
252 Seiten
tredition (Verlag)
978-3-347-14880-2 (ISBN)
Simone Krüger, geb. 1968 ist Dipl. Sozialpädagogin (FH), Kinder- und Jugendcoach (IPE), sowie Focusingberaterin (IGF) und systemische Familientherapeutin (i.A.). Sie lebte einige Zeit selbst in einer orientalischen Gesellschaft und widmet sich seit über 20 Jahren der interkulturellen Thematik in der Sozialen Arbeit. Durch den Einbezug von religiösen Quellen in ihre pädagogische Arbeit erreicht Frau Krüger in ihren interkulturellen Angeboten auch gläubige muslimische Eltern, die Angebote der Mehrheitsgesellschaft sonst nicht annehmen. Hier führt sie immer wieder Elternbildungsseminare in verschiedenen Moscheegemeinden durch, leistet kulturelle und religiöse Dolmetscherdienste und bietet Fortbildungsmodule für Fachkräfte in sozialen Einrichtungen und Schulen an. Frau Krügers Kenntnisse speisen sich aus ihren Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen der Sozialen Arbeit. Neben den interkulturellen Elternbildungsangeboten und Fortbildungen für Fachkräfte in sozialen Einrichtungen und Lehrkräften an Schulen, arbeitete Frau Krüger sowohl in der stationären, als auch in der ambulanten Jugendhilfe, sowie im Jugendamt im Bereich Kinderschutz und Beratung von Familien. Derzeit arbeitet Frau Krüger an der Entwicklung neuer Fortbildungsmodule für soziale Fachkräfte und Lehrer*innen, in denen sie ihr breites Erfahrungswissen mit der Methode des Focusing verbinden möchte.
Simone Krüger, geb. 1968 ist Dipl. Sozialpädagogin (FH), Kinder- und Jugendcoach (IPE), sowie Focusingberaterin (IGF) und systemische Familientherapeutin (i.A.). Sie lebte einige Zeit selbst in einer orientalischen Gesellschaft und widmet sich seit über 20 Jahren der interkulturellen Thematik in der Sozialen Arbeit. Durch den Einbezug von religiösen Quellen in ihre pädagogische Arbeit erreicht Frau Krüger in ihren interkulturellen Angeboten auch gläubige muslimische Eltern, die Angebote der Mehrheitsgesellschaft sonst nicht annehmen. Hier führt sie immer wieder Elternbildungsseminare in verschiedenen Moscheegemeinden durch, leistet kulturelle und religiöse Dolmetscherdienste und bietet Fortbildungsmodule für Fachkräfte in sozialen Einrichtungen und Schulen an. Frau Krügers Kenntnisse speisen sich aus ihren Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen der Sozialen Arbeit. Neben den interkulturellen Elternbildungsangeboten und Fortbildungen für Fachkräfte in sozialen Einrichtungen und Lehrkräften an Schulen, arbeitete Frau Krüger sowohl in der stationären, als auch in der ambulanten Jugendhilfe, sowie im Jugendamt im Bereich Kinderschutz und Beratung von Familien. Derzeit arbeitet Frau Krüger an der Entwicklung neuer Fortbildungsmodule für soziale Fachkräfte und Lehrer*innen, in denen sie ihr breites Erfahrungswissen mit der Methode des Focusing verbinden möchte.
Vorwort zur Auflage 2019
Ich erinnere mich, als wäre es gestern. Im Frühjahr 2015 fiel für mehrere Wochen der Islamische Religionsunterricht aus. Grund hierfür waren die Winterferien, aber auch zahlreiche Fortbildungen, die ich damals hielt, um bayernweit für den Islamischen Unterricht an Schulen zu werben und Lehrkräfte fortzubilden. In diese Zeit fielen die schrecklichen Anschläge in Paris, bei welchen viele Menschen ihr Leben verloren und deren Drahtzieher sich einer religiösen Verblendung hingaben, hier im Namen ihrer Religion etwas Wertvolles vollendet zu haben. Die Diskussionen in ganz Europa über einem restriktiveren Umgang mit Muslim*innen waren in vollem Gange. Mir war es wichtig, mit meinen Schüler*innen der zehnten Klasse darüber zu sprechen. Dies wollte ich anhand der beeindruckenden Kölner Rede des Islamwissenschaftlers und Schriftstellers Navid Kermani machen, die ich in ihrem Tiefgang für hervorragend geeignet für ein unterrichtliches Setting hielt. So begann ich die Stunde, indem ich „Paris“ an die Tafel schrieb. Nach meinem letzten Buchstaben ging ein Raunen durch die Klasse und ein Schüler sprang auf und rief: „Nicht auch noch Sie, Herr Rochdi!“ Ich war überrascht, da ich damit absolut nicht gerechnet hatte und bat, mich über den Missmut der Klasse aufzuklären. Man berichtete mir, dass bereits in der Woche nach den Anschlägen die Lehrkräfte – unabhängig vom Fach – sich diesem Ereignis angenommen hatten. Auf meinen Einwand, dass es Ausdruck eines guten Unterrichts sei, auch tagesaktuelle Geschehnisse v.a. mit einer Abschlussklasse einer Realschule zu besprechen und zu thematisieren, wurde von der Klasse entgegnet: „Nein, Herr Rochdi. Wir sprechen nicht über die Geschehnisse. Die anderen sprechen darüber und wir werden als Muslim*innen ständig gefragt, was wir davon halten. Was sollen wir davon halten? Da sind doch auch Muslim*innen gestorben! Wieso sollen wir uns für etwas rechtfertigen, dessen Opfer uns näherstehen als dessen Täter?“
Dieses Erlebnis im Islamischen Unterricht – ein Unterricht, den ich als Schlüssel für die Entwicklung der Theologie des Islams in Deutschland sehe – prägt mich und meine Arbeit bis heute. Was ist in den letzten Jahren schiefgelaufen, dass sich junge Menschen, deren Eltern oftmals bereits in Deutschland die Schulbank gedrückt haben und die das Herkunftsland der Großeltern nur aus dem Urlaub kennen, sich nach teilweise drei Generationen noch immer fremd und missverstanden fühlen? Ist es die Ignoranz der Lehrkräfte, welche die Bedürfnisse ihrer Schülerschaft nicht ernst nimmt? Ist es der gesellschaftliche Diskurs, der häufig von sog. Scharfmachern dominiert wird und nicht selten schnell die Motive der Täter gefunden zu haben scheint und mit einfachen Antworten auf komplexe Fragestellungen – bewusst oder unbewusst – dafür sorgen, dass sich junge, praktizierende Muslim*innen zunehmendem Rassismus ausgesetzt sehen? Oder sind es doch rückwärtsgewandte Agitatoren innerhalb der muslimischen Community, die ein Klima des Nichtangenommen-Seins verstärken?
Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, ist der Islam, besser gesagt, sind die Muslim*innen und Muslime Deutschlands immer mehr auch ein gefühlter Teil der deutschen Gesellschaft. Noch vor gut 25 Jahren wussten die wenigsten, was der Islam ist und welche Rolle diese Religion für knapp vier Millionen Menschen bedeutet. An immer mehr Schulen genießen inzwischen Muslim*innen einen Islamunterricht – ganz selbstverständlich neben dem katholischen und evangelischen Religionsunterricht – und die Möglichkeiten für junge muslimische Abiturient*innen, sich in ihrem Studium aus der Binnenperspektive mit ihrer Religion zu beschäftigen und ein islamisch-theologisches Studium aufzunehmen, sind inzwischen beträchtlich. Knapp ein halbes Dutzend Hochschulen bieten inzwischen ein Studium der Islamischen Theologie oder Religionspädagogik an.
Selbst im Bereich der Medien – dank zahlloser oftmals internetbasierter Non-Profit-AV-Projekte – gibt es immer mehr deutschsprachige Programme mit einem Format für muslimische Konsument*innen. Es zeichnet sich ab, dass diese Veränderung der Gesellschaft weiter voranschreiten wird.
Zeitgleich mit all den positiven Entwicklungen rund um die Beheimatung der Muslim*innen in Deutschland, wird die Diskussion über Muslim*innen und die Rolle des Islams zunehmend von extremen Positionen bestimmt. Die zahllosen „Kopftuchdebatten“, die Frage, ob der Islam Teil Deutschlands sei, die Muslim*innen zu Deutschland gehören oder man historisch begründen könne, der Islam sei ein Teil der imaginären deutschen DNA, werden oft hitzig, wenig objektiv-faktengestützt, dafür umso subjektiv-emotionaler geführt. Die pauschale Vorverurteilung religiös begründeter Veränderungen in einer staatlich-öffentlichen Domäne wie der Schule haben in den letzten beiden Jahrzehnten immer wieder die Gemüter der Gesamtgesellschaft bewegt. So beispielsweise der Wunsch junger Menschen, einen Raum für ihr ritualisiertes Gebet zu nutzen oder die Rücksichtnahme auf religiöse Speisevorschriften in den Mensen der Schule. Oft verliefen die Diskussionen asynchron an den Bedürfnissen, Vorstellungen und Meinungen der in Deutschland lebenden Muslim*innen vorbei. Man sprach oft über die Betroffenen, aber selten mit ihnen. Viele dieser Punkte wurden vor Gerichten gelöst oder aufgeschoben, um wenige Jahre später in Tageszeitungen, Magazinen oder Polit-Talks erneut diskutiert zu werden. Die oben skizzierte Episode aus meiner schulischen Erfahrung zeigt, dass gerade im Bildungsbereich diese nicht selten oberflächlich geführten Diskussionen durchaus einen praktischen Nachhall und Auswirkungen auf das Zusammenleben sowie die Selbst- und Fremdwahrnehmung junger Heranwachsender haben.
Mit dem Zuzug Zuflucht suchender Menschen aus von Krieg und Misswirtschaft gebeutelten Staaten des Nahen Ostens und Afrikas hat sich die Sprache und der Umgang miteinander verschärft und teils unwürdige Züge angenommen. Diese Menschen werden immer häufiger als Kollektiv für Vergehen Einzelner rassistisch diskriminiert oder werden Opfer von Gewalt. Der anfangs noch offene Umgang mit den Geflohenen wurde zunehmend härter und mündet in manchen Teilen der Öffentlichkeit in blankem Hass. Gleichzeitig fehlt es an strukturellen Zielsetzungen und sicheren Bleibeperspektiven für neue MitbürgerInnen. Nicht selten fürchten Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern eine Abschiebung oder jungen unbegleiteten Flüchtlingen ist es schwierig zu erklären, dass eine solide Schulbildung nachhaltiger ist als der direkte Eintritt ins Berufsleben als sog. „ungelernte(r)“ Arbeiter*in.
Ich als (muslimischer) Religionspädagoge und Berater für interkulturelle Schulentwicklungsprozesse an Schulen suche selbst in scheinbar ausweglosen Situationen immer noch einen Hoffnungsschimmer. Bildung – in diesem Fall Professionalisierung des Lehrpersonals – ist ein probates Mittel. Ich bin mir sicher, dass man durch professionelles Handeln vielen Problemen und Vorurteilen entgegenwirken kann. Das, was auf den ersten Blick als religiös begründet, fremd und wenig nachvollziehbar wirkt, kann mit einem anderen Blick auf das Gleiche durchaus zu einer Lösung führen. Delinquentes Verhalten kann in falschen Kontexten verortet werden und führt so zu Missverständnissen und nicht selten zu falschen Wahrnehmungen. Im schlechtesten Fall ziehen diese falschen Schlussforderungen folgenschwere Entscheidungen nach sich. In unzähligen Lehrer*innen-Fortbildungen hat sich ein solcher veränderter Blick bewährt und zu Bewusstseinsveränderungen bzw. einem sensibilisierteren Umgang in entsprechenden Situationen geführt.
Nicht selten stoßen gerade Betreuer*innen, Berater*innen, Coaches und Mitarbeiter*innen kommunaler, staatlicher oder freier Träger mit den bisherigen Instrumenten an ihre professionellen Grenzen. Viele der ursprünglich gelehrten und in den Ausbildungen dieser Berufsgruppen vermittelten Ansätze bedürfen einer Überarbeitung und eines geänderten Blicks auf das Individuum mit all seinen Bedürfnissen, einschließlich seiner Religiosität sowie einer rassismuskritischen Perspektive auf das tägliche Tun.
Das vorgelegte Handbuch schließt hier eine lang angemahnte Lücke. Aus einer professionellen Sichtweise einer routinierten Beraterin mit einem Erfahrungsschatz aus vielen Jahren der Beratungs- und Fortbildungstätigkeit gibt Simone Krüger Multiplikator*innen, Pädagog*innen und Berater*innen sowie auch Lehrkräften Werkzeuge an die Hand, um mit entsprechender Sensibilität und fundiertem Wissen auf die Situation der Klient*innen individuell einzugehen und bestmöglich zu beraten. Dabei unterstützt Simone Krüger die Leser*innen bei der inzwischen schier nicht mehr zu greifenden Bandbreite an Büchern über den Islam, indem sie die zentralen Konfliktfelder der Beratung multiperspektiv beleuchtet und so...
| Erscheint lt. Verlag | 21.5.2021 |
|---|---|
| Verlagsort | Ahrensburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Schulbuch / Wörterbuch ► Lexikon / Chroniken |
| Geisteswissenschaften | |
| Technik | |
| Schlagworte | Familien mit Fluchthintergrund • Flucht und Migration • Geflüchtete • Integration • Interkulturelle Arbeit • interreligiöse Arbeit • Islam • Islam und Familie • Islam und Integration • Muslime • Muslime in der Sozialen Arbeit • muslimische Eltern • Muslimische Familien • Muslimische Kinder • muslimische Schüler • orientalische Familien • Orientalische Kultur • Soziale Arbeit |
| ISBN-10 | 3-347-14880-0 / 3347148800 |
| ISBN-13 | 978-3-347-14880-2 / 9783347148802 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich