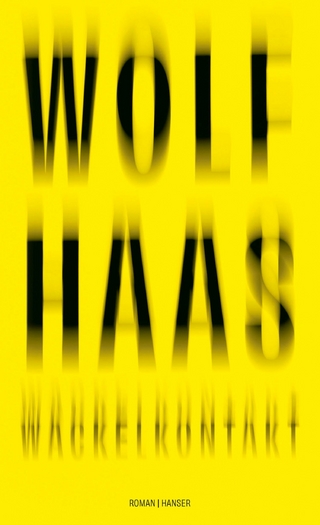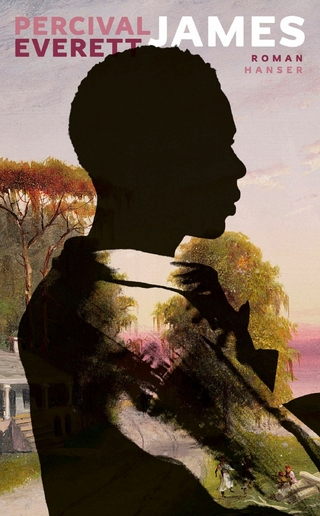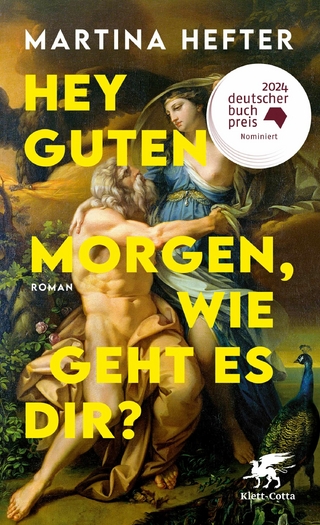Kanaky (eBook)
352 Seiten
Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
978-3-446-26984-2 (ISBN)
Bis heute gehört die südpazifische Inselgruppe Neukaledonien zu Frankreich. Um den kanakischen Unabhängigkeitskämpfer Alphonse Dianou, der dort bei einer vom französischen Militär blutig beendeten Geiselnahme ums Leben kam, ranken sich die widersprüchlichsten Legenden. Joseph Andras beginnt nachzuforschen, er reist an den Ort des Geschehens, trifft Dianous Witwe, Vertraute und Zeitzeugen. Seine Notizen, Gespräche und Begegnungen verbindet er zu einem augenöffnenden Text, der in den Kern eines hier kaum bekannten Konflikts dringt. Voller literarischer Kraft erzählt Andras von einer schillernden Figur des antikolonialen Widerstands, von einer verdrängten Kultur und einem Land, zerrissen im Kampf für einen unabhängigen Staat: Kanaky.
Joseph Andras wurde 1984 geboren und lebt in der Normandie. Für seinen Roman Die Wunden unserer Brüder (Hanser, 2017) wurde er mit dem Prix Goncourt für das beste Romandebüt ausgezeichnet.
10
Alle Bettler in Nouméa sind Melanesier. Einer von ihnen, ein in Lumpen gekleideter, vom Alkohol vernichteter, verwirrter und vielleicht für immer verlorener Vagabund — Bodensatz der Geschichte, Rückstand der sozialen Welt —, schnauzt mich an. Er scheint völlig wahllos durch die Straßen zu irren. Ein anderer, in Hafennähe, fragt mich, ob es vorstellbar wäre, an einem dieser Abende miteinander Sex zu haben, ich antworte mit einem Lächeln — ich werde ihm zufällig und am helllichten Tag noch einmal begegnen. Am Fuß einer Kokospalme sind ein paar Mamas in bunten Tuniken ins Gespräch vertieft. Eine muntere Clique von Jugendlichen übt sich in gefährlichen Rückwärtssaltos, während ich ein paar Verse der Dichterin Déwé Gorodé aus ihrem Buch Die Wahrheit sagen lese: »im Namen dessen was ist / und was nicht ist / oder der Meinen die nicht mehr sind / im Namen derer die am Rand stehen / vor einem ungeborenen Land«. Ein muskulöser, fies aussehender und mies gelaunter Typ mustert mich, spuckt ein paar Worte in einer der zahlreichen — fast dreißig — autochthonen Sprachen in meine Richtung und zieht weiter; eine junge Kanak-Frau auf einer Bank entschuldigt sich umgehend im Namen ihrer Leute; ich ahne, welcher Art seine Bemerkungen gewesen sein müssen.
Ich warte in einem der Hafencafés auf Hélène.
Der Himmel hat Durst und die Sonne ihren Spaß daran.
Sie setzt sich — diesmal allein.
»Als Alphonse vom Seminar auf den Fidschi-Inseln zurückkam, hat er sich ein Jahr Auszeit genommen. Sie haben ihn als Erzieher in Bourail in der Sacré-Cœur-Schule eingesetzt. Ich kannte ihn schon von früher, aber dort haben wir uns dann wiedergetroffen. Ich fragte ihn, warum ich ihn so lange nicht gesehen hätte, und er erzählte, dass er zum Studieren auf den Fidschis war. ›Ich wollte Priester werden, aber jetzt habe ich mir ein Jahr freigenommen‹, sagte er. ›Bei dem, was bei uns hier vor sich geht, weiß ich nicht, ob …‹ Er ist dann ein Jahr als Erzieher in Bourail geblieben. Danach ist er nach Saint-Louis gegangen, um in den Bergen bei den Trappistenmönchen nachzudenken. Und dort oben hat er die Entscheidung getroffen, das Priesterseminar zu verlassen. Das war vier oder fünf Jahre vor der Gendarmerie. Als wir uns wiedergesehen haben, hat er zu mir gesagt: ›Ich will für die Unabhängigkeit kämpfen. Und ich möchte dich etwas fragen: Willst du mit mir leben? Auch wenn es nicht einfach wird. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass ich höchstens bis 1990 leben werde.‹ Ich habe ihn angesehen. Und er hat gefragt: ›Willst du?‹ Und ich habe ›ja‹ gesagt. Dann sind wir nach Nouméa gezogen. … Ich hatte ihn übers Volleyballspielen kennengelernt. Und seine Schwester war mit meiner großen Schwester in der Schule gewesen.«
Hélène spricht mit freundlicher, klarer Stimme. Zurückhaltend, aber diesmal entschlossener. Hat diese tragische Prophezeihung sie damals nicht schockiert oder zumindest irritiert? »Nein, das hat mir keine Angst gemacht. Er hatte zu mir gesagt: ›Wenn ich mich für dich entschieden habe, dann wegen deiner inneren Stärke.‹ Ich konnte was aushalten. Alphonse war Erzieher, er konnte sehr gut beobachten. ›Wir werden ohne Geld leben‹, hat er gesagt. Mein Papa, der bei der Union calédonienne gewesen war, war schon tot, und meine Mama fand das nicht schlimm, wir waren damals alle Teil dieses Kampfs. Also haben wir erst ein bisschen bei meinen Eltern gewohnt und dann bei seiner Mama in Rivière Salée. Ich bin aufs Feld gegangen, und er war die ganze Zeit unterwegs, um die Jugendlichen politisch zu bilden, in der Provinz und auf den Inseln — auf Lifou, Maré und Grande Terre. Alphonse hatte kein Abitur, nur einen Mittelschulabschluss. Aber danach hatte er Fernkurse belegt, und er sprach sehr gut Englisch. Er war in Australien gewesen, um bei einer Gruppe von Kernkraftgegnern mitzuarbeiten. Alphonse war nicht ehrgeizig, ich persönlich würde sagen, er war einfach integer. Er stand auf der Seite seines Volks. Er hat für seine Kultur gekämpft und dafür, dass Frankreich uns als ursprüngliches Volk hier anerkennt. Dass wir überhaupt da sind, dass wir existieren. Damals waren wir den Weißen in allem nachgestellt. Wenn im Rathaus zehn oder zwanzig Kanak in einer Schlange warteten, kam immer zuerst der Weiße dran. Also gingen wir an Orte, wo die Wichtigtuer waren, und tranken Kaffee oder aßen Eis, nur um ihnen zu zeigen, dass es auch uns noch gibt. Das waren so kleine Dinge, kleine Aktionen.«
Hélène zieht Briefe, Karteikarten, Fotos, eine Zeitschrift, eine Zeitung und ein Buch aus der Handtasche. Breitet sie auf dem Bistrotisch aus. Ich greife mir Alphonse Dianous Psalmsammlung heraus, der Einband ist vergilbt, fleckig, abgenutzt, ramponiert. Schlage sie auf. Lese die Verse, die er mit rosa Filzstift unterstrichen oder am Rand kommentiert hat. »Prozess gegen Jesus«, schreibt er hier, »Flehen« und »Auferstehung« dort. Seine Schrift ist rund, fast schülerhaft, Punkte sind kleine Kreise. Der Vers »Weichet von mir, alle Übeltäter; denn der HERR hört mein Weinen« ist eingekreist.
Ein Schwarzweißfoto zeigt Dianou in einer Jacke mit Schulterklappen und mit zusammengekniffenen Augen — die Sonne hat ihn geblendet, rechtfertigt ihn Hélène. Auf einer ganzseitigen Abbildung in einer trotzkistischen australischen Zeitung sieht man ihn heiter und vergnügt in Blouson und mit dunklem Schal. Der Titel des Artikels — ich übersetze — : »Im Kampf gegen den französischen Kolonialismus werden junge Kanak aktiv«. Der mit »f« geschriebene Alphonse wird als »Leader« der Jugend und Mitglied des Politbüros der FLNKS vorgestellt; in einem Interview spricht er von seiner Festnahme nach einer gewaltfreien Sitzblockade auf einem der bekanntesten Plätze in Nouméa, der Place des Cocotiers.
»Der Kontakt mit Alkohol und Drogen hat neben anderen Faktoren zu einer stark nachlassenden Beteiligung am Gemeinschaftsleben geführt«, analysiert Dianou. Im Interview erwähnt er das Interesse mancher Kanak für Ernesto Guevara, erläutert allerdings ausführlich, dass man weiter blicken müsse als bis zur Waffe, die dieser geschwenkt habe; er verweist auf Éloi Machoro und das Vermächtnis, das dieser mit seiner Erschießung an jenem Januartag hinterlassen habe: Entscheidend sei nicht die Waffe gewesen, die er bei sich getragen habe, sondern »seine politische Vision«. Denn man dürfe nicht vergessen: Machoro habe nie geschossen. Dieser Text erschien Anfang November 1987, sechs Monate später war Dianou tot.
Hélène fährt fort: »Alphonse hatte sich geschworen, nie, niemals, einen Tropfen Alkohol anzurühren. Sein Papa war ein gewalttätiger Alkoholiker gewesen … Und seine Mama eine sehr fromme Frau, die viel gebetet hat. Zur Zeit der ›Ereignisse‹ ging es seiner Mama sehr schlecht. Sie wurde krank und musste ständig ins Krankenhaus … Sie hat dann unseren Sohn, Darewa, zu sich genommen — das war nicht einfach für mich. In der Schule haben sie Darewa Terroristenkind genannt. Vor allem eine Lehrerin aus Perpignan — ich habe in der Zeitung gelesen, dass sie inzwischen gestorben ist. So war das damals. Wir waren bei der Beerdigung von Alphonse und den anderen nicht dabei. Auch unsere Kinder nicht.«
Nach der Geiselnahme mussten sie sich fünfzehn Tage lang in Nouméa verstecken. Die Polizei suchte sie. Sie wohnten in der Mietwohnung von Alphonse’ Cousine in einer Hochhaussiedlung, sie durften nicht reden und nicht hinausgehen. »Das war hart, es war schwierig. Wie soll ich das beschreiben? Manchmal haben wir uns gefragt, ob das überhaupt die Wirklichkeit ist, ob wir nicht irgendwo zwischen Himmel und Erde schweben … Wir waren zwischen … Wir wussten nicht recht, was wir tun sollten.«
Wie hat sie überhaupt von seinem Tod erfahren? »Eine Cousine ist spätnachmittags gekommen und hat uns gefragt, ob wir wüssten, was auf Ouvéa kurz nach dem Armeeangriff passiert ist. Der Himmel hing voller dicker, schwarzer Wolken. Dann hat sie uns alles erzählt. Von den Toten, den Verletzten … Wir sind dann zu Alphonse’ Eltern gefahren — und haben nach und nach immer mehr erfahren: Leute kamen und gingen und brachten neue Informationen. Aber vom FLNKS hat sich niemand blicken lassen. Nicht ein Politiker. Das hat etwas mit mir gemacht … Warum ist Jean-Marie Tjibaou im Jahr darauf zur Feier am Ende der Trauerzeit gekommen, aber war zum Zeitpunkt, als wir ihn gebraucht hätten, nicht da? Das frage ich mich immer noch. Bis heute.«
Ihre Stimme beginnt zu zittern, ihre Augen füllen sich mit Tränen.
Hatte sie gewusst, dass ihr Mann eine Gendarmerie besetzen wollte? Die Antwort schießt aus ihr heraus: »Nein! Ich hatte keine Ahnung! Nicht die geringste!«
...| Erscheint lt. Verlag | 15.3.2021 |
|---|---|
| Nachwort | Claudia Hamm |
| Übersetzer | Claudia Hamm |
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | Kanaky. Sur les traces d'Alphonse Dianou. Récit |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | 19. Jahrhundert • 20. Jahrhundert • 21. Jahrhundert • Antikolonialismus • Antirassismus • Dekolonialisierung • Dokumentarroman • Frankreich • Geiselnahme • Goncourt • Hamm • Kanaken • Kolonialmacht • Kolonie • Naturbeschreibungen • Neukaledonien • Pariser Kommune • Referendum • Reisen • Reisetagebuch • Südpazifik • Überseegebiete • Unabhängigkeit • Vergangenheitsbewältigung • Widerstand • Zeitzeuge |
| ISBN-10 | 3-446-26984-3 / 3446269843 |
| ISBN-13 | 978-3-446-26984-2 / 9783446269842 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,1 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich