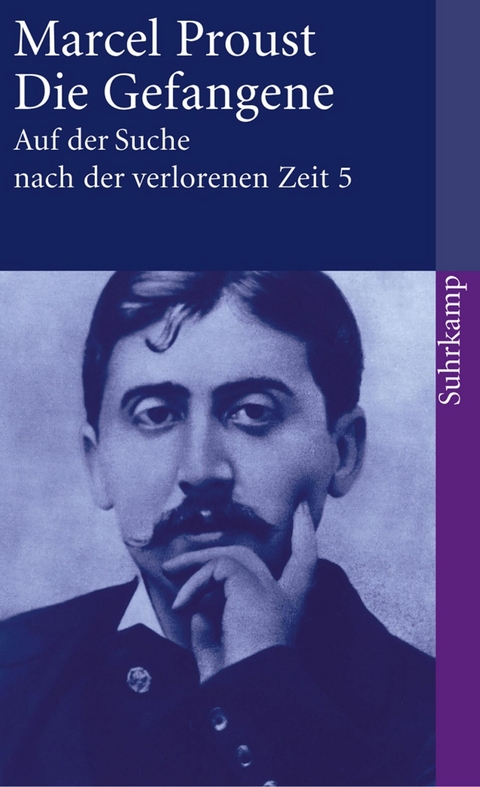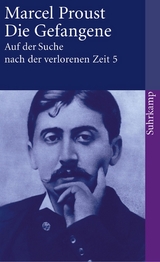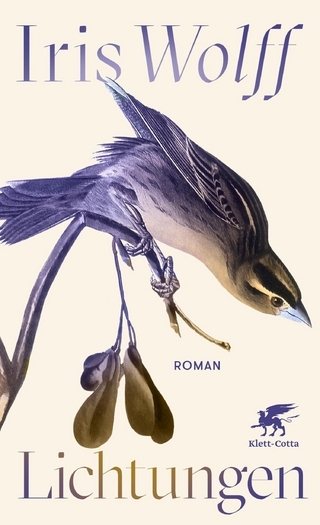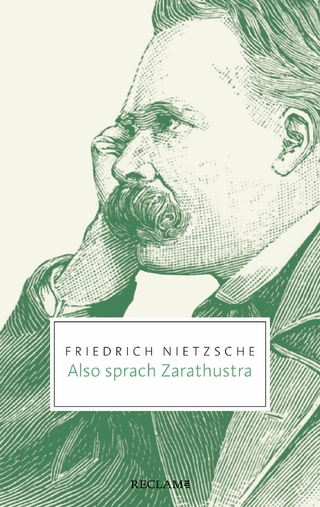Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Frankfurter Ausgabe (eBook)
695 Seiten
Suhrkamp Verlag
978-3-518-76744-3 (ISBN)
Marcel, der am Ende von Sodom und Gomorrha beschlossen hat, Albertine zu heiraten, nimmt sie nun zu sich nach Hause und hält sie vor den Augen der Welt versteckt. Sehr bald stellt er jedoch fest, daß mit dieser Gefangennahme die Liebe einer Eifersucht weicht, die ihn zum eigentlichen Gefangenen macht. Anders als Swann erkennt Marcel zwar die Mechanismen dieser Eifersucht, kann sich aber nicht von ihr befreien. Statt dessen werden Sehnsüchte nach anderen Frauen wach, nach neuen Reisen.
<p>Marcel Proust wurde am 10. Juli 1871 in Auteuil geboren und starb am 18. November 1922 in Paris. Sein siebenbändiges Romanwerk <em>Auf der Suche nach der verlorenen Zeit</em> ist zu einem Mythos der Moderne geworden.</p> <p>Eine Asthmaerkrankung beeinträchtigte schon früh Prousts Gesundheit. Noch während des Studiums und einer kurzen Tätigkeit an der Bibliothek Mazarine widmete er sich seinen schriftstellerischen Arbeiten und einem - nur vermeintlich müßigen - Salonleben. Es erschienen Beiträge für Zeitschriften und die Übersetzungen zweier Bücher von John Ruskin. Nach dem Tod der über alles geliebten Mutter 1905, der ihn in eine tiefe Krise stürzte, machte Proust die Arbeit an seinem Roman zum einzigen Inhalt seiner Existenz. Sein hermetisch abgeschlossenes, mit Korkplatten ausgelegtes Arbeits- und Schlafzimmer ist legendär. <em>In Swanns Welt</em>, der erste Band von Prousts opus magnum, erschien 1913 auf Kosten des Autors im Verlag Grasset. Für den zweiten Band, <em>Im Schatten junger Mädchenblüte</em>, wurde Proust 1919 mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet. Die letzten Bände der <em>Suche nach der verlorenen Zeit</em> wurden nach dem Tod des Autors von seinem Bruder herausgegeben.</p>
Ich weiß nicht, weshalb der Lauf meiner Träumerei, der bisher diesen Erinnerungen an Musikwerke gefolgt war, sich plötzlich denen zuwendete, die in unserer Zeit die besten Interpreten gewesen sind und unter die ich, wobei ich seine Rolle ein wenig übertrieb, auch Morel einordnete. Sofort schlugen meine Gedanken einen jähen Haken, und ich begann Morels Charakter, gewissen Eigentümlichkeiten dieses Charakters nachzusinnen.3 Morel hatte die Gewohnheit – sie mochte mit der Neurasthenie, die an ihm nagte, zusammenhängen, wenn sie auch nicht damit verwechselt werden darf –, von seinem Leben zu sprechen, entwarf dabei aber ein so nebelhaftes Bild, daß man nur sehr schwer Einzelheiten ausmachen konnte. Er hielt sich zum Beispiel völlig zur Verfügung von Monsieur de Charlus unter der Bedingung, daß er an den Abenden frei hatte, denn er wünschte, nach dem Abendessen an einem Algebrakurs teilzunehmen. Monsieur de Charlus gab seine Zustimmung, verlangte aber, ihn hinterher noch zu sehen. »Unmöglich, es ist ein altes italienisches Gemälde« (dieser Scherz hat, wenn man ihn in dieser Weise wiedergibt, freilich keinen Sinn; aber da Monsieur de Charlus Morel veranlaßt hatte, die Éducation sentimentale zu lesen, in deren vorletztem Kapitel Frédéric Moreau diesen Satz sagt, fand Morel es witzig, niemals das Wort »unmöglich« zu verwenden, ohne die folgenden »es ist ein altes italienisches Gemälde«1 hinzuzusetzen) »der Kurs dauert oft sehr lange, und da das schon eine große Zumutung für den Lehrer ist, wäre er natürlich verletzt …« – »Aber es braucht einen solchen Kurs doch gar nicht, mit der Algebra ist es ja nicht wie mit Schwimmen oder Englischsprechen, so etwas kann man doch aus einem Buch erlernen«, antwortete Monsieur de Charlus, denn er sah auf der Stelle in dem Algebrakurs eines jener Bilder, bei denen man nichts ausmachen kann. Vielleicht handelte es sich um eine Affäre mit einer Frau oder, falls Morel auf unsaubere Weise Geld zu verdienen suchte und sich der Geheimpolizei zur Verfügung gestellt hatte, um eine Unternehmung mit Agenten der Sûreté2, oder, wer weiß, schlimmer noch, wurde ein Gigolo erwartet, der in einem Bordell gebraucht werden mochte. »Sehr viel leichter sogar aus einem Buch«, gab Morel Monsieur de Charlus zur Antwort, »denn bei einem Algebrakurs versteht man praktisch nichts.« Warum studierst du sie dann nicht lieber bei mir, wo es so sehr viel angenehmer wäre? hätte Monsieur de Charlus wiederum entgegnen können, aber er hütete sich, denn er wußte, daß auf der Stelle der Algebrakurs unter alleiniger Wahrung seines Charakters als Mittel, die Abendstunden freizuhalten, sich in eine unumgänglich notwendige Tanz- oder Zeichenstunde verwandelt hätte. Hier konnte allerdings Monsieur de Charlus sehen, daß er sich, zum Teil wenigstens, im Irrtum befand. Morel beschäftigte sich häufig im Haus des Barons damit, Gleichungen zu lösen. Monsieur de Charlus warf ein, die Algebra könne für einen Violinspieler doch kaum von Nutzen sein. Morel erwiderte, es handle sich um eine Zerstreuung, einen Zeitvertreib und ein Heilmittel gegen die Neurasthenie. Zweifellos hätte Monsieur de Charlus versuchen können, sich zu informieren und in Erfahrung zu bringen, worin in Wirklichkeit jene geheimnisvollen, unverzichtbaren Algebrakurse bestanden, die nur in den Nachtstunden erteilt wurden. Um aber den Beschäftigungen Morels auf den Grund zu gehen, war Monsieur de Charlus zu sehr in die verstrickt, mit denen das Gesellschaftsleben ihn in Anspruch nahm. Besuche, die er zu empfangen oder zu machen hatte, die Zeit, die er im Club verbrachte, Diners, Theatervorstellungen hinderten ihn, daran zu denken ebenso wie an die heftige und zugleich heimtückische Bosheit, die Morel, wie es hieß, in den verschiedenen Milieus und den verschiedenen Städten, die er besucht hatte, gezeigt und zugleich verheimlicht hatte, so daß man dort von ihm nur mit Schaudern und mit gedämpfter Stimme sprach, ohne zu wagen, Genaueres zu berichten. Leider hatte ich Gelegenheit, an diesem Tag einen jener Ausbrüche nervöser Bosheit mit anzuhören, als ich mit dem Klavierspiel aufgehört und mich in den Hof hinunterbegeben hatte, um Albertine entgegenzugehen, die noch immer nicht kam. Als ich an Jupiens Laden vorbeiging, in dem sich Morel und diejenige, von der ich glaubte, sie werde bald seine Frau sein, allein aufhielten, hörte ich Morel mit lauter Stimme schreien, wobei sich etwas offenbarte, was ich an ihm nicht kannte: ein für gewöhnlich unterdrückter bäurischer, äußerst merkwürdiger Tonfall. Die Worte waren es nicht weniger, fehlerhaft, was das Französische anbelangt, doch Morel kannte alles nur unvollkommen. »Wollen Sie wohl machen, daß Sie fortkommen, Sie Schlampe, elende Schlampe, Sie«, sagte er immer wieder zu der Kleinen, die gewiß zu Beginn gar nicht verstand, was er sagen wollte, dann aber zitternd und stolz vor ihm verharrte. »Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen sich fortmachen, alte Schlampe, Sie elende Schlampe; holen Sie nur Ihren Onkel, daß ich ihm sage, was Sie sind, Sie Hure, Sie.« Im selben Augenblick hörte man draußen im Hof die Stimme Jupiens, der eben mit einem seiner Freunde plaudernd heimkehrte, und da ich wußte, daß Morel außerordentlich feige war, fand ich es nicht nötig, Jupien und seinem Freund, die einen Augenblick später im Laden sein würden, auch noch meine Kraft zur Verfügung zu stellen, und ging die Treppe hoch, um Morel nicht zu begegnen, der zwar (wahrscheinlich, weil er die Kleine durch eine erpresserische Drohung, die vielleicht auf nichts und wieder nichts beruhte, erschrecken und damit beherrschen wollte) so sehr gewünscht hatte, daß man Jupien holte, dann aber schleunigst verschwand, sobald er dessen Stimme auf dem Hof vernahm. Nur diese Worte, wie sie zitiert wurden, vermöchten das Herzklopfen nicht zu erklären, mit dem ich die Treppe hinaufging. Solche Szenen, denen wir im Leben beiwohnen, finden ein unberechenbares Element der Kraft in dem, was die Militärs bei einer Offensive als den Vorteil der Überrumpelung bezeichnen, und wenn ich auch eine noch so wohltuende Beruhigung bei dem Gedanken verspürte, daß Albertine, anstatt im Trocadéro zu bleiben, zu mir heimkehren würde, blieb mir doch nicht weniger deutlich der Klang der zehnmal wiederholten Worte im Ohr: »elende Schlampe, elende Schlampe«, Worte, die mich erschüttert hatten.
Meine Erregung ließ allmählich nach. Albertine würde kommen. In wenigen Augenblicken würde ich sie an der Tür schellen hören. Ich fühlte, daß mein Leben nicht einmal mehr war, was es hätte sein können, und daß die Tatsache, eine Frau zu haben, mit der ich ganz natürlich, sobald sie zurückgekehrt war, würde ausgehen müssen, auf deren Verschönerung ich alle aktiven Kräfte meines Seins mehr und mehr verwenden würde, etwas wie einen Stamm aus mir machte, der zwar gewachsen, aber auch beladen war mit der üppigen Frucht, in die alle seine Reserven flossen. Durch ihren Kontrast mit dem Zustand der Angst, in dem ich mich vor einer Stunde noch befunden hatte, war die Ruhe, in die mich die Rückkehr Albertines versetzte, viel umfassender als diejenige, die ich am Morgen vor ihrem Aufbruch in mir verspürt hatte. Auf die Zukunft vorgreifend, über die ich dank der Gefügigkeit meiner Freundin mehr oder weniger Herr war, widerstandsfähiger, von der unmittelbar bevorstehenden, lästigen, unvermeidlichen und wohltuenden Anwesenheit Albertines gleichsam erfüllt und gestärkt, war es eine Ruhe, wie sie (indem sie uns der Notwendigkeit enthebt, das Glück in uns selbst zu suchen) aus einem familiären Gefühl und häuslichem Glück erwächst. Familiär und häuslich: so war, nicht weniger als das Gefühl, das einen großen Frieden in mir heraufgeführt hatte, während ich Albertine erwartete, auch dasjenige, das mich erfüllte, als ich gleich darauf mit ihr spazierenfuhr. Sie zog einen Augenblick ihren Handschuh aus, sei es um meine Hand zu berühren, sei es um mich damit zu blenden, daß sie mich an ihrem kleinen Finger neben demjenigen, den ihr Madame Bontemps geschenkt hatte, einen Ring sehen ließ, in dem eine lichte Rubinfolie ihre breite, feuchtschimmernde Fläche ausbreitete. »Schon wieder ein neuer Ring, Albertine! Ihre Tante ist wirklich von einer Großzügigkeit …« – »Nein«, sagte sie lachend, »dieser ist nicht von meiner Tante. Ich habe ihn selbst gekauft, da ich ja dank Ihnen groß sparen kann. Ich weiß nicht einmal, wem er früher gehört hat. Ein Reisender, dem das Geld ausgegangen war, ließ ihn dem Besitzer eines Hotels zurück, in dem ich in Le Mans gewohnt hatte. Der aber wußte nicht, was er damit anfangen sollte, und hätte ihn sogar weit unter Preis verkauft. Aber er war immer noch viel zu teuer für mich. Jetzt, da ich dank Ihnen eine schicke Dame werde, habe ich ihn fragen lassen, ob er ihn noch hat. Und da ist er nun.« – »Das sind aber viele Ringe, Albertine. Wo werden Sie denn den hintun, den ich Ihnen schenken werde? Auf alle Fälle ist dieser sehr hübsch; ich kann die Ziselierungen rings um den Rubin nicht recht erkennen, doch es sieht beinahe aus wie ein grimassierender Männerkopf. Meine Augen sind aber nicht gut genug.« – »Auch wenn Sie bessere hätten, würde es Ihnen nicht viel helfen. Ich erkenne es auch nicht.«
Früher hatte ich mir bei der Lektüre von Memoiren oder einem Roman, wo ein Mann stets mit einer Frau ausgeht, mit ihr Tee trinkt, gewünscht, das auch tun zu können. Ich hatte manchmal geglaubt, es zu erreichen, zum Beispiel, als ich die Geliebte Saint-Loups ausführte und mit ihr zum Abendessen ging. Wie sehr ich aber auch die Vorstellung zu Hilfe rief, daß ich in jenem Augenblick die Rolle der Romanfigur spielte, die ich so neidvoll betrachtet hatte, so überzeugte mich diese Vorstellung zwar...
| Erscheint lt. Verlag | 21.6.2020 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | Angabe fehlt |
| Themenwelt | Literatur ► Klassiker / Moderne Klassiker |
| Literatur ► Romane / Erzählungen | |
| Schlagworte | 19. Jahrhundert • 20. Jahrhundert • Die Gefangene • Erinnerung • Fin de siècle • Frankfurter Ausgabe • Frankreich • Liebesromane historisch • Marcel Proust • Moderne • Proust • Roman • ST 3645 • ST3645 • Suche • suhrkamp taschenbuch 3645 • Westeuropa • Zeit |
| ISBN-10 | 3-518-76744-5 / 3518767445 |
| ISBN-13 | 978-3-518-76744-3 / 9783518767443 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,7 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich