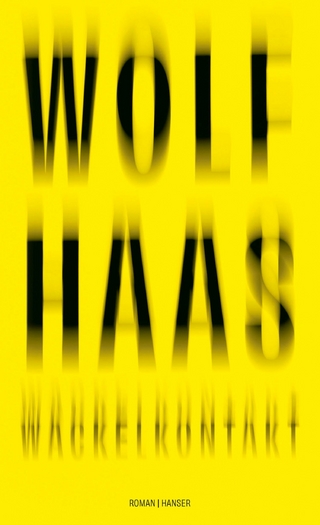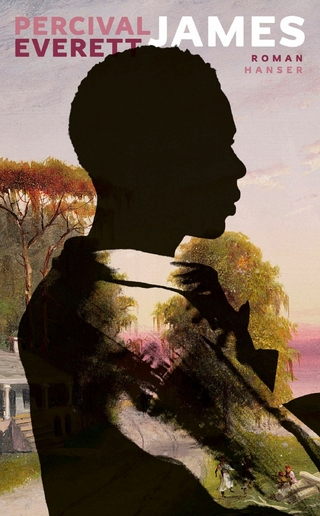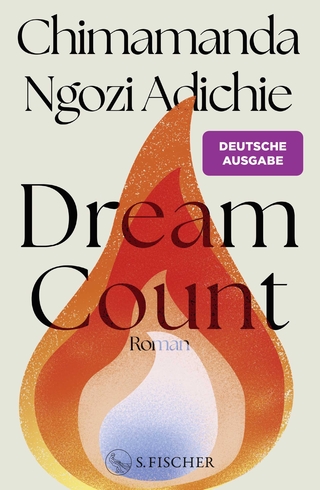Der weiße Abgrund (eBook)
192 Seiten
btb (Verlag)
978-3-641-26503-8 (ISBN)
Eingebettet in ein faszinierendes Panorama des Paris seiner Zeit, zeichnet Boëtius' Roman das einzigartige Porträt der letzten Lebensjahre des großen deutschen Dichters Heine.
Henning Boëtius (1939-2022), wuchs auf Föhr und in Rendsburg auf und lebte zuletzt in Berlin. Er studierte Germanistik und Philosophie und promovierte 1967 mit einer Arbeit über Hans Henny Jahnn. Boëtius war Verfasser eines vielschichtigen Werkes, das Romane, Essays, Lyrik und Sachbücher umfasst. Sein Roman 'Phönix aus Asche' wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Bekannt wurde er außerdem durch seine Kriminalromane um den eigenwilligen niederländischen Kommissar Piet Hieronymus.
Romeo und Julia
In Paris herrscht den ganzen Sommer 1854 über schönstes Wetter, ein glücklicher Umstand, der dem kranken Dichter, den alle liebevoll Henri nennen, den Umzug in seine neue Wohnung in der Rue Matignon sehr erleichtert. Die alte Wohnung ist viel zu klein. Henri verfügt dort über kein Krankenzimmer. Alle Geschäfte der Haushaltsführung finden in seiner unmittelbaren Nähe statt. Irgendwo wird außerdem ständig Pianoforte geübt, eine Qual für den geräuschempfindlichen Poeten.
Henris Frau hat sich lange gegen eine Umsiedlung gesträubt. Sie fürchtet, dass nun das Geld zu knapp werden wird, um ihren Lieblingsbeschäftigungen nachgehen zu können, teure Kleider kaufen, mit Freunden ausgehen, gut essen und Champagner trinken. Um zu sparen, hat sie ihren Mann überredet, die schwarze Pflegerin, die Mulattin, zu entlassen. Als ehemalige Schuhverkäuferin aus einfachen Verhältnissen stammend, ist Mathilde außerdem enge Wohnverhältnisse gewohnt. Aber als Ende Juni das Nachbarhaus in der Rue Amsterdam lichterloh brennt und die Flammen auf ihre Wohnung überzuschlagen drohen, willigt sie in das Vorhaben ihres Mannes ein.
Er hat die Hitze der Wand gespürt und mit seinem überempfindlichen Gehör das Züngeln der Flammen und das Rauschen des Wassers aus den neuartigen Dampfspritzen der Feuerwehr wie ein stürmisches Meer wahrgenommen, dessen Wellen ihn zu verschlingen drohen. Er hat zwar nichts gegen das Verbrennen von Manuskripten, schon mehrfach hat er schließlich selbst Texte und Briefe in den Ofen gesteckt, wenn sie ihm nicht mehr gefielen oder zu kompromittierend waren. Er weiß sehr wohl um die Schwäche mancher seiner Verse, wenn er zu mechanisch die Reimdrehorgel bedient. Auch hat der erst zwölf Jahre zurückliegende verheerende Große Brand von Hamburg, der auch die Wohnung seiner geliebten Mutter zerstörte, seine dort lagernden Manuskripte in Asche verwandelt. Aber ein Autodafé am Autor geht ihm entschieden zu weit. Als dann auch noch das Hämmern und Sägen der Arbeiter beginnt, die das vom Feuer beschädigte Mauerwerk reparieren, besteht er auf einem sofortigen Wohnungswechsel.
Seine stark übergewichtige Frau begibt sich daher trotz der enormen Hitze auf die Suche nach einem neuen Quartier. Während sie ächzend durch die Straßen stiefelt, bilden sich große Schweißflecken unter den Achseln ihres Kleides. Schließlich betritt sie eine Gaststätte, um sich bei Kuchen und Eiswasser mit einem Schuss Absinth zu erfrischen. Sie ist seit geraumer Zeit eine treue Freundin der grünen Fee.
Mathilde ist ungebildet und voller Leben, was vielleicht sogar zusammenhängt. Heine hat sie vor nunmehr 21 Jahren kennengelernt, als er sich in der berühmten, gasbeleuchteten Passage des Panoramas am Boulevard Montmartre Halbstiefel aus Ziegenleder kaufen wollte, solche, wie sie der Dandy Brumel populär gemacht hatte. Auch Henri gab sich gerne als Dandy. Er pflegte hierherzukommen, nicht nur um Schuhe zu kaufen, sondern auch weil hier die schönsten Prostituierten flanierten. Er war nicht besonders groß, eher zierlich gebaut und doch zugleich muskulös. Seine Gesichtszüge waren fein gezeichnet, die lange Nase edel geformt, der kleine Mund mit den rosigen Lippen fast mädchenhaft. Die weichen, hellbraunen Haare umflossen seine hohe blasse Stirn wie ein Vorhang, hinter dem sich Witz und frivole Gedanken verbargen. Meistens trug er einen hellen, zerknitterten Anzug mit einer roten Rose im Knopfloch des Revers, hatte einen verbeulten Strohhut auf und benutzte hin und wieder eine Brille, um die Damen zu mustern, die er wegen seiner starken Kurzsichtigkeit sonst nur verschwommen wahrnehmen konnte. Er setzte die Sehhilfe jedoch immer schnell wieder ab, wenn er meinte, gefallen zu wollen. Und er gefiel den Damen, denn seine Männlichkeit war von kindlicher Grazie. Er erinnerte an einen Amor, dessen Blick aus leicht verschwimmenden Augen unter den ebenmäßigen Bögen der Brauen Liebespfeile zu versenden schien, ein Phänomen, das eigentlich nur seiner Sehschwäche zu verdanken war. Jedenfalls weckte er bei den Dirnen so selten empfundene mütterliche Gefühle, ein Grund dafür, dass er für genossene Liebesdienste fast nie bezahlen musste.
Die gläubige Katholikin Augustine Crescence war keine Prostituierte. Sie verkaufte in der Passage modisches Schuhwerk, darunter auch Stiefel des berühmten Lederkünstlers Sakowski. Sie war 18 Jahre jünger als Henri. Ihr Anblick, ihre stattliche Figur, die schmale Taille, der hohe, feste Busen, die braunen Haare mit den Korkenzieherlocken, die großen schwarzen Augen, sogar ihre hohe Fistelstimme, die fast nie Pause machte, all das bezauberte ihn. Selbst wenn sie Gassenhauer trällerte, die sie aus den Vaudevilleaufführungen in den Cafés kannte oder auf der Straße aufgeschnappt hatte, ertrug er es mit Fassung, auch wenn ihr Gesang falsch war und ihr Papagei manchmal mit einstimmte. Der Vogel war ihr ganzer Stolz. Waren Papageien einst nur bei Königen und im hohen Adel als Statussymbol verbreitet, war ihre Haltung inzwischen im aufstrebenden Bürgertum große Mode. Exotik, die Fähigkeit, die menschliche Stimme nachzuahmen, all das machte dieses Tier zu einem lebenden Schmuckstück und Objekt der Phantasie. Ein Blick durch die engen Stäbe einer Volière glich einer Reise in die undurchdringliche Wildnis südamerikanischer Regenwälder. Nicht zuletzt hatte Defoes berühmter Roman diese Mode befördert. Poll, der geschwätzige Redepartner Robinson Crusoes, war das Urbild des kommunikativen Papageien. Der geräuschempfindliche Dichter hatte Mathildes ersten Papagei mit Rattengift umgebracht und dann aus schlechtem Gewissen einen Nachfolger erstanden. Er hieß Cocotte, nicht etwa nach dem beliebten Schmortopf oder dem metaphorischen Ausdruck für eine Prostituierte. Henri hatte sich vielmehr damals ›Die Geheimnisse von Paris‹ von Mathilde vorlesen lassen und deshalb den Vogel nach einem Papageien diesen Namens aus dem Roman von Eugène Sue getauft. Inzwischen bereute er den Kauf, denn das Tier war noch lauter als sein Vorgänger.
Bei den frivolen Stellen der Liedtexte lächelte Henri manchmal anerkennend. Er bewunderte an Augustine die Natürlichkeit, mit der sie selbst die schmutzigsten Formulierungen reinwusch. Offensichtlich hatte er sich wieder einmal hemmungslos verliebt. Aber diesmal war ihm dieses Gefühl nicht geheuer. Es konnte mehr daraus werden als ein bloßes Abenteuer.
Vor so viel bäurischer Anmut war er damals auf den Landsitz einer Freundin, der schönen Principessa Cristina Belgiojoso geflohen, um Billard zu spielen, gut zu speisen und zu trinken, um den Salonlöwen zu geben und die Mésalliance mit der Schuhverkäuferin zu vergessen. Auf langen Spaziergängen mit der Principessa durch den nahe gelegenen Wald diskutierte er über das rätselhafte Phänomen der Liebe. Er gestand, dass er seine Gefühle nicht beherrschte, dass sie ihn attackierten wie wilde Tiere, die nur auf den ersten Blick wie harmlose Kätzchen ausgesehen hatten. »Ich fürchte, ich habe in der Liebe einen schlechten Geschmack«, sagte er einmal. »So scheint es mir auch diesmal zu sein. Gerade weil meine Kleine so wenig zu mir passt, so wenig meinen Ansprüchen an Konversation, an Lebensstil genügt, bin ich in sie hoffnungslos vernarrt. Ich fürchte, es ist eine echte amour fou. In Sie hingegen, die so schön sind und so voller Esprit, könnte ich mich nie verlieben. Es wäre eine Art Pleonasmus der Gefühle.« – »Sie Ärmster«, erwiderte die Principessa und hakte ihren Gast unter. »Sie leiden einfach zu gerne. Und doch haben wir uns einmal geliebt, auch wenn es nur ein flüchtiger Augenblick war.«
»Wie ist es zu diesem Augenblick, wie Sie sagen, eigentlich gekommen?«
»Ganz einfach. Sie waren betrunken, und ich war gelangweilt. Eine treffliche Mischung für derlei Begebnisse.«
Sie hatten inzwischen das linke Ufer des Seinebogens erreicht. Henri starrte in die langsam vorbeiziehende Strömung. »Flüsse sind gnadenlose Symbole für das Vergehen der Zeit. Ich mag sie deshalb nicht. Wie viel schöner ist doch das Meer, denn es ist ein Symbol der Ewigkeit.«
Das Ereignis, auf das die Principessa anspielte, war erst ein Jahr her. Er war damals auf eine Soirée eingeladen worden, in der Rue d’Anjou, in der auch der berühmte General Marquis de La Fayette wohnte. Seit Henri Heine in Paris lebte, wurde er in der Gesellschaft herumgereicht wie ein Gegenstand, der allgemeine Neugier erweckte. Die Gastgeberin, Cristina Belgiojoso, war eine Mailänder Prinzessin, die nach Paris emigrieren musste, weil sie zum Risorgimento gehörte. Sie teilte mit La Fayette die Liebe zur Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, die der General einst im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg verteidigt hatte. La Fayette hatte ein Faible für Dichter mit fortschrittlichen Ansichten. Er hatte Henri in ihren Salon eingeführt. An diesem Tag war er jedoch nicht zu der Soirée gekommen, denn er schlug seine letzte Schlacht, bei der er wenige Wochen später unterlag. Er starb am 20. Mai 1834 im Alter von 76 Jahren.
Als Henri damals eintraf, hörte er schon auf der Straße Klavierklänge. Sie waren seltsam bizarr. So etwas hatte er noch nie gehört. Beim Eintreten erkannte er in dem Pianisten Franz Liszt, 23 Jahre alt, ein Schwarm der Frauen und ein umstrittener Künstler. Er spielte den von ihm verfertigten Klavierauszug der ›Symphonie Fantastique‹ seines Freundes Hector Berlioz. Spielen war nicht das richtige Wort. Er zelebrierte das Stück auf eine ekstatische Weise. Seine ganze Person, nicht nur die Hände, auch die Arme, die Ellbogen, der Oberkörper, die wild herabhängenden Haarsträhnen, die lange Nase, die funkelnden Augen, die unter der Tastatur tanzenden Beine bewegten sich konvulsivisch zu den Klängen. Die Töne...
| Erscheint lt. Verlag | 13.7.2020 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | 19. Jahrhundert • Dichter • eBooks • Frankreich • Heinrich Heine • Paris • wahre Begebenheiten |
| ISBN-10 | 3-641-26503-7 / 3641265037 |
| ISBN-13 | 978-3-641-26503-8 / 9783641265038 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,9 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich