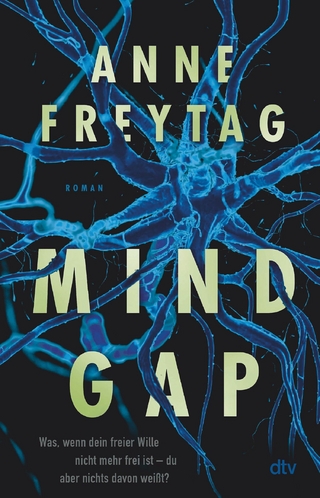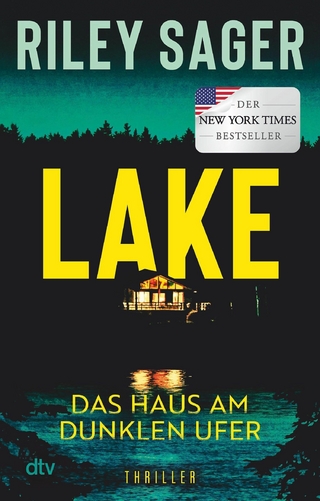Die Spur führt nach Aqaba. Thriller (eBook)
404 Seiten
Verlagshaus Hernals
978-3-902975-46-1 (ISBN)
Der antike Historiker Flavius Josephus schilderte 93 n. Chr. in seinem Werk „Jüdische Altertümer" die Geschichte des jüdischen Volkes. Zwei Abschnitte daraus, genannt Testimonium Flavianum, beschreiben den historischen Jesus, seine Wunder und bezeichnen ihn sogar als den Messias. Es berichtet also ein Historiker - und kein Christ - von der Göttlichkeit Jesu.
Seit Jahrhunderten tobt ein erbitterter Streit darüber, ob diese Passagen von Christen nachträglich in das Werk von Flavius Josephus eingefügt wurden.
Theodor Tomandl erzählt nun die Geschichte des Historikers Tom Grader, der vom Erkenntnistrieb besessen, alle wissenschaftlichen Konventionen außer Acht lässt, um die Echtheit dieses antiken Textes zu beweisen. Er gefährdet seine Familie und riskiert seine Karriere. Sein Weg führt dabei von Chicago nach Trier, in ein russisches Kloster, auf den Berg Athos, nach Ägypten und schließlich nach Aqaba. Der ewige Konflikt zwischen dem Glauben und wissenschaftlicher Erkenntnis begleitet ihn dabei. Es gelingt ihm, die Spekulationen um das Testimonium Flavianum zu beenden. Aber ist das den Preis wert, den Grader dafür bezahlen muss?
2. KAPITEL
Trier
Trier, die Stadt, die Kaiser Konstantin der Große zur Hauptstadt des Weströmischen Reiches erhoben hatte, war ein Erlebnis. Aber dieser Kongress! Bisher eine einzige Enttäuschung. Der Saal besaß die Ausstrahlung einer Bahnhofshalle. Ein unbequemer Klappsessel bügelte Falten in meinen Allerwertesten. Nur der kalte Luftstrahl, der aus dem dünnen Schlitz im Pult kam, verhinderte, dass mein müder Kopf auf das Tischbrett sank. Zu spät ins Bett gekommen und zu viel Alkohol! Das waren zwangsläufige Zutaten bei Kongressen. Doch das dürfte einem Tom Grader nichts anhaben. Ein begeisternder Vortrag hätte mich wach gehalten. Bisher gab es den allerdings nicht. Gelangweilt ließ ich meinen Blick durch den Saal schweifen, bis er auf die wie Schwalbennester an der Stirnwand hängenden Kabinen der Dolmetscher fiel. Ich beobachtete das Spiel der Hände, mit dem die Übersetzer ihre Versuche begleiteten, den Vortragstext in verschiedenen Sprachen wiederzugeben. Eine junge Frau fiel mir durch ihre besonders graziösen Bewegungen auf. Plötzlich fuhr es wie ein Blitz durch meinen Körper. In ihren Bewegungen sah ich Ruth vor mir, wie sie hingebungsvoll ihre Geige spielte. Sie hatte auch dieselben pechschwarzen Haare wie Ruth. Das war mir zunächst nicht aufgefallen, weil sie zu einem Pferdeschwanz gebunden waren, was Ruth verabscheute. Die Kabine war zu fern, um ihr Gesicht genau zu erkennen oder an ihren Lippen abzulesen, in welche Sprache sie übersetzte. Meine Mutter war in Deutschland aufgewachsen und hatte mit uns Kindern Deutsch gesprochen, daher beherrschte ich ihre Muttersprache wie meine eigene. Ich hatte daher die Gelegenheit beim Schopf gepackt und die deutsche Übersetzung eingestellt. Sie stammte nicht von der jungen Frau. Ihre Gestik passte nicht zu dem deutschen Text. Ich nahm die Fernbedienung zur Hand und wählte den englischen Kanal. Bingo! Das war sie. Ihr Englisch hatte einen leichten Akzent, den ich nicht einordnen konnte. Die Stimme war hell und einnehmend. Keine Spur des leicht rauchigen Timbres meiner Frau. Ihre Übersetzungen kamen fließend. Mir fiel jedoch auf, dass ihr einige Fachausdrücke Schwierigkeiten bereiteten. Sie verbarg das geschickt, aber einem Kenner der Materie konnte sie nicht verheimlichen, dass sie nicht vom Fach war. Trotz dieses Mankos traf sie den Kern der Aussagen mit ziemlicher Sicherheit. Wie oft hatten mich bei Kongressen die Übersetzungen zur Verzweiflung gebracht. Verfiel der Vortragende in die verbreitete Unsitte, schnell zu sprechen, konnte man die Kopfhörer getrost weglegen. Mit den verstümmelten Sätzen, die der Übersetzer dann von sich gab, war nichts anzufangen. Selbst bei Sprachen, die ich nur schlecht verstand, erfasste ich den Sinn der Aussagen meist besser, wenn ich auf die Simultanübersetzung verzichtete und dem Redner zuhörte. Zu meiner Freude schaffte es die junge Frau jedoch, die wichtigen Aussagen zu vermitteln. Überflüssiges rhetorisches Beiwerk überging sie einfach.
Als Fjodor Valenski ans Rednerpult trat, richtete ich meine Aufmerksamkeit auf ihn. Er war in den besten Jahren, groß gewachsen, schütterer Haarwuchs, Denkerstirn und randlose Brille. Wie so oft erwies sich ein renommierter Forscher als miserabler Redner. Seine historische Einleitung war so trocken, dass ich die das Rednerpult umrahmenden Blumen bereits verdorren sah. Ich musste gähnen, was mir einen strafenden Blick meines Sitznachbarn eintrug. Ein rascher Rundblick über die Gesichter in den nur spärlich besetzten Reihen bewies mir, dass ich mit meiner Einschätzung des Vortrags nicht allein war. Die Nüchternheit und Kälte des Vortragssaals verstärkte meine schlechte Laune. Ich hatte gute Lust, es den meisten anderen Kongressteilnehmern gleich zu tun und mir lieber die Stadt anzusehen. Doch dann gewann die Disziplin die Oberhand und ich zwang mich, dem Mann zuzuhören. Nach dem Gespräch mit Smithers hatte ich mich über diesen slavischen Josephus eingelesen. Ich wusste daher bereits, dass damit eine altslavische Version des Jüdischen Krieges bezeichnet wurde. Das Besondere an ihr waren die zahlreichen Abweichungen von den griechischen und lateinischen Fassungen. Eine von ihnen hatte für mich den Ausschlag gegeben, nach Trier zu fahren. Der slavische Jüdische Krieg enthielt nämlich auch das Testimonium Flavianum, das Josephus nach allen sonstigen Quellen nicht in dieses Werk, sondern in die Jüdischen Altertümer eingefügt hatte. Valenski ging nun auf diese Version ein. Sie beginne wie der Standardtext. „Damals erschien ein Mann, wenn es auch erlaubt ist, ihn einen Mann zu nennen."
In der Folge weiche der Text jedoch ab. Obwohl nur die Natur und Gestalt Jesu menschlich gewesen sei, werde der Autor ihn nicht einen Engel nennen. Jesus hätte durch eine unsichtbare Kraft wunderbare Schaustücke gewirkt.
„Die einen sagten von ihm: ,Unser erster Gesetzgeber ist auferstanden von den Toten und hat viele Heilungen und Künste erwiesen.' Die andern aber meinten, dass er von Gott gesandt sei."
Der Text gehe dann darauf ein, dass sich Jesus in vielem dem Gesetz widersetzt und den Sabbat nicht eingehalten habe.
„Und viele aus der Volksmasse folgten ihm nach und hörten auf seine Lehre. Und viele Seelen gerieten in Bewegung, meinend, dass dadurch sich befreien könnten die jüdischen Stämme aus den römischen Händen."
Die folgenden Passagen behandelten Jesu Gewohnheiten, die Reaktion der Juden auf seine Worte und die Anklage der jüdischen Priester. Valenski wies dann auf einen Widerspruch zu den Evangelien hin. Der Text berichte nämlich, Jesus sei von Pilatus zunächst freigelassen worden, weil er sein sterbendes Weib geheilt hätte. Als Jesus daraufhin seine Predigt wieder aufgenommen habe, hätten die Gesetzeslehrer Pilatus 30 Talente gegeben, damit er ihn töte.
„Und jener nahm es und gab ihnen Freiheit, damit sie selbst ihren Willen ausführen möchten. Und jene ergriffen ihn und kreuzigten ihn gegen das väterliche Gesetz."
Als Besonderheiten des Slavischen Josephus bezeichnete Valenski, dass sich in diesem Text einerseits Zusätze fänden, die in der Standardfassung nicht enthalten sind, andererseits aber zwei wesentliche Aussagen über Jesus fehlen, die im Verdacht stünden, erst später eingefügt worden zu sein: nämlich er sei „der Christus" und sei nach drei Tagen von den Toten auferstanden. Nun endlich besaß Valenski meine volle Aufmerksamkeit. Wie würde er diese Unterschiede erklären? Er begann damit, dass manche vermuteten, die Übersetzer hätten als Vorlage einen aramäischen Text verwendet, und zwar entweder in seiner Urfassung oder in einer griechischen Überarbeitung. Das sei jedoch nicht gesichert. Die verschollene Urfassung des slavischen Josephus stamme vermutlich aus dem 10. Jahrhundert. Die ältesten erhaltenen Handschriften wurden erst 500 Jahre später angefertigt. Für diese lange Zeitspanne gebe es keinen einzigen Hinweis auf die Textüberlieferung. Die Erfahrung mit anderen antiken Schriften lege daher eher die Vermutung nahe, dass die Kopisten den Text bewusst oder ungewollt verändert hatten.
Ich hatte also eine Niete gezogen. Auch Valenski verfügte über kein neues Quellenmaterial. Als ich mich erheben und den Saal verlassen wollte, brachte er jedoch eine unerwartete Note in Spiel. Neue sprachwissenschaftliche Untersuchungen deuteten darauf hin, dass das Testimonium mit großer Sicherheit nicht in Russland übersetzt wurde, wie man bisher angenommen hatte, sondern im damaligen kulturellen Zentrum der Südslaven, in Bulgarien. Das war mir neu. Sollte ich auch Bulgarien in meine Recherchen einbeziehen? Valenski gab mir keine Zeit, mir darüber den Kopf zu zerbrechen. Denn er kam nochmals auf die Frage zurück, ob es vielleicht doch eine aramäische Grundlage gegeben habe. Er verneinte sie schlichtweg. Dagegen sprächen neue computergestützte Untersuchungen des gesamten Textes. Sie hätten ergeben, dass die Übersetzer alle nichtgriechischen Namen in griechischer Schreibweise übernommen und viele griechische Lehn- und Fremdwörter verwendet hatten. Das sei ein eindeutiger
Beweis dafür, dass sie einen griechischen Text benutzt hatten. Man müsse daher davon ausgehen, dass ihr Werk später von Kopisten durch christologische Zusätze verfälscht wurde. In Verdacht stehe eine Sekte, die Valenski „judaisierende Christen" nannte, die ihr Zentrum im Kirillo-Belosersk-Kloster besaßen, von dem bekannt ist, dass in ihm Handschriften des Josephus kopiert wurden.
Meine ohnedies geringe Erwartung, von neuen Handschriftenfunden zu erfahren, hatte sich also nicht erfüllt. Ich nahm aber zumindest die Möglichkeit wahr, in der abschließenden Diskussion einige Fragen an Valenski zu richten.
„Haben Sie eine Erklärung, warum sich das Testimonium Flavianum nur in der slavischen Fassung im Jüdischen Krieg findet?"
Valenski nahm einen Schluck Wasser, bevor er zur Antwort ansetzte. „Das ist eine sehr wichtige Frage. Wir sind auf Vermutungen angewiesen. Josephus schreibt im Prolog zum Jüdischen Krieg, er habe noch vor der Niederschrift dieses umfassenden Werkes einen Bericht in seiner eigenen Sprache für jene Juden verfasst, die unter Parthern und Babyloniern lebten und von den Geschehnissen in Palästina nur wenig Kenntnis hatten. Seine eigene Sprache war Aramäisch. Dieser Bericht ist zwar verschollen, dürfte im Osten aber weit...
| Erscheint lt. Verlag | 9.3.2020 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Krimi / Thriller / Horror |
| ISBN-10 | 3-902975-46-6 / 3902975466 |
| ISBN-13 | 978-3-902975-46-1 / 9783902975461 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 522 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich