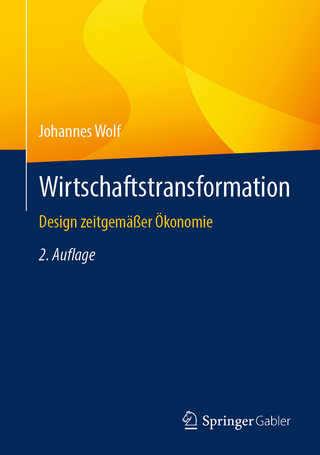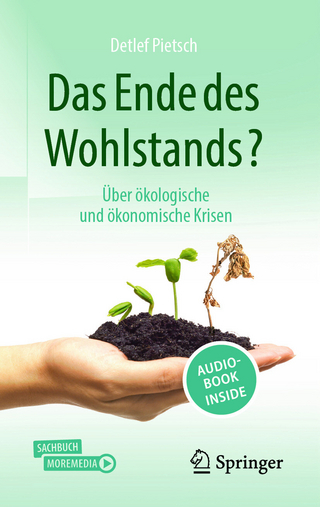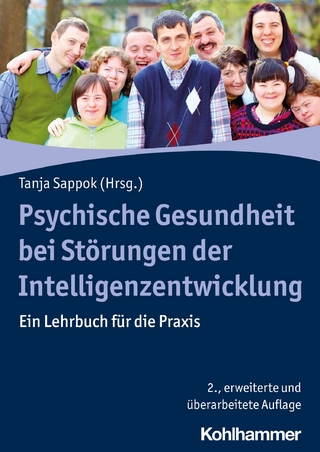Heimliche Jagd (eBook)
264 Seiten
Books on Demand (Verlag)
978-3-7504-5965-6 (ISBN)
Peter Bürger, geb. 1961, Kriegsdienstverweigerer (Zivildienst), Theologiestudium in Bonn, Paderborn, Tübingen (Diplom 1987); examinierter Krankenpfleger; psycho-soziale Berufsfelder, ab 2003 freier Publizist (Düsseldorf). Seit dem 18. Lebensjahr Mitglied der internationalen katholischen Friedensbewegung pax christi, später auch: Versöhnungsbund, DFG-VK, Solidarische Kirche im Rheinland (ev.), Bund der Antifaschisten (VVN-BdA). Themenschwerpunkte u.a.: Kirche der Armen, Krieg & Massenkultur, pazifistische Beiträge zur Regional- und Kirchengeschichte, christliche Friedensdiskurse. Bertha-von-Suttner-Preis 2006 (Kunst & Medien). Drei Preise für die Forschungen zur niederdeutschen Mundartliteratur des Sauerlandes. Buchveröffentlichungen zur "Wilderei in Westfalen" bislang: "Fang dir ein Lied an" (2013), "Hermann Klostermann. Der populärste Wilddieb Westfalens" (2018) und "Krieg im Wald" (Hg., 2018). - Internet: www.friedensbilder.de - www.sauerlandmundart.de
I.
Entwicklung von Hoheitsrechten
in den kölnischen Ämtern
Waldenburg und Bilstein
des Herzogtums Westfalen
Auseinandersetzungen um das Jagdregal57
Wingolf Scherer
Als Heinrich der Löwe auf dem Hoftage zu Gelnhausen 1180 seine Herzogtümer Sachsen und Bayern verlor, wies Kaiser Friedrich I. Westfalen und Engern – soweit dieser südwestliche Teil des Herzogtums Sachsen in den Diözesen Köln und Paderborn lag – dem Erzbischof von Köln Philipp von Heinsberg (1167-1191) zu. In diesem von Köln entfernt gelegenen Territorium, erst nach der Eingliederung der Grafschaft Arnsberg Herzogtum Westfalen genannt,58 landesherrliche Rechte durchzusetzen und in Anspruch zu nehmen, erforderte viele Jahrzehnte, in denen sich zudem auch herbe Rückschläge einstellten. Die reichsrechtliche Grundlage der Landesherrschaft ergab sich 1220, als Kaiser Friedrich II. in der „confoederatio cum principibus ecclesiasticis“ königliche Rechte zunächst auf die erstmals „domini terrae“ (Landesherren) genannten geistlichen Reichsfürsten übertrug.59 Engelbert von Berg, Erzbischof von 1216 bis 1225, suchte seiner Landesherrschaft gegenüber dem landsässigen Adel nachdrücklich Geltung zu verschaffen; er sicherte seine Rechte im südlichen Sauerland vor allem durch die Stadterhebung Attendorns 1222. Erzbischof Konrad von Hochstaden (1238-1261) festigte mit der 1248 von Sayn angekauften Waldenburg60 seine Landeshoheit im Biggetal und schuf damit den Sitz des kurkölnischen Amtes Waldenburg, das sich zwischen den Territorien der Grafen von Nassau, von Berg, Mark-Altena, Arnsberg und der Edelherren von Bilstein halbbogenförmig von Süden nach Norden erstreckte. Natürlich konnte sich die verwaltungsförmliche Einheitlichkeit des Amtes Waldenburg nur über einen längeren Zeitraum hin voll entwickeln. Erst gegen Ende des 14. Jahrhunderts war sie hergestellt. 1346 ist Waldenburg als Amtsort genannt.
1.
WEITERER AUSBAU
DER KÖLNISCHEN LANDESHERRSCHAFT
Die Erzbischöfe vermochten noch im 13. Jahrhundert ihre Herrschaft gegenüber dem niederen Adel durchzusetzen. Die Adelsgeschlechter, von denen hier nur die von Plettenberg, Vogt von Elspe, Schnellenberg, Ewig, Heggen, Hersebeke (Hespecke), Waldenburg und Drolshagen61 genannt seien, wurden formal zu kölnischen Ministerialen. Die Edelherren von Bilstein im Osten, vor allem aber die Grafen von Mark-Altena im Westen des Amtes Waldenburg, errangen und behaupteten ihre Selbständigkeit. In diesem Zusammenhang muß darauf verwiesen werden, daß zum einen jede Landesherrschaft sich letztlich auf Grundbesitz und die Ausübung von Hoheitsrechten, Regalien also, stützte und zum anderen scharf umrissene territoriale Grenzen sich erst in längeren Prozessen herausbilden konnten. An den Rändern der Territorien ergab sich insoweit eine Gemengelage, die von unterschiedlichen Ansprüchen bestimmt wurde. In der Grafschaft Altena, von den Erzbischöfen zu dem ihnen 1180 übertragenen Hoheitsbereich gezählt, setzte unter den Grafen Arnold und Friedrich, deren Bruder Adolf von Altena 1193 bis 1205 als Erzbischof in Köln regierte, eine Entwicklung ein, in deren Verlauf die hohe Gerichtsbarkeit und das Befestigungsrecht für die Mark nicht nur gefordert, sondern auch tatsächlich ausgeübt wurden. Konrad von Hochstaden trat dem entgegen; sein Nachfolger beendete 1265 die Auseinandersetzungen zunächst zuungunsten der Grafschaft: Weitere Befestigungen blieben ohne Zustimmung des Erzbischofs untersagt. 1278 konnte sich die Mark der Entfestigung von Lüdenscheid nur dadurch entziehen, daß die Stadt dem Erzbischof zu Lehen aufgetragen wurde. Die Mauern von Kamen und Iserlohn waren niederzulegen. Der junge Graf Eberhard II. (1277-1308) sah sich gezwungen, die Oberhoheit Kölns anzuerkennen.
2.
ERFOLGE DER GRAFEN VON DER MARK
IM KAMPF UM DIE GLEICHBERECHTIGUNG
Mit der Schlacht von Worringen 1288, in der Erzbischof Siegfried von Westerburg (1275-1296) in die Gefangenschaft seiner Gegner geriet, unter ihnen die Grafen Adolf von Berg und Eberhard von der Mark, wendete sich das Blatt. Im Sühnevertrag von 1289 verzichtete der Erzbischof auf alle Ansprüche, insbesondere auf jede Entschädigung für erlittene Verluste. Zudem mußte er Burg Waldenburg pfandweise dem Grafen Adolf von Berg überlassen, der die Burg an Eberhard von der Mark weiterverpfändete. Wegen der so entstandenen prekären Situation ließ Siegfried von Westerburg durch seinen Landmarschall Johann von Plettenberg Burg Schnellenberg bei Attendorn instandsetzen, um von dort gegebenenfalls Ausfälle in die Mark unternehmen zu können. Daraufhin verstärkte der märkische Drost Rudger von Altena die Waldenburg und setzte dem Schnellenberg und Attendorn hart zu. Endlich gelang es dem Nachfolger Siegfrieds, Burg Waldenburg im Jahre 1300 wieder einzulösen. Amtmann von Waldenburg wurde Johann von Plettenberg.62 Von nun an galten „dominium et terra“ (Herrschaft und Land) von Köln und Mark als gleichberechtigt.63 Die Grafen von der Mark konnten unangefochten Burgenbauten und Städtegründungen vornehmen. Sie strebten nach der Festsetzung der gemeinsamen Grenze und der Wahrnehmung der Gerichtsbarkeit auch in den Grenzräumen. Spätere Versuche Kölns, Zugeständnisse zurückzunehmen, blieben erfolglos. So gelang es den Grafen von der Mark, die Entwicklung ihrer Landeshoheit um 1300 abzuschließen.
Einen weiteren wichtigen Erfolg errang Graf Engelbert III. (1347-1391), als er 1365/67 die Gelegenheit nutzte, das Erbe der Edelherren von Bilstein, die schon in der Auseinandersetzung um Burg Waldenburg auf der märkischen Seite gestanden hatten, im Lande Bilstein und Fredeburg an sich zu bringen. Damit umklammerte märkisches Territorium das Amt Waldenburg im Osten und Westen.
3.
BEANSPRUCHUNG VON REGALIEN
Zu den 1220/1231 auf die Reichsfürsten übertragenen Regalien (Königsrechten) zählten insbesondere das Befestigungsrecht und damit die Befugnis zur Städte- und Burgengründung, das Markt- und Münzrecht, das Geleitrecht, der Forst- und Wildbann sowie die hohe (Strafen an Leib und Leben) und niedere Gerichtsbarkeit. Die Reichsgesetze der beiden Jahre eröffneten freilich nicht erst die Ausübung landesherrlicher Hoheit, sie legalisierten vielmehr zumeist einen bereits eingetretenen Zustand. So war etwa Attendorn schon vor seiner Stadterhebung 1222 mit Gräben und Mauern befestigt. In der Attendorner Münzstätte wurden die ersten Pfennige und Vierlinge bereits zur Zeit des Erzbischofs Dietrich von Heinsberg 1208 bis 1212 geprägt.64 Die Grafen von der Mark dagegen errichteten ihre erste Münzstätte erst 1268, und zwar in Hamm.
Was die Gerichtsbarkeit angeht, bedarf es des Hinweises auf eine westfälische Eigentümlichkeit: Neben den landesherrlichen Gogerichten und den städtischen Gerichten behaupteten sich die Freigerichte (Femegerichte), deren Freigrafen in der Tradition des karolingischen Königsbanns ihre Rechtsprechungskompetenz allein der königlichen Bestätigung verdankten. Die Landesherren konnten allerdings, soweit sie die Stuhlherrschaft über Freigerichte an sich gezogen hatten, ihr Vorschlagsrecht für die Ernennung von Freigrafen durch den König ausüben. Bis in das Spätmittelalter konkurrierten die Rechtssysteme der Frei- und der Gogerichte. Schließlich aber überdauerte die von den landesherrlichen Gografen vertretene Gerichtsbarkeit die „königliche“ Rechtsübung der Freigrafen.65
4.
DIE GOGERICHTSBARKEIT
ALS INSTRUMENT DER LANDESHERRSCHAFT
Die Gogerichtsbarkeit in Waldenburg und in der Mark bezog sich seit der Mitte des 13. Jahrhunderts auf die sogenannten pfleghaften Untertanen, also auf alle Untertanen, die zu ihrer Herrschaft in irgendeinem Abhängigkeitsverhältnis standen. Daneben entwickelten sich die Freigerichtsbarkeit über die Freien sowie die Zuständigkeit besonderer Gerichte in den geschlossenen Ortschaften (Freiheiten) und Städten.
Der erste Gograf in Waldenburg mit Sitz in Attendorn – die Verhandlungen fanden außerhalb der Stadtmauern unter freiem Himmel statt – dürfte der 1244 und 1249 bezeugte Godefridus gewesen sein. Sein Gogerichtsbezirk umfaßte im Grenzraume zur Grafschaft Mark auch die Kirchspiele Valbert und Meinerzhagen. Die Grafen von der Mark beanspruchten hier zunächst die Gerichtsbarkeit über die märkischen Leute, brachten dann aber die hohe und niedere Gerichtsbarkeit des Erzbischofs in Meinerzhagen gewaltsam an sich. Der Gograf in Attendorn setzte den Verbleib Valberts bei seinem Gerichtsbezirk durch, so daß dieses Kirchspiel als kölnisch-märkisches Kondominium bezeichnet wurde.
Der kölnische Anspruch auf die hohe Gerichtsbarkeit in Meinerzhagen veranlaßte nach Wilhelm Janssen den Erzbischof Heinrich von Virneburg (1306-1332), zur Stärkung seiner Machtposition im angrenzenden Raume Olpe 1311 mit den Stadtrechten Attendorns zu bewidmen und die neue Stadt zu befestigen. Einen weiteren Grund für die Stadterhebung Olpes sieht...
| Erscheint lt. Verlag | 12.3.2020 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung |
| ISBN-10 | 3-7504-5965-7 / 3750459657 |
| ISBN-13 | 978-3-7504-5965-6 / 9783750459656 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 5,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich