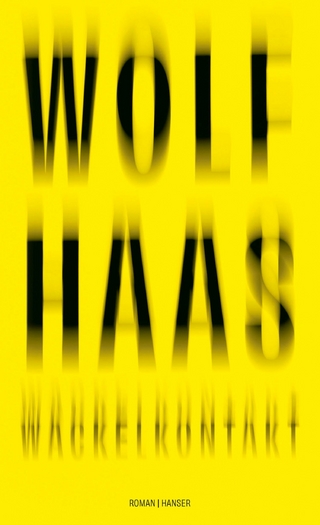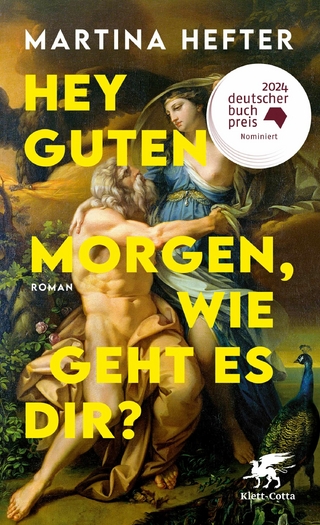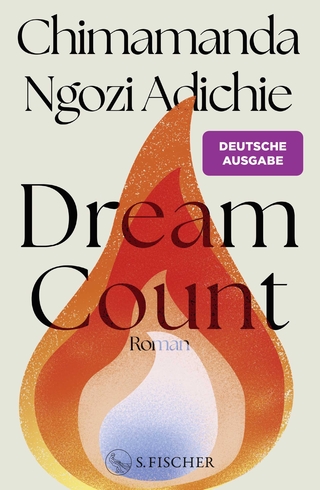Eine Tür aus Glas, weit offen (eBook)
288 Seiten
Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
978-3-446-26666-7 (ISBN)
'Er war und ist einer der großen Dichter der deutschen Nachkriegsliteratur' (Die Welt). In seiner jetzt zum ersten Mal aus lang vergessenen Quellen gesammelten Prosa spricht Christoph Meckel von seiner Arbeit und seinem Leben, von der Poesie, der Kunst, von Weggefährten und von dem, 'was noch nicht gemacht ist'. Hier wird erzählt vom bucklicht Männlein, das schon durch die Kinderträume geistert, und von Monsieur Bernstein, von dem, was ein Dichter tut, und wie er selbst einer geworden ist. 'Eine Tür aus Glas, weit offen' zeigt die große Spannweite des Schriftstellers Christoph Meckel, dicht am eigenen Leben und doch mit der ganzen Weite der Poesie.
Christoph Meckel, 1935 in Berlin geboren, wurde u. a. mit dem Rainer-Maria-Rilke-Preis für Lyrik, dem Georg-Trakl-Preis für Lyrik, dem Joseph-Breitbach-Preis und zuletzt 2016 mit dem Hölty-Preis für sein lyrisches Lebenswerk sowie 2018 mit dem Johann-Peter-Hebel-Preis und dem Lyrikpreis Orphil der Landeshauptstadt Wiesbaden ausgezeichnet. Bei Hanser erschienen zuletzt Einer bleibt übrig, damit er berichte (Erzählungen, 2005), Seele des Messers (Gedichte, 2006), Nachtsaison (Erzählungen, 2008), Gottgewimmer (Gedichte, 2010), Luis & Luis (Erzählungen, 2012), Tarnkappe (Gesammelte Gedichte, 2015) und Kein Anfang und kein Ende (Zwei Poeme, 2017). Christoph Meckel starb am 29. Januar 2020 in Freiburg.
Merkmal Miniaturen
Peter Ackermann
Peter Ackermann starb am 20. Februar 2007 in Valecchie, seinem Haus bei Cortona, Provinz Arezzo, an der Krankheit zum Tode: atypisches Parkinson-Syndrom, eine Lungenentzündung kam dazu. Er war 73 Jahre alt. Als ihm die Diagnose mitgeteilt wurde, war die Krankheit weit fortgeschritten, wahrnehmbar für jeden außer für ihn. Er nahm die Verurteilung mit Hoffnung auf sich, vielleicht, weil eine Vorstellung von Zukunft und Abgang dieser Art ihm fehlte. Es war von Medikamenten, von möglicher Operation die Rede, die Verzweiflung kam später, gab ihn nicht mehr frei. Er lebte noch sieben Jahre, in Karlsruhe – er war an der Kunstakademie Professor gewesen –, wurde immer mal wieder von Freunden nach Cortona gefahren und von dort nach Deutschland zurück. Er nahm an Vernissagen seiner Ausstellungen teil – die gezeigten Arbeiten waren lange her –, abseits sitzend mit Stock, von starken Medikamenten in Ruhe gehalten, sprach immer undeutlicher, wortkarg, leise, versuchte noch zu malen. Seine letzten Bilder, Ölbilder, Aquarelle, waren kleine Formate, Lufträume, Lichtflächen, farbige Leere mit Resten von Land oder Boden, verstreuten Chiffren. Er sagte: Gleichgültig, ob ich noch male oder nicht, das Werk ist da. Während einer Ausstellung zum 70. Geburtstag, Galerie in Mainz, saß ich neben ihm in einer Ecke. In zitternder Erregung stieß er den Stock auf das Parkett und rief, ein geflüsterter Schrei: Verflucht, dass ich geboren bin! Heftiger als alles, was ich von ihm hörte, es dauerte lange, bis er zur Ruhe kam.
Zu den Radierungen
In den sechziger und siebziger Jahren – Inflationszeit der europäischen Graphik – war Peter Ackermanns Werk in hohen Auflagen verbreitet und weithin verfügbar. Er gehörte zur Phalanx der Sichtbaren, eine unabhängige Gestalt, Meister der Radierung, bekannter Maler, möglicherweise ein Fall von Ruhm. Für 150 Mark kaufte ich ein großes Format in einer entlegenen, dunklen Galerie unter der S-Bahn nach Berlin-Kreuzberg, und das war bezeichnend: Auch in kleinen Läden lagen seine Blätter obenauf. Das ist lange her. Peter Ackermann hat aus dieser für ihn offenen Chance im Vordergrund der Zeit und des Kunstgeschäfts keine Karriere gemacht. Ihm wäre so was unbehaglich gewesen, er hätte nicht gewusst, wie man das macht. Und er verfiel nicht in athletisch gesteigerte Produktion, die so lange mit der Gewissheit von Geld und Erfolg unschlagbar einherging. Er gehörte weiter sich selbst und seiner Sache, wurde lieber Professor an einer Akademie, mit dem zunehmend sichtbaren Ergebnis einer nicht angreifbaren Autonomie.
Peter Ackermann in einem Brief: »Am Ende meines Studiums sagte ein Freund zu mir: Du bist immer am besten, wenn du Architektur machst. Gegen dieses Diktum wehrte ich mich, wollte es nicht glauben und wahrhaben (obwohl es mir mehr und mehr gefiel, ohne Menschen, allein zu sein). Viele der Kritiker fragten mich: Und wo ist der Mensch? Darauf gab ich sehr unterschiedliche Antworten, zum Beispiel sagte ich, dass sie doch alles gebaut hätten, was man auf meinen Bildern sehen könne, dass sie doch darin oder dahinter (hinter den Fassaden) wären, dass sie schließlich davorständen, um sich die Bilder anzusehen – «.
Seine Titel sind sachlich, so werden Studien benannt, genaue Angabe von Motiven: Altar und tragende Wände; Bogen, frei endend; Landschaft mit Monumenten. Was seine Bildwelt ausmacht – das Unspezifische in der Präzision, ihre Aura, ihr Rätsel –, kommt im Titel nicht vor. Es macht die Radierungen reich, die einzelnen wie ihren Zusammenhang, dass der Titel dem Bild nichts nimmt, ihm nichts hinzufügt, er ist nicht Literatur. Das Bild ist da ohne Rest.
Aus einem Brief: »Ich gehe bei jeder Abstraktion von einer Figur aus und versuche, das Bild dahin zu bringen, dass es eine zeigt. (Außerdem vermeide ich Überschneidungen von Linien, Flecken, etc.)«
Im Werk der Radierungen häufen sich Dunkelheiten und Schatten, Finsterflächen, deren Ursache nicht zu bestimmen ist. Sie scheinen sich zu durchdringen, zu überlagern – starke, glanzvoll erscheinende Verdunklung seiner Bauwerke. Fülle von Schlagschatten, deren Intensität nicht zu steigern ist (Strichätzung, Aquatinta). Türen, Fenster, Öffnungen aller Art in Schatten gepackt, von Verschattung, Verfinsterung verschlungen, die eine lebendige oder leblose, oft erschreckende Lautlosigkeit sichtbar machen. In solchen Verschattungen verschwinden ganze Bezirke seines Raumreichs. Früher hätte man vom Eingang zur Unterwelt gesprochen, dahinter Treppen in den Abgrund hinunterführen – Pluto steigt ab, Persephone auf den Armen tragend in seine Dunkelkammern. Das zu sehen und zu sagen scheint heute nicht mehr möglich, und ich bedaure es. Das Spiel mit Dämonen und Gottheiten machte Vergnügen. Es war eine gute Zeit.
Aufhören ist eine Kraft (Ingeborg Bachmann). Ackermanns Werk bis etwa 1985 ist eine Großbaustelle, auf der in 25 Jahren von ihm Bauwerke vieler Art errichtet wurden. Auf derselben Baustelle wurden danach Abbau & Abriss von ihm unternommen (eine Radierung hat den Titel Im Abriss). Der großartige Bestand an Fassade, Staffage, Kulisse und Potemkins gespenstischem Prunk, Sakral- und Profanbau, Palast und Bunker, und die Schauseiten mysteriöser Architektur, ihre Innenräume und Labyrinthe sind seither fragmentiert worden, detailliert und auseinandergenommen, in Trümmerverteilung und Verhackstücken sichtbar, zu kleinen und großen Panoramen zusammengeschoben, summierte Details ohne Umraum, Strukturen gewonnen aus Bruch und Schutt, von Materie und Material zunehmend entleert. Es bleiben Konturen zurück, Bogenrippen, Geripp gestalteter Formen, brüchige Lineamente und Kanten, Ritzen, Schattenfetzen, Ruin aller Art. Die daraus gewonnenen Abstraktionen werden weiter verkürzt, verkarstet, auf Spurenelemente von Form reduziert. Was geschieht hier.
Kann sein, es handelt sich um die große, zeitraubende Maßnahme, den nur einmal möglichen Versuch des Radierers, sich Platz zu verschaffen auf dem eigenen Schauplatz, ursprünglichen Raum zurückzugewinnen, freien, neuen Raum zur Verfügung zu haben und die Spur dieser Art von Progression als Kunst zu dokumentieren, weil man nicht anders kann. Heute sind es meist dunkle Flächen, kleine Tafeln mit Rissen von Helle, Rinnsalen aus Licht, die selten auf erkennbare Form zurückgehn. Eine Vorzeichnung liegt nicht zugrund. Tief hinuntergeschichtete Geologie aus Verwerfungen, unbekannten Substanzen. Flüchtige Signale.
Die neuen Formate sind reduziert, die Auflagen klein. Das entspricht einer realistischen Handhabung dessen, was ihm heute möglich ist. Große Formate sind nicht mehr nötig (sie kommen noch vor), weil nichts vorgezeigt, überhaupt nichts demonstriert werden soll (Peter Ackermann hat nie auf sich selbst verwiesen). Lebendigkeit in der Desillusion, die mit dem Älterwerden, dem Wechsel von Zeit und Epoche gekommen ist. Er ist nun frei, zu tun, was er tun will, ohne Aufwand, Ehrgeiz, Abnehmerschaft, ohne an Wirkung oder Verwertung zu glauben. Das setzt Selbstgewissheit anderer Art voraus, steht nicht zur Debatte.
Das Format der Radierung hat seine Logik: Es ist begrenzt. Man kann in die Extreme gehen – sehr klein, sehr groß, sofern sich das Format als organisch erweist. Das ist nicht der Fall, wenn Vergrößerung aus der Willkür kommt, von Absicht bestimmt wird.
Das Format von Graphik wird oft missbraucht. Es wird forciert, ins Verhältnislose hochgetrieben, in falsche Dimension aus fatalen Gründen – Imponiergehabe, dem Zeitgeist verpflichtet. Ehrgeiz verfälscht. Die Radierung soll mit dem Wandbild konkurrieren.
Peter Ackermann – als Radierer, Zeichner, Maler – bewältigt monumentale Formate. Die Voraussetzung ist ihm gegeben in seinen Motiven und Stoffen, in der Auffassung, im Handwerk, in den technischen Verfahren. Sein Werk enthält kleine und sehr große Formate, die als organische zu erkennen sind. Das hat Folgen für den Betrachter. Er sieht ein Bild, das mit sich selbst übereinstimmt. Sein Instinkt wird nicht gebeutelt. Das Auge bejaht, was es wahrnimmt.
Was man vor Jahrzehnten noch »Künstlertum« nannte. Und ist doch nur die Frage, wie einer das macht, mit der Kunst, der Epoche und mit sich selbst. Bei Peter Ackermann und in seinem Atelier ist von »Künstlertum« nichts zu entdecken. Selbststilisierung und so weiter – zéro. Existenz ohne Aufwand, Arbeit genug. Vielleicht wie die knappen Wortlaute alter Biographien: Meister X, 1470 –? Wirkte Anfang des sechzehnten Jahrhunderts am Oberrhein.
Im Raum, den Peter Ackermann neu erschafft, sind Motive aufgetaucht, die mich überraschen. Sie entstehen in der Wahrnehmung dessen, was täglich vor Augen ist, Ansichten italienischer Natur und Landschaft (Restnatur – seit 30 Jahren ein endzeitlicher Topos vor allem der Deutschen). Die Titel geben genaue Auskunft: Feigenbaum vor Heuhaufen; Zypresse; Obstbaum zwischen zwei Steinen; Garten in Valecchie. Es sind kleine Formate, nüchterne Poesie, die seinem Satz widerspricht: Ich bin wahrhaft ein Prosamensch. Auch hier bestimmen gewachsene und gebaute feste Formen das Geweb des Bildgeschehens: Der Haufen Heu ist rund um eine hohe Stange aufgeschichtet; der Weinstock wächst an Pfählen in die Höhe. In diesen Blättern, die still und schön sind, hat Peter Ackermann sich selbst und sein Vermögen geortet; auf unerwartete Weise neu geerdet.
Zu den Zeichnungen und Aquarellen
Auf den ersten Blick sind seine Zeichnungen nichts Besonderes. Der Satz muss begründet werden, wenn er wahr sein soll.
Die Zeichnungen sind nicht oft zum...
| Erscheint lt. Verlag | 9.3.2020 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | Engel • Erzählungen • Essay • Hugo Simberg • Kunst • #ohnefolie • ohnefolie |
| ISBN-10 | 3-446-26666-6 / 3446266666 |
| ISBN-13 | 978-3-446-26666-7 / 9783446266667 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 6,7 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich