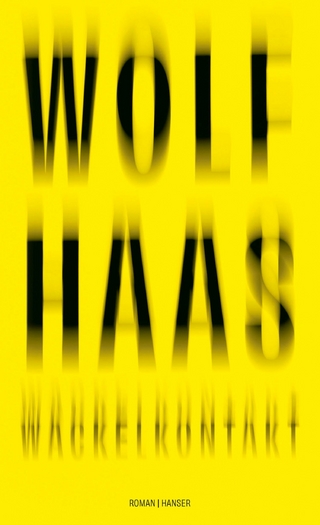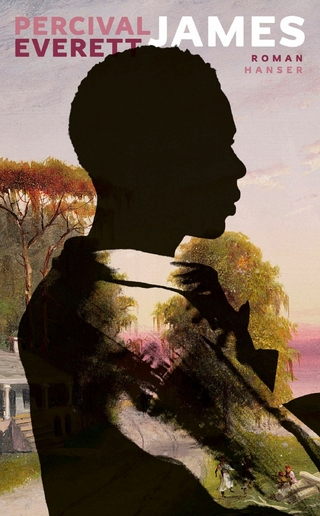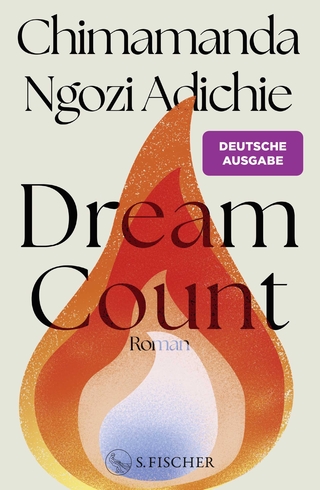Sieben Versuche zu lieben (eBook)
368 Seiten
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH
978-3-462-32132-6 (ISBN)
Maxim Biller, geboren 1960 in Prag, lebt seit 1970 in Deutschland. Von ihm sind bisher u.a. erschienen: der Roman »Die Tochter«, die Erzählbände »Sieben Versuche zu lieben«, »Land der Väter und Verräter« und »Bernsteintage«. Seinen Liebesroman »Esra« lobte die FAS als »kompromisslos modernes, in der Zeitgenossenschaft seiner Sprache radikales Buch«. Billers Bücher wurden in neunzehn Sprachen übersetzt. Bereits nach seinem Erstling »Wenn ich einmal reich und tot bin« (1990) wurde er von der Kritik mit Heinrich Böll, Wolfgang Koeppen und Philip Roth verglichen. Zuletzt erschienen sein Memoir »Der gebrauchte Jude« (2009), die Novelle »Im Kopf von Bruno Schulz« (2013) sowie der Roman »Biografie« (2016), den die SZ sein »Opus Magnum« nannte. Sein Bestseller »Sechs Koffer« stand auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis 2018. Über den Roman »Der falsche Gruß« (2021) schrieb die NZZ: »Das ist große Kunst.«
Maxim Biller, geboren 1960 in Prag, lebt seit 1970 in Deutschland. Von ihm sind bisher u.a. erschienen: der Roman »Die Tochter«, die Erzählbände »Sieben Versuche zu lieben«, »Land der Väter und Verräter« und »Bernsteintage«. Seinen Liebesroman »Esra« lobte die FAS als »kompromisslos modernes, in der Zeitgenossenschaft seiner Sprache radikales Buch«. Billers Bücher wurden in neunzehn Sprachen übersetzt. Bereits nach seinem Erstling »Wenn ich einmal reich und tot bin« (1990) wurde er von der Kritik mit Heinrich Böll, Wolfgang Koeppen und Philip Roth verglichen. Zuletzt erschienen sein Memoir »Der gebrauchte Jude« (2009), die Novelle »Im Kopf von Bruno Schulz« (2013) sowie der Roman »Biografie« (2016), den die SZ sein »Opus Magnum« nannte. Sein Bestseller »Sechs Koffer« stand auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis 2018. Über den Roman »Der falsche Gruß« (2021) schrieb die NZZ: »Das ist große Kunst.«
Polanski, Polanski
Bevor der Gast aus Moskau meine Schwester Klawdija vergewaltigte, aß er sich bei uns erst einmal richtig satt. Zur Graupensuppe gab es Piroggen mit Kartoffeln und Kohl, danach stellte Mama eine armenische Basturma auf den Tisch. Polanski riss mit dem Besteck die blutige Lende in Stücke, er tunkte sie in die dunkle, aserbaidschanische Granatapfelsoße, das Blut und die Soße spritzten über die Tischdecke und über sein Jackett, und Polanski sagte auf Russisch zu meiner Mutter: »Gesegnete Emigration, Anna Abramowna! Die Flecken auf meiner Jacke werde ich hüten wie Andenken aus dem Paradies!«
»Aber ich bitte Sie, Grigorij Michalytsch«, sagte Mama, »das bisschen Gemüse und Fleisch.«
»Nein, Anna Abramowna, sagen Sie nichts. Wann hat es bei uns so etwas das letzte Mal gegeben? Vor den Kommunisten? Nicht einmal zur Zarenzeit … Russland hungert seit tausend Jahren«, sagte Polanski mit bebender Stimme, und sie wurde noch brüchiger, bewegter, als er dann ausrief: »Ach, ich liebe jeden einzelnen Schlachter und Metzger von Berlin!«
Wir alle vier schwiegen.
»So könnte Glück schmecken«, sagte Polanski in die Stille hinein. Er füllte den Mund mit einem neuen, wieder viel zu großen Stück. Das Blut floss an seinen Mundwinkeln hinunter, es floss über sein breites, unslawisches Kinn. »Dieses Fleisch ist wie Honig, wie Mehltau, wie Gold!« Er wischte sich mit dem Ärmel ab und musterte mit seinem Kannibalenblick mich und meine Schwester. »Und diese Kinder auch«, murmelte er. »Kinder des Westens, Kinder ohne Angst, Kinder mit Zukunft!«
Die dicke Klawdija und ich sahen uns an, wir zogen unsere eingespielte Äffchen-Grimasse, und dann lächelten wir, aber Klawkas Lächeln war anders als sonst, wenn wir uns über jemanden lustig machten.
»Ich wünschte, ich könnte wie Sie ein Kreuz hinter Russland machen, Iwan Iwanytsch«, sagte Polanski zu meinem Vater. »Aber die Verantwortung, die ich habe, überwiegt alles Persönliche.«
Mein Vater nickte. »Grigorij Michalytsch«, sagte er, »trinken wir?«
»Trinken wir.«
»Von unserem Wodka oder von Ihrem?«
»Ja, glauben Sie«, rief Polanski aus, »ich habe mich in Moskau nur zum Spaß in die Schlange gestellt?!«
»Annuschka – du auch?«, sagte Vater.
Mutter sah ihn wie einen Verrückten an. »Wann«, sagte sie, »habe ich jemals etwas getrunken?«
»Und die beiden Blondschöpfchen«, sagte Polanski und zeigte auf Klawka und mich, »trinken die?«
»Nicht in meinem Haus!«, sagte Mama laut.
»Sie haben recht, Anna Abramowna. Kinder sollen niemals vergessen, dass sie keine Erwachsenen sind. So hat man es in Russland immer gehalten.«
Noch während er sprach, sprang Klawka auf und begann, die Teller zusammenzuräumen. Die Teller krachten gegeneinander, das Besteck klirrte, Klawdija stampfte um den Tisch herum, und Polanski sagte: »Habe ich die junge Dame beleidigt?«
»Unsere Klawka«, erklärte Mama, »hasst es, siebzehn zu sein, Grigorij Michalytsch –«
»Westen hin, Osten her«, rief Klawdija dazwischen, und ich fügte, damit nur sie mich verstand, leise auf Deutsch hinzu:
»Besserwisser russischer … Provinztrottel!« Doch da hörte mir Klawka gar nicht mehr zu.
»Kinder, es ist genug!«, sagte Mama.
Und Vater sagte: »Trinken wir, Grigorij Michalytsch!«
»Natürlich, Iwan Iwanytsch, wir haben das Trinken ganz vergessen!«
Die beiden leerten ihre Gläser, und Vater füllte sie gleich wieder nach. Dann redeten sie über Politik, während wir ihnen stumm zuhörten. Klawka ging mit dem Tablett in die Küche, sie kam zurück, und im Setzen rückte sie mit dem Stuhl näher an Polanski heran. Vater und er waren noch immer beim gleichen Thema.
Mein Vater ist der einzige Goj in der Familie, und er ist auch der einzige von uns vieren, dem die alte Heimat fehlt. Wir andern drei Belovs sind froh, das Ganze für immer hinter uns gelassen zu haben. Mama und Klawdija hassen Russland einfach nur, ich aber liebe Berlin, wo wir seit sechs Jahren leben. Die Vergangenheit ist für Mama, Klawka und mich kaum der Rede wert, doch Vater nutzt jede Gelegenheit, um über Russland zu sprechen. Darum lud er Polanski am Abend vor seiner Abreise auf die Schnelle noch zu uns ein.
Jetzt sprachen die beiden über den nächsten Putsch, sie sprachen über die Irren von Kasachstan, Turkmenistan und Moldawien, über die Armee und den Geheimdienst, über die Zukunft und mehr noch über die vergangenen Tage der alten Sowjetunion, und Polanski (der an dem Kongress, den die Firma meines Vaters ausgerichtet hatte, als Mitglied einer hohen Wirtschaftskommission teilgenommen hatte) ließ allmählich seinen offiziellen Ton fahren und wurde zusehends sentimental. Zum Schluss wollte Vater nur noch in seinen Erinnerungen an Russland schwelgen – Polanski aber brachte die Rede jedes Mal wieder auf die Emigration.
Vater wurde von dem Wodka immer schweigsamer. Polanskis Gesicht dagegen füllte sich mit Blut, sein wuchtiger Kiefer schien schwerer und schwerer zu werden, seine Arme auch, sie baumelten nun kraftlos an seinem Rumpf, und dann sah ich, wie Klawka einen von ihren riesigen Schenkeln plötzlich unter Polanskis herunterhängende, halbgeöffnete Hand schob. Polanski zuckte, er griff erschrocken nach Klawkas Knie, sie riss das Knie von ihm weg, zur Seite, und schlug mit den Ellbogen laut gegen den Tisch. »Oh, oh, Grigorij Michalytsch!«, rief sie aus. »Nehmen Sie Maß?«
Die Eltern sahen erstaunt zu Klawka hinüber, und ich dachte nun daran, wie mein Großvater mich früher in Moskau mit Quark, Käse und Schokoladenbutter gemästet hatte, um jeden Sonntag mit einem Band den Umfang meines Halses auszumessen. Jeder gewonnene Zentimeter wurde wie ein Sieg gefeiert, und so war ich schon bald das, was man auf Russisch voller Bewunderung einen Jungen aus Blut und Milch nennt. Als meine Schwester alt genug war, dass Großvater auch auf sie aufpassen durfte, päppelte er Klawdija innerhalb weniger Jahre auf jenes Übergewicht hoch, das sie bis heute noch hat. Ich war ein dickes Kind gewesen, Klawka aber wurde eine dicke junge Frau.
»Verzeihen Sie, Anna Abramowna«, sagte Polanski. Er sprang vom Tisch auf, bewegte den kleinen, dürren Körper, der so ganz und gar nicht zu seinem fetten und schweren Kopf passen wollte, wie einen Kreisel viermal, fünfmal durch den Raum. Dann setzte er sich wieder hin und sagte: »Verzeihen Sie – ich habe noch immer einen ganz furchtbaren Hunger.«
Als Mama den Teller mit den eingelegten Auberginen, Salztomaten und Zwiebeln brachte, machte Polanski sich sofort über das Gemüse her. Dazu stellte sie ihm einen Teller mit kalten Lammkoteletts hin, die er bis auf die Knochen abnagte, und an den Knochen saugte und lutschte er so lange herum, bis sich kein Tropfen Mark mehr in ihnen befand.
»Es gibt noch italienischen Schinken und luftgetrocknete Wurst aus der Normandie«, sagte Mama.
Aber da lehnte sich Polanski müde und stöhnend zurück. »Später vielleicht, Verehrteste«, sagte er, und der Lammknochen, den er für einen Augenblick losgelassen hatte, hing nun wie ein Fähnchen aus seinem dicken Affenmund. Er schwieg bedeutungsvoll, aber dann legte er los: »Ach«, rief er aus, »man sollte all seinen Mut zusammennehmen, so wie Sie es getan haben! Man sollte Russland abschreiben, weggehen und ein neues, besseres Leben beginnen!«
»Nein«, murmelte Vater, »Russland kann man nicht abschreiben –«
»– sprach Iwan der Traurige«, unterbrach ihn Klawdija.
»Ihr Vater hat recht, junge Dame«, sagte Polanski. »Ob Russen, Baschkiren oder Tataren, ob Tschetschenen oder Yakuten – wir alle haben ein Gefühl und eine Pflicht.«
»Wir Juden nicht«, sagte Klawka.
Vater sah sie traurig an, Mama lächelte, und Polanski hob die Hand, er streckte sie Klawkas Sonnenblumengesicht entgegen, dann kniff er sie plötzlich zärtlich in die Backe und sagte: »Keine Stacheln, nur Haut wie Seide.«
Klawka erstarrte für eine Sekunde, aber im nächsten Moment rückte sie ihren Stuhl noch näher an den Gast aus Moskau heran, sie lehnte sich auf den Tisch und berührte mit dem Ellbogen seinen Arm.
»Die jüdische Frage ist natürlich eine sehr ernste Frage«, sagte Polanski.
»Und wie halten Sie es mit der Frauenfrage, Ilja Muromez?«, sagte meine altkluge Schwester. Sie war immer schon viel frecher gewesen als ich, aber heute übertrieb sie es.
Polanski antwortete nicht, er blickte eine Weile in die Leere, dann nahm er sich noch einmal einen von seinen ausgehöhlten Lammknochen vor, Vater goss Wodka nach, und sie sprachen jetzt wieder über Politik.
Polanski schimpfte auf die alte Bürokratie, auf die neue Mafia, auf Jelzins Trunksucht und auf Gorbatschows Weltfremdheit, er sprach ohne große Leidenschaft, es war, als erfülle er ein ihm abverlangtes Pensum. Vater, der vom Alkohol allmählich müde wurde, redete dann auch, er schwärmte und jammerte, und immer, wenn er »Russland« sagte, klang es wie der Gesang von tausend Engeln, und da aber schnitt ihm Polanski mitten im Satz das Wort ab, und er stieß aus: »Ich werde hierbleiben, ich habe es längst beschlossen!«
»Deserteur«, sagte Klawka.
Doch Polanski sah sie nicht einmal an. Er sagte streng und gefasst: »Ich habe alles genau durchdacht. Ich weiß Bescheid. Außer Ihnen, Iwan Iwanytsch und Anna Abramowna, kenne ich in der Fremde keinen – aber ich werde es trotzdem schaffen.«
»Willkommen im Flüchtlingslager Mommsenstraße«, sagte Klawka. »Hausnummer vierzehn, dritter...
| Erscheint lt. Verlag | 13.2.2020 |
|---|---|
| Verlagsort | Köln |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | Emigration • Erzählungen • Familie • Judentum • Moralische Geschichten • Prag • Sechs Koffer • Shoah • Stalinismus • Zeitgeschichte |
| ISBN-10 | 3-462-32132-3 / 3462321323 |
| ISBN-13 | 978-3-462-32132-6 / 9783462321326 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,9 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich