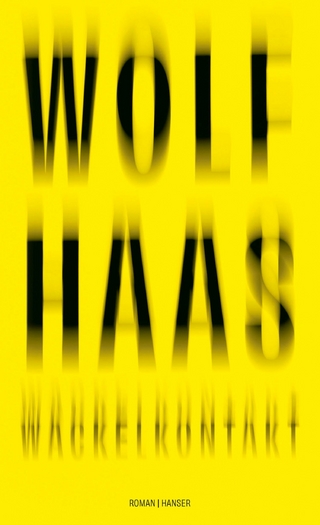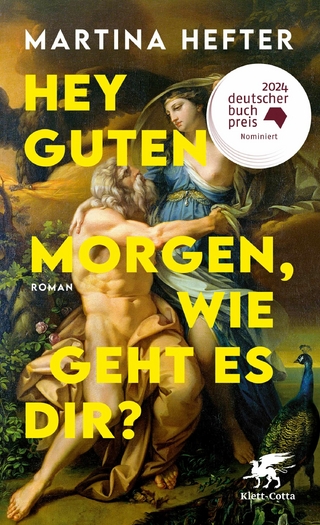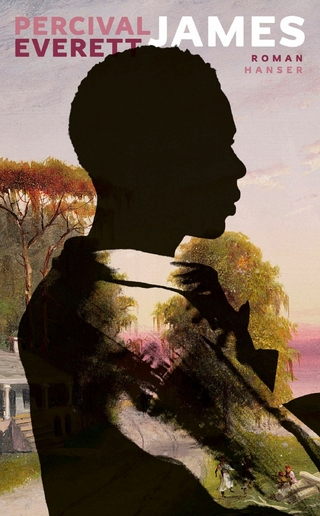Die Frau ohne Grab (eBook)
184 Seiten
Paul Zsolnay Verlag
978-3-552-05967-2 (ISBN)
Sommer 1945: Die siebzigjährige Pauline Drolc, geborene Bast, wird von jugoslawischen Partisanen in ihrem Heimatort Tüffer, slowenisch Lasko, verhaftet und in das provisorische Internierungslager Schloss Hrastovec gebracht. Wenige Wochen später ist sie tot. Ihr Grab wird nie gefunden. Pauline ist die Großtante von Martin Pollack, dessen Buch über den eigenen Vater, SS-Sturmbannführer Gerhard Bast, zu den Meilensteinen der Erinnerungsliteratur zählt. Und sie ist die Einzige in der stramm deutschnationalen Familie, die am Ende des Zweiten Weltkriegs zu Tode kommt. In seinem detektivisch recherchierten Bericht erzählt Martin Pollack über das Schicksal eines Menschen, das beispielhaft ist für die historischen Verstrickungen an einem kleinen Ort an der Grenze.
Martin Pollack, geboren 1944 in Bad Hall, Oberösterreich, studierte Slawistik und osteuropäische Geschichte. Bis 1998 Korrespondent des Spiegel in Wien und Warschau. Übersetzer u. a. von Ryszard Kapuscinski. Preise u. a.: Leipziger Buchpreis für Europäische Verständigung (2011), Johann-Heinrich-Merck-Preis, Österreichischer Staatspreis für Kulturpublizistik (beide 2018). Bei Zsolnay sind u.a. erschienen: Anklage Vatermord. Der Fall Philipp Halsmann (2002), Der Tote im Bunker. Bericht über meinen Vater (2004), Kaiser von Amerika. Die große Flucht aus Galizien (2010) und zuletzt Die Frau ohne Grab. Bericht über meine Tante (2019).
1
Als ich vor Jahren das erste Mal nach Laško fuhr, um nach Spuren meiner von dort stammenden Familie zu suchen, hatte ich von Paulines Existenz keine Ahnung.
Weder mein Großvater noch sein jüngerer Bruder hatten sie mir gegenüber jemals erwähnt. Sie hatten oft und gern von Tüffer erzählt, wie ihr kleiner Heimatort auf Deutsch genannt wurde, von einer glücklichen, unbeschwerten Jugend, von abenteuerlichen Streifzügen durch die umliegenden Wälder, von der Jagd nach Auerhähnen, Fasanen, Hasen und Rehwild, von kapitalen Böcken, erlegt nach stundenlanger schweißtreibender Pirsch, von gigantischen Huchen, die sie aus der durch Tüffer fließenden Sann, slowenisch Savinja, gezogen hatten, von einem liebevollen Elternhaus, vom wunderbaren Essen, das die Mutter mit Hilfe der slowenischen Köchin auf den Tisch zauberte, von duftenden Nusspotitzen und Poganzen und vom sonntäglichen Braten, meist ein knuspriger Puran, ein wahres Gedicht.
Mein Großvater erzählte mir auf unseren Wanderungen über die Dörfer rund um Amstetten in Niederösterreich stundenlang begeistert vom Leben in Tüffer. Das war in den späten vierziger, frühen fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Wenn er in die private, nur ihm und ein paar Eingeweihten vertraute Heimat seiner Kindheit eintauchte, wurde er jedes Mal sentimental und bekam feuchte Augen. Seine Stimme nahm dann einen singenden Tonfall an, so wie er einst zu Hause geredet haben mag. Dabei war er für gewöhnlich ein cholerischer, harter Mann, doch Tüffer weckte in ihm nostalgische Erinnerungen an ein versunkenes Paradies, an eine Idylle.
Mein Großvater hieß Rudolf Bast und wurde von mir liebevoll Opsi genannt, er war, wie sein jüngerer Bruder Ernst, Rechtsanwalt in Amstetten.
Ich kann mich nicht entsinnen, dass die beiden je von Pauline erzählt hätten, obwohl sie ihre Schwester war und zweifellos zu ihrem kleinen Paradies gehörte. Auch von den anderen Schwestern, Anna, Käthe und Josefine, Pepa gerufen, war in Amstetten nie die Rede. Jedenfalls nicht in meiner Gegenwart. Pauline Bast wurde 1875 in Tüffer geboren, sie war das zweitälteste von insgesamt acht Kindern.
Der kleine Ort Tüffer, slowenisch Laško, zwölf Kilometer südlich von Cilli, Celje, gelegen, gehörte bis 1918 zum österreichischen Kronland Herzogtum Steiermark, dessen südliche Regionen Untersteiermark genannt wurden. Nach dem verlorenen Krieg fiel die mehrheitlich von Slowenen bewohnte Untersteiermark, slowenisch Štajerska, so wie das benachbarte Kronland Krain mit Ljubljana, Laibach, als Zentrum, an das neu entstandene Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, kurz SHS-Staat genannt, das 1929 in Königreich Jugoslawien umbenannt wurde. 1927 erhielt Laško das Stadtrecht. Die Situation der deutschsprachigen Untersteirer verschlechterte sich 1918 von einem Tag auf den anderen. Plötzlich waren sie nicht mehr die Herren – was sie deutlich zu spüren bekamen.
Im April 1941 marschierten die Hitlertruppen in Jugoslawien ein und begannen mit einer brutalen Germanisierung der gemischtsprachigen Untersteiermark. Zahlreiche Slowenen wurden enteignet und vertrieben. Andere wurden nur auf den leisen Verdacht hin, sich der Germanisierung und überhaupt der deutschen Zwangsherrschaft widersetzen zu wollen, in Konzentrationslager gesteckt, in denen viele ermordet wurden oder elend zugrunde gingen. Mit Fortschreiten des Krieges gewannen die kommunistischen Partisanen auch in den slowenischen Gebieten zunehmend an Boden; sie verübten zahlreiche Sabotageakte und bewaffnete Aktionen, worauf die Deutschen hilflos mit immer blutigeren Repressionsmaßnahmen reagierten. Massenerschießungen und Vertreibungen waren an der Tagesordnung.
Pauline 1909
Das Schweigen über Pauline, auch Paula oder, slowenisch, Pavla genannt, erschien mir, je mehr ich über sie in Erfahrung brachte, umso bemerkenswerter, da sie als Einzige meiner Familie väterlicherseits nach dem Zweiten Weltkrieg in der untersteirischen Heimat auf tragische Weise zu Tode gekommen war. Auch darüber haben mein Großvater und sein Bruder, in dessen Haus in Amstetten ich viel Zeit verbrachte, mir gegenüber nie ein Wort verloren. Als hätte die Schwester nie existiert. Wollten sie mich als Kind schonen und mir die grausame Geschichte ihres Verschwindens und Todes ersparen? Oder schämten sie sich ihrer, weil sie offenbar keine überzeugte Nationalsozialistin, also in ihren Augen eine Außenseiterin war?
Ich habe vor fünfzehn Jahren ein Buch über meine Familie geschrieben, in dessen Mittelpunkt mein Vater steht, Gerhard Bast, SS-Offizier und leitender Beamter der Gestapo. Darin äußere ich die Vermutung, dass Pauline ins Bast-Grab gelegt wurde, das ich auf dem Friedhof von Tüffer vergeblich gesucht hatte. Das Grab ist verschwunden, vielleicht wurde es bei einem Bombenangriff zerstört, oder, wahrscheinlicher, die Partisanen haben im ersten antideutschen Furor den Stein zerschlagen und entfernt.
Ein Universitätsprofessor aus Graz wies mich Jahre nach Erscheinen des Buches darauf hin, dass meine Darstellung wahrscheinlich falsch sei, es scheine viel dafür zu sprechen, dass meine Großtante einen gewaltsamen Tod fern ihres Wohnortes erlitten habe und irgendwo im Umkreis von Hrastovec verscharrt worden sei. Er nannte mir den Artikel eines slowenischen Historikers, der sich mit der düsteren Geschichte von Hrastovec beschäftigt.
Hrastovec. Schloss Hrastovec, zu Deutsch Gutenhaag oder Gutenhag, ein Besitz der Familie Herberstein, in den Slovenske gorice, den Windischen Büheln, in der Nähe von Lenart im Bezirk Maribor, Marburg. Das Schloss hat eine weit zurückreichende düstere Geschichte, denn im 17. Jahrhundert waren hier über vierzig Frauen als Hexen gefoltert und anschließend auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Ein Massaker an unschuldigen Frauen in der frühen Neuzeit. Im Mai 1945 wurde das Schloss, dessen Besitzer, Gundiger Herberstein, kurz zuvor mit seiner Familie nach Österreich geflüchtet war, von jugoslawischen Partisanen besetzt. Noch im selben Monat wurde auf der malerisch auf einem Hügel über dem gleichnamigen Weiler gelegenen Burg von der kommunistischen OZNA, Abteilung für Volksschutz, ein provisorisches Konzentrationslager errichtet. Einer der Verantwortlichen für das Lager war ein gewisser Bogdan Hrovat, genannt Puklasti Miha, Buckliger Miha, bekannt für seine Grausamkeit. Vom Buckligen Miha sagte ein führender OZNA-Mann später in seinen Erinnerungen, dass er »eher Patient einer psychiatrischen Anstalt als Leiter eines Lagers sein sollte«. Nach Hrastovec wurden Menschen aus verschiedenen Regionen Sloweniens gebracht, Gottscheer und andere Angehörige der deutschen Minderheit, etwa aus Laško und dem Prekmurje, Übermurgebiet, aber auch Angehörige der ungarischen Minderheit von dort sowie Serben und Kroaten, nicht zu vergessen Einheimische aus dem nahe gelegenen Lenart.
Zahlreiche Internierte, vor allem Slowenen, die man der Kollaboration mit den Deutschen und anderer Verbrechen gegen die slowenische Nation bezichtigte, wurden gleich im Mai 1945 von Hinrichtungskommandos in der Umgebung von Hrastovec liquidiert, im Črni les, im Schwarzen Wald, der sich zwischen Hrastovec und der drei Kilometer entfernten Ortschaft Voličina erstreckt, ein schöner Mischwald, Eichen und Hainbuchen. Doch auch in Hrastovec selbst gab es Erschießungen. Dort dienten unter anderem die unterhalb des Schlosses liegenden Fischteiche als Grabstätten. Man leerte einen Teich und verscharrte die Leichen im Schlamm, dann wurde das Wasser wieder eingelassen – die provisorische Totengrube war verschwunden. Die Erschießungen erfolgten in der Regel ohne Gerichtsverfahren und ordentliches Urteil. Oft genügte ein Verdacht, eine willkürliche Denunziation. In der Literatur wird manchmal, reichlich euphemistisch, um nicht zu sagen zynisch, von »außergerichtlichen Tötungen« gesprochen.
Einheimische berichteten noch Jahre später, dass das Wasser in den Teichen, dort wo die Leichen lagen, im Umkreis von ein paar Metern nicht gefror, obwohl die Winter sehr kalt waren. Gläubige Menschen sahen darin einen Fingerzeig Gottes und entzündeten jahrelang bei den Teichen Kerzen. Ein gewisser Edo Kurnik, dessen Bruder Slavko in Hrastovec ums Leben gekommen war, berichtete, dass Anfang der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts die Überreste der Hingerichteten aus den Schlossteichen geborgen und mit Lastwagen in die Gießerei von Maribor gebracht wurden.
Warum in die Gießerei? Ich vermute, man wollte im Schmelzofen die Spuren der sogenannten außergerichtlichen Tötungen beseitigen und damit die Opfer für immer spurlos verschwinden lassen. Nicht gedacht soll ihrer werden.
Meiner Großtante Pauline blieb dieses Schicksal erspart, sie starb in Hrastovec an den Folgen der unmenschlichen Bedingungen, an Hunger und Erschöpfung, vielleicht an einer der im Lager grassierenden Krankheiten. Aufgrund der verheerenden hygienischen Zustände breiteten sich unter den Gefangenen Diarrhö und Paratyphus aus. Im Schloss gab es keinen elektrischen Strom und kein Wasser, dieses mussten die Gefangenen unter strenger Bewachung von einer zwei Kilometer entfernten Quelle holen. Im Hof des Schlosses stand zwar ein Brunnen, doch aus dem durften nur die Bewacher Wasser schöpfen. Die Hauptnahrung der Häftlinge bestand, laut Berichten von Überlebenden, aus alten, madigen Bohnen oder Erbsen und einem kleinen Stück Brot. Es gab zweimal am Tag etwas zu essen, in der Früh eine wässrige Suppe und ein kleines Stück Brot, und am Nachmittag gekochte Bohnen oder Erbsen, die kaum genießbar waren. Das Brot wurde auf demselben Wagen...
| Erscheint lt. Verlag | 19.8.2019 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | Anklage Vatermord • Biografie • Der Tote im Bunker • Geschichte • Grenze • Jugoslawien • Mitteleuropa • Nationalsozialismus • Österreich • Slowenien • Spannung • Weltkrieg |
| ISBN-10 | 3-552-05967-9 / 3552059679 |
| ISBN-13 | 978-3-552-05967-2 / 9783552059672 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 15,9 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich