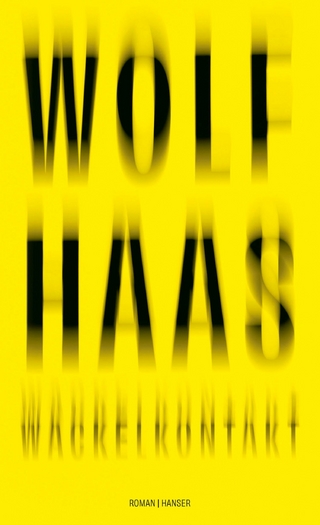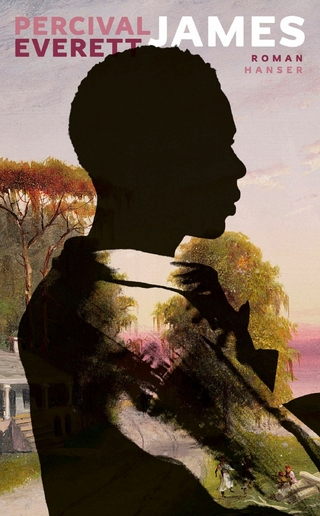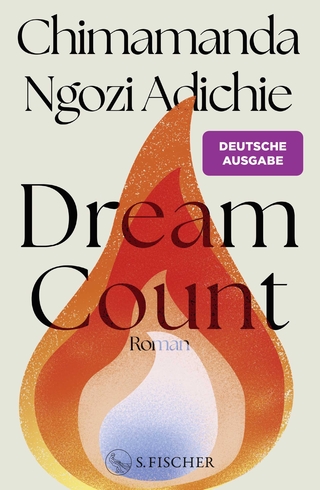Die Tauben von Brünn (eBook)
192 Seiten
Paul Zsolnay Verlag
978-3-552-06404-1 (ISBN)
Spannend und atmosphärisch dicht erzählt: die Geschichte des berüchtigten 'Lotteriebarons' Johann Karl von Sothen. Als der Brieftaubenzüchter Wenzel Hüttler 1840 einen Lottogewinn macht, stiehlt Sothen, der im selben Haus wohnt, den Lottoschein und legt so den Grundstein für sein Vermögen. Nach Hüttlers Tod betreibt dessen Tochter die Brieftaubenzucht in Brünn weiter. Sothen fingiert Verliebtheit, und sie hilft ihm gegen ihren Willen beim Betrug der Lotterie: Wenn in Brünn die Ziehung erfolgt ist, kann man in Wien noch setzen, bis der reitende Bote mit den Gewinnzahlen eintrifft. Eine Taube ist jedoch viel schneller ... Sothen wird unermesslich reich und in den Adelsstand erhoben ? doch auch für ihn kommt der Zahltag.
Bettina Balàka, geboren 1966 in Salzburg, studierte Englisch und Italienisch und lebt nach mehreren Auslandsaufenthalten (England, USA) in Wien. Sie schreibt Romane, Lyrik, Erzählungen und Essays. Zahlreiche Buchveröffentlichungen, Theaterstücke und Hörspiele. Vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Theodor-Körner-Preis (2004), dem Salzburger Lyrikpreis (2006) und dem Friedrich-Schiedel-Literaturpreis (2008). Zuletzt erschienen die Romane 'Unter Menschen'(2014), 'Die Prinzessin von Arborio' (2016), der Essay 'Kaiser, Krieger, Heldinnen. Exkursionen in die Gegenwart der Vergangenheit' (2018) und zuletzt bei Deuticke der Roman Die Tauben von Brünn (2019).
BERTA HÜTTLER
1850
Sie leben unter den Menschen wie Geister. Man sieht sie nicht, man geht durch sie hindurch. Kein Fuhrwerker ist ihnen je ausgewichen, kein Fußgänger hat je Halt gemacht, weil er befürchtet hätte, sie zu zertreten.
Das heißt, es gibt einen, der Rücksicht nimmt, sein Name ist Ferdl, und wenn man ihn sieht, wie er Rücksicht nimmt, dann sieht man plötzlich auch die Unsichtbaren, die Tauben.
Der Ferdl ist ein junger Bursche, vielleicht fünfzehn Jahre alt, und er verdient seinen Unterhalt mit einem Hundekarren, mit dem er Waren durch die Stadt transportiert. Der Hund heißt Zeus und ist ein großer, zotteliger Zughund mit jenem gelassenen Gemüt, das notwendig ist, wenn man einen Karren voll nagelneuer, noch unaufgeschnittener Bücher oder gar Porzellanwaren durch das Lärm- und Staubgewirr zwischen riesigen Pferdefuhrwerken ziehen muss.
Der Ferdl dirigiert Zeus mit einem Stöckchen, ohne ihn jedoch damit zu schlagen. Überhaupt hat er, wie er berichtet, bei der Erziehung des Hundes diesen niemals geschlagen, was erstaunlich ist, denn Zeus ist brav und fleißig und folgt auch auf ein geflüstertes Wort. Wenn der Ferdl seinem Hund das Stöckchen an eine bestimmte Stelle auf der linken Schulter legt, heißt das: langsamer werden. Verstärkt er den Druck, heißt das: stehen bleiben. Es ist die linke Schulter, weil der Ferdl links neben Zeus hergeht.
Während es also jedem Kutscher vollkommen egal ist, ob er in eine Gruppe von Tauben hineinfährt, behält der Ferdl jede einzelne im Blick. »Langsam, Zeus«, flüstert er, legt sein Stöckchen auf die Schulter des Hundes, während die Taube vor ihm hertänzelt, nach links und nach rechts, aber nicht sofort den Weg freigebend, weil sie den geplanten Weg des Karrens ja nicht kennt. Bleibt die Taube stehen, muss auch Zeus stehen bleiben. Geht sie weiter, hebt Zeus vorsichtig seine riesigen Pfoten und schleicht wie hinter einer kapriziösen Prinzessin her.
Dass der Ferdl sich so den Tauben gegenüber verhält, wissen nicht viele, obwohl sie es beobachten könnten. Denn auch der Ferdl ist gewissermaßen unsichtbar. Er ist im Trubel der Stadt nur ein Botenjunge, dem man Aufträge zuruft und Münzen in die schmutzige Hand wirft.
Die Tauben leben in den Zwischenräumen. Wo immer der Mensch Platz gelassen hat, setzt sich eine Taube hin, pickt, gurrt, balzt, guckt, und wenn sich Füße, Hufe oder Räder nähern, hüpft sie schnell zur Seite oder fliegt auf. Wer sieht, wie lange so eine Taube wartet, bevor sie die Flucht ergreift, wie ruhig sie sich den Gefahren der Straße aussetzt, immer bis zur letzten Sekunde ausharrend, bevor sie mit dem geringstmöglichen Kraftaufwand ausweicht, wundert sich, dass so wenig passiert. Es kommt sehr selten vor, dass eine Taube von Hufen oder Rädern erfasst wird, hier Am Hof vielleicht einmal im Jahr, und dann war diese Taube wohl schon sehr alt oder krank, sodass ihre Reflexe erlahmt waren.
Die Tauben leben aber nicht nur zwischen, sondern auch über uns. Dort auf den Dächern, Fassaden, Türmen, Simsen und Statuen haben sie ihre eigene Stadt, die wir nicht betreten können. Eigentlich könnten sie dort oben bleiben und ihre Ruhe haben, aber viele Stunden des Tages kommen sie hinunter auf die Plätze und Straßen, sie suchen unsere Nähe und vielleicht auch die Gefahr. Unten gibt es viele Gefahren: Hunde, Pferde, Menschen und Räder. Oben gibt es nur eine: den Turmfalken. Aber der Turmfalke fordert unter den Tauben mehr Opfer als alle Bierkutschen, Landauer und Kavallerieregimenter zusammen.
Die Tauben spazieren auf den Kaminen. Hoch oben auf den vornehmen Häusern und Palais sind steinerne Vasen, Adler und Wappen, gedrechselte Balkone, gemeißelte Masken, Atlasse, Karyatiden, mächtige Figuren — für die Tauben nur eine Welt der Felsklippen, ähnlich jener in Anatolien, aus der sie stammen. Aus den Dächern und Balkonbaldachinen ragen Regenrinnen mit Drachenhäuptern, aus deren Mäulern das Gewitterwasser stürzt, je mehr, desto schöner. Für die Tauben sind es Wasserfälle aus gurgelndem Bergquell.
»Die Tauben sind zu uns gekommen«, pflegte Vater zu sagen, »der Mensch hat sie nicht von ihren Felsen geholt, erobert, unterworfen und versklavt. Freiwillig sind sie gekommen, vorsichtig, und bei zurückhaltender und doch fürsorglicher Behandlung dann immer näher. So wie eine Straßentaube auch heute noch zwischen Menschenbeinen und Fuhrwerkswind zögerlich herantanzt! Man wirft ihr aus dem Augenwinkel Blicke zu, geht ein wenig in die Knie, lässt eine Brotkrume fallen, ohne sie weiter zu beachten, und die Taube tanzt näher, vor und zurück, bis sie da ist und plötzlich vertraut.«
Vater war auch einer, der die Tauben sah, das war bei einem Taubenzüchter nicht anders zu erwarten. So wie ein Wurzelgärtner ein besonderes Auge für Sellerieknollen hat, ein Kerzenzieher für Wachsqualitäten oder eine Modistin für haltbares Tuch, so hat jeder seine eigenen Bereiche des Sehens und der Blindheit. Nur die Liebe macht alle blind, sagt man, oder eher sehend in einem höheren Sinn: Man erkennt wundervolle Blüten, wo für andere nur brache Wüsten zu bemerken sind. Frauen werden blinder und sehender durch die Liebe als Männer, das ist ganz natürlich, sagt Pater Quirin, denn Frauen sind für die Liebe geschaffen.
Es leben aber auch andere unter uns, die man nicht einmal sieht, wenn man die Augen aufreißt und nach ihnen sucht. Es sind Nachtgeister, und alles, was auf sie hindeutet, ist ihr Werk, das man am nächsten Morgen erblickt. Dass sie da gewesen sind, mitten unter den Behausungen der Menschen, erkennt man an dem, was sie angerichtet haben. Die Biber, die den Karottenacker verwüstet und geplündert haben, die Füchse, die im Blutrausch einen Hühnerstall zum Schlachthaus machten. Manche hört man auch in der Nacht, wie die Marder, die am Dachboden rumoren, die Frösche und Käuze, deren Rufe klingen wie Omen.
Mir macht es nichts aus, im Dunkeln zu gehen, auch nicht über Land, weil ich die Geister der Toten nicht fürchte. Das Käuzchen wird mir nichts tun und der Frosch verstummt sofort, wenn er meinen Schritt hört.
Pater Quirin meint, dass ein bisschen Furcht vor den Toten nicht schadet. Es kann schließlich nicht jedes Rascheln im Finstern zu einer harmlosen Maus gehören, und nicht jedes Licht, das einem entgegenkommt, ist die Laterne eines Menschen. Es gibt unheimliche Dinge in der Welt, die wir nicht restlos verstehen, daher ist es besser, man schützt sich mit einem unsichtbaren Schild aus Gebeten.
Das Fleisch des Bibers, sagt Pater Quirin, ist fett und hat einen leicht harzigen Nachgeschmack, was daran liegt, dass er sich hauptsächlich von Baumrinde ernährt. Früher dachte man, der Biber würde Äste entrinden, um mit dem grünen Bast die Nester für seine Jungen auszukleiden, doch dann wurde beobachtet, dass er ihn frisst.
Ich selbst habe noch nie Biberfleisch gegessen. Freitags dürfen Christen kein Fleisch essen, nur Fisch. Dies zum Gedenken an den Heiland, der an einem Freitag sein Leben für die Menschheit hingegeben hat. Da der Biber im Wasser lebt und einen schuppigen Schwanz hat, kann er im Kloster am Freitag als Fisch gelten. Die Mönche gehen in der Abenddämmerung auf Biberjagd, wenn es eigentlich Zeit für die Vesper ist. Wenn es schon fast finster ist, kommt der Biber aus seinem in den Tiefen des Wassers liegenden Bau und schwimmt an das Ufer, wo ihn ein Mönch mit einem Knüppel erschlägt.
Als ich ein Kind war, haben wir freitags meistens Fogosch oder eine Mehlspeise gegessen. Auch die Mönche essen gerne eine Mehlspeise, aber als Nachspeise nach dem Biberbraten. Meine Lieblingsmehlspeise ist ein Scheiterhaufen aus blättrig geschnittenen Äpfeln und in Eiermilch gebackenen Kipfeln. Es sei sehr lustig, als Kirchenmann einen Scheiterhaufen zu essen, sagt Pater Quirin, man habe aus der Hinrichtungsstätte der Teufelsanbeterinnen eine köstliche Speise gemacht, das sei ein herrlicher Triumph über den Höllenfürsten.
Die Vögel sind diejenigen unter den Tieren, die sich zeigen. Sie haben viel weniger Scheu vor uns Menschen als die Biber und Dachse, die Rehe und Wildschweine, weil sie uns mühelos entkommen können. Sie spazieren zwischen uns, sie sitzen über uns, und auch die Wasservögel fürchten uns nicht, wenn sie auf der Oberfläche der Seen und Flüsse gleiten. Wir werden beobachtet, ohne dass wir es bemerken. Überall auf den Dächern, den Bäumen, auf den Fensterbänken und Simsen sind Augen auf uns gerichtet. Wir bemerken es erst, wenn ein Tagräuber sich zeigt. Wenn eine hungrige Krähe herabstürzt, um am unbeaufsichtigten Ende eines Marktstandes ein Stück Schinken zu stehlen. Wenn die Obstfrau ihre prächtigste Birne aufschneidet, um der Kundschaft zu...
| Erscheint lt. Verlag | 19.8.2019 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | Betrug • Brieftaube • Geschichte • Hans von Sothen • Lotterie • Lotto • Lottogewinn • Österreich • Wien |
| ISBN-10 | 3-552-06404-4 / 3552064044 |
| ISBN-13 | 978-3-552-06404-1 / 9783552064041 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,0 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich