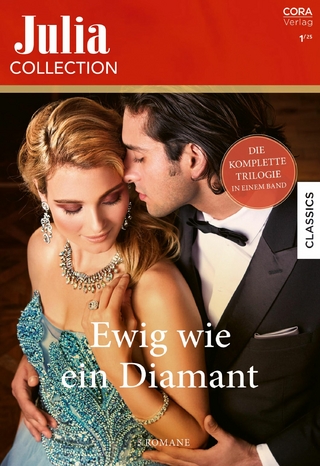'Die Geschichten sind ja schnell gelesen ...' (eBook)
256 Seiten
Boyens Buchverlag
978-3-8042-3060-6 (ISBN)
Frank Trende, geboren 1963, Ministerialrat, Autor zahlreicher Beiträge und Bücher zur schleswig-holsteinischen Landeskunde und Kulturgeschichte. Zuletzt im Boyens Buchverlag besonders erfolgreich: 'Historische Orte erzählen Schleswig-Holsteins Geschichte', 'Literarische Reisen zwischen Nord- und Ostsee', 'Neuland! war das Zauberwort', 'Herrenhaus-Geschichten im Herzen Schleswig-Holsteins' und 'Sie rettete die ganze Stadt'.
Frank Trende, geboren 1963, Ministerialrat, Autor zahlreicher Beiträge und Bücher zur schleswig-holsteinischen Landeskunde und Kulturgeschichte. Zuletzt im Boyens Buchverlag besonders erfolgreich: „Historische Orte erzählen Schleswig-Holsteins Geschichte“, „Literarische Reisen zwischen Nord- und Ostsee“, „Neuland! war das Zauberwort“, „Herrenhaus-Geschichten im Herzen Schleswig-Holsteins“ und „Sie rettete die ganze Stadt“.
Frank Trende
Karl Viktor Müllenhoff 1818–1884. Eine Annäherung.
Müllenhoff weint
Als Karl Viktor Müllenhoff, erfolgreicher Professor, seit 1858 in Berlin und zwischenzeitlich ein bekannter Mann, wieder nach Schleswig-Holstein, nach Dithmarschen reiste, musste er weinen. Die Tränen traten ihm 1860 in die Augen, als er gesprochenes Plattdeutsch hörte. Aber diese Reise hatte nicht nur eine emotionale, sondern auch eine klärende Wirkung. Nach Berlin zurückgekehrt, schrieb Müllenhoff an seinen ehemaligen Lehrer Wilhelm Heinrich Kolster in Meldorf, mit dem er lebenslang in freundschaftlichem Kontakt stand: „Ich bin geheilt, nicht weil ich es dort nicht so gut gefunden, wie ich gehofft: Kiel und Dithmarschen dazu haben sich mir von der besten Seite gezeigt. Aber was ich schon damals, als ich dort war, im Voraus empfand, ich fühle mich nicht mehr so abgeschieden und ausgeschlossen, ich hatte auch doch allerlei vergessen und übersehen, was mir dort wieder entgegentrat und was mir auf die Dauer nicht gefallen würde. Ich fühle mich versöhnt mit meinem Loos und verlange nicht mehr zu tauschen; gebe Gott nur, daß es anhält! Ich habe hier doch manchen Vortheil gewonnen, und dazu meine Wirksamkeit. Meine Frau ist weiser gewesen als ich.“1
Karl Viktor Müllenhoff wurde am 8. September 1818 in Marne geboren, als Sohn des Kaufmanns Johann Anton Müllenhoff und seiner Frau Anna, geb. Peters. Sein Vater sollte mit drei Frauen insgesamt 22 Kinder haben, Karl Viktor war das älteste2. Was mag dem erwachsenen Müllenhoff durch den Kopf gegangen sein, als er wieder nach Dithmarschen kam, was mag seine Seele berührt und ihn so dermaßen gerührt haben? War es der Klang der plattdeutschen Unterhaltung? War es die Begegnung mit der geschichtsträchtigen Landschaft und seiner großen Familie? Oder war es die Erinnerung an den strengen Vater? Karl Viktor Müllenhoffs frühste Erinnerung, so wusste es sein Biograf Wilhelm Scherer zu berichten, knüpfte sich an den Tod eines jüngeren Bruders. „Die verdunkelte Stube, die kleine Leiche aufgebahrt in der Mitte, die Mutter weinend im Sopha, der Vater, der sich den Hut von dem Nagel an der Thür langte und nach einem gesprochenen Vaterunser den kleinen Sarg unter den Arm nahm und fort trug, das alles blieb ihm zeitlebens unvergeßlich, obgleich er erst dritthalb Jahr alt war, da es sich zutrug.“ Nur vier Jahre später, im Mai 1825, Müllenhoff war erst sechs Jahre alt, verlor er seine Mutter. Im Februar 1864 schrieb er nach einem Ball im Hauses seines akademischen Lehrers und Kollegen Moriz Haupt, dass er dort einige Male getanzt habe: „Ich habe das von meiner schönen Mutter geerbt, die sich zu Tode getanzt.“
Müllenhoff war nun voll und ganz auf seinen Vater bezogen, zu ihm „hatte er ein nahes, inniges, zutrauensvolles Verhältniß, und wir erkennen, daß er wesentliche Züge des Charakters mit ihm theilte.“ Müllenhoffs Vater Johann Anton war ein goethezeitlicher Tatmensch – er packte an, er war politisch wie religiös ein Liberaler und von großem Einfluss. Er war ein Mann mit Anspruch und einem Horizont, der über Dithmarschen hinausreichte: Als seine Mutter im Januar 1828 verstarb, zeigte er ihr Ableben in der „Staats und Gelehrten Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten“ an3, in dem Jahr, in dem sein Sohn Karl Viktor geboren wurde, verzeichneten ihn die „Schleswig=Holstein=Lauenburgischen Provinzialberichte für das Jahr 1818“ als Subskribenten. Jedenfalls soll in Marne ein Schulkind auf die Frage, wer allmächtig sei, geantwortet haben: „de ol Müllenhoff!“ Und wenn er eine Niederlage einstecken musste, machte er sich wenig daraus und antwortete frei nach Walther von der Vogelweide: „Dat binn ik mi an’t Been!“ Aber der Lebensweg seiner Söhne war ihm nicht gleichgültig. Und so war es eine der stärksten Triebfedern Karl Viktors, dem Vater Ehre zu machen. Und wenn das nicht gelang? Nach der Marner Volksschule besuchte der Sohn die Meldorfer Gelehrtenschule. Dort hatte er einen Mitschüler namens Krey, dessen Vater das Haus von Heinrich Christian Boie gekauft hatte. In Boies altem Garten las Müllenhoff Homer, im Haus bestaunte er Fensterbierscheiben, die den Namen Ernestine Voß trugen: Karl Viktor Müllenhoff erhaschte noch einen Hauch der Zeit, als der Arabienreisende Carsten Niebuhr und der literarische Mittler Heinrich Christian Boie, regelmäßig besucht vom Ehepaar Voß aus Eutin, seiner Schwester Ernestine und seinem Schwager, dem Homer-Übersetzer Johann Heinrich, aus Meldorf einen ausstrahlenden literarischen Kristallisationspunkt der Goethezeit machten.4 Ostern 1831 musste Müllenhoff, gerade 12 Jahre alt, nach Hause melden, dass er nicht nach Secunda versetzt worden war. Über ihm ging ein Donnerwetter seines Vaters nieder: „Karl! Karl! Welch einen Brief habe ich von Dir erhalten müssen! Welch einen schrecklichen Tag hast Du mir bereitet, oder vielmehr welche Tage! – Gestern hörte ich von Matthies Ahrens, daß ihr, Hanssen, Bünz und Du, alle drei nach Secunda versetzt wäret, – heute Morgen beim Aufstehen finde ich Deinen Brief! – Als ich gestern die Nachricht erhielt, ja! Ich will Dirs nicht verhehlen, sie freute mich, obwohl mir wieder bangte, daß man Euch nur hätte übergehen lassen, um ein paar Schüler mehr in Secunda zu haben, und ich würde völlig zufrieden mit Euch gewesen sein, wäret Ihr nicht versetzt worden. Daß aber Bünz versetzt ist, und – es ist für mich ein schreckliches Wort, – Du, mein bisheriger Liebling, meine Freude und mein Stolz, – Du nicht! – o Karl! Das ist eine Kränkung, die Du mir zufügst, wie noch keine menschliche Seele sie so bitter mir zugefügt hat! – […] frage Deine Mutter, frage Eduard, wie schmerzlich, wie bitter ich geweint habe über Dich! – ja, noch in diesem Augenblicke tröpfeln die Thränen des gereizten, tief gekränkten Gefühls, des Stolzes, den ich bisher fühlte, wenn ich Deiner gedachte, auf dies Blatt. Und solchen bittern Schmerz bereitet mir mein Liebling! – Karl, könntest Du in meiner Seele lesen, Du würdest Dich selbst verurtheilen!“ Die Vorhaltungen seines Vaters waren nicht abschließend: Der warf ihm noch Trägheit vor, Talent habe er, an Fleiß fehle es ihm. Er drohte ihm, ihn strenger zu behandeln. Er drohte ihm, ihn in Absprache mit seinen Meldorfer Lehrern zu einem anderen Arbeiten zu zwingen. „Wenn alles nichts helfe,“ so Müllenhoffs Biograf Scherer, „so werde er sich gezwungen sehen, ihn von seiner bisherigen Laufbahn zu entfernen. Die nächste Zukunft müsse entscheiden, ob er an ihm einen Sohn haben solle, wie er ihn hoffte, oder einen des gewöhnlichen Schlages, die an der Erde fortkriechen, ohne zum Höhern hinzustreben. ‚Etwas Mittelmäßiges, Alltägliches‘, ruft er ihm zu, ‚will ich nun einmal von Dir nicht, da ich glaube berechtigt zu sein, mehr zu erwarten und deshalb zu fordern!‘“ Die Ermahnungen hatten damit noch kein Ende, er forderte „höheres Menschenleben“, eine „höhere Menschenbildung“, er schärfte ihm ein: „Ueberhaupt laß es Deinen Grundsatz sein: was Du thun willst, was Du sein willst, immer ganz zu sein, nie halb.“ Der Sohn strengte sich an, kam gut durch die Schuljahre und bestand das schulische Examen mit dem „zweiten Charakter“. Auch das war für den Vater eine schwere Kränkung. Er schrieb ihm, Karl Viktor war nun neunzehn Jahre alt, wieder harte Vorwürfe ins Stammbuch und verglich ihn mit seinen Mitschülern: „vermagst nicht mehr als ein Dethlefs und Saß? – entschuldigst Dich dann mit der gewöhnlichen Ausflucht aller schlecht fahrenden Candidaten: ich war unwohl? – ja, meinst am Ende gar, ich werde mich wohl mit dem höchst trivialen Troste begnügen, daß eine Auszeichnung nichts relevire? Karl! Karl!“ Und so ging es weiter. Er habe sich selbst „zu dem großen Haufen der Mittelmäßigen herab“ gesetzt, er hätte seinen Vater nicht so „schmählich demüthigen“ dürfen. Der Vater versuchte, alle Entschuldigungsgründe, die der Sohn vorbrachte, zu widerlegen, um zu schließen: „… nur Deinen Ehrgeiz will ich stacheln, daß wo es darauf ankommt Dich zu zeigen, Du nicht lässig die Hände sinken lassest, und so in den Pfuhl der Gemeinheit herabsinkest.“
All diese Zeugnisse strengster väterlicher Ermahnung, Beschimpfung, Zurechtweisung in fast biblischem Zorn – vom allmächtigen „ol Müllenhoff“ – hatte Karl Viktor Müllenhoff nicht weggeworfen, verbrannt, sonstwie vernichtet, sondern sie lagen noch vor, als ein halbes Jahrhundert später Wilhelm Scherer sein Lebensbild von Karl Viktor Müllenhoff schreiben sollte.
Nichts davon schien Müllenhoff bis an sein Lebensende vergessen zu haben. Es wäre also kein Wunder, wenn ihm dies auf der Seele gelegen hätte, als er als berühmter Berliner Gelehrter wie auf einer Reise in die eigene Vergangenheit wieder nach Dithmarschen zurückkam. Und ihm die Tränen in die Augen stiegen.
Student in Kiel, Leipzig und Berlin
Die Schule war schließlich geschafft und Müllenhoff konnte im Oktober 1837 mit dem Studium beginnen. Drei Semester sollte er in Kiel absolvieren. Er wohnte unter dem Dach eines der Persianischen Häuser an der Nikolaikirche, wo seit 1835 Müllenhoffs Landsmann, der aus Fahrstedt bei Marne stammende Claus Harms als Hauptpastor predigte. Die Häuser waren zweihundert Jahre zuvor errichtet worden, um als Packhäuser für den Handel Schleswigs und Holsteins mit Persien zu dienen, die von Herzog Friedrich III. ausgesandte Expedition, an der auch der Barockdichter Paul Fleming teilnahm, konnte aber keine Verträge abschließen und die Packhäuser wurden zu Wohnhäusern umgebaut. Im Dezember 1838 schlug Müllenhoff sein einziges Duell mit...
| Erscheint lt. Verlag | 1.11.2018 |
|---|---|
| Zusatzinfo | 18 Abbildungen |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Anthologien |
| Literatur ► Romane / Erzählungen | |
| Schlagworte | Bellestristik • Briefe • Geschichjten • Karl Viktor Müllenhoff • Lesebuch • Lieder • Märchen • Sagen • Schleswig-Holstein |
| ISBN-10 | 3-8042-3060-1 / 3804230601 |
| ISBN-13 | 978-3-8042-3060-6 / 9783804230606 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 4,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich