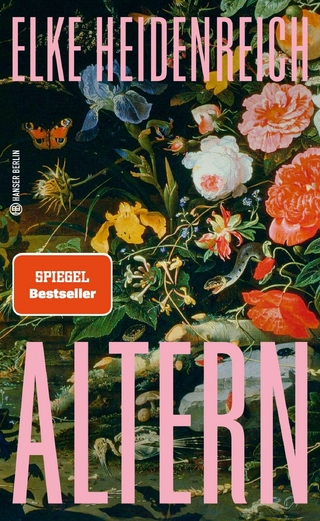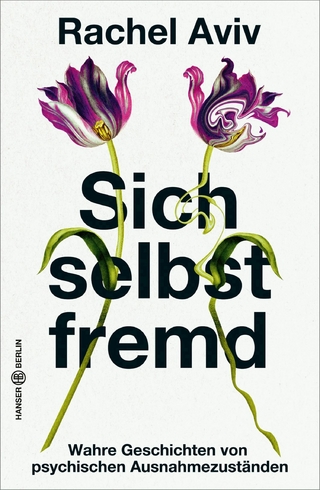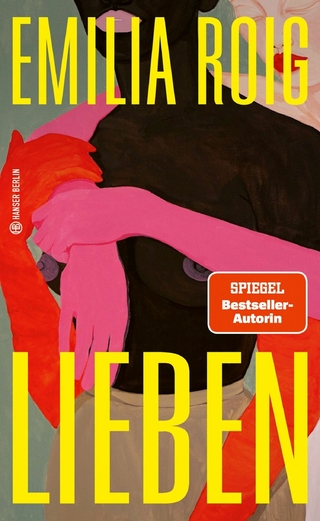Im Vulkan (eBook)
320 Seiten
Kein & Aber (Verlag)
978-3-0369-9397-3 (ISBN)
MARTIN AMIS, geboren 1949 in Swansea, ist einer der bedeutendsten englischen Gegenwartsautoren. Er ist der Verfasser von vierzehn Romanen, zwei Kurzgeschichtensammlungen und sechs Sachbüchern, darunter fünf Essaybände. Für sein Romandebüt 'Das Rachel-Tagebuch' (1973) erhielt er den Somerset Maugham Award. Zu seinen bekanntesten Werken zählen weiterhin 'Gierig' (1984), 'London Fields' (1989), 'Pfeil der Zeit' (1991) und 'Interessengebiet' (2015). Martin Amis lebt in New York.
SALMAN RUSHDIE:
VERBANNT AUF DIE TITELSEITE
Salman Rushdie, der Autor eines vieldiskutierten Romans mit dem Titel Die satanischen Verse, ist immer noch bei uns. Es scheint mir wichtig, diesen Umstand hervorzuheben: dass es ihn noch gibt. Er ist in einer Falle gefangen, einer Art Pastiche des eigenen Lebens, denn er sieht sich gezwungen, seine fiktionalen Themen persönlich auszuagieren: Exil, Bann, Bruch, persönliche Neuerfindung. Er bewohnt eine Art Schattenland, aber er bleibt überaus lebendig. Die Rushdie-Diskussion scheint einen Punkt erreicht zu haben, wo niemand mehr in der Lage ist, sich auf normale Weise daran zu beteiligen. In diesem Sinne haben die Kräfte der Humorlosigkeit bereits triumphiert. Rushdies Leben wurde permanent verbogen. Ich bestätige deshalb hiermit, dass seine Menschlichkeit unbeeinträchtigt und vollständig ist.
Direkte Begegnungen mit dem Mann bleiben selten und sind sehr umständlich. Wenn man sich mit dem Minotaurus treffen will, muss man das Labyrinth seiner Sicherheitsvorkehrungen betreten. Doch gibt es unter seinen Freunden immer Nachrichten von diversen Sichtungen und Auftritten: Rushdie, der sich um Mitternacht erbötig macht, die sämtlichen Werke von Bob Dylan zu rezitieren; der letzten Sommer die Weltmeisterschaft im Fernsehen verfolgt (und seine gnadenlosen Parodien der Sportreporter hören lässt); der bei der Darbietung einer ehrgeizig tief gelegten Variante des Twists umfällt; der Pizza isst und Jimi Hendrix lauscht. Rushdies Lage ist wahrhaft manichäisch, aber er ist weder ein Gott noch ein Teufel, er ist nur ein Schriftsteller – komisch und endlos wandelbar, ironisch und leidenschaftlich. Um dies zu bestätigen, hat Rushdie jetzt einen trotzig gutgelaunten und ritterlichen Roman veröffentlicht, ein Kinderbuch für Erwachsene, das Harun und das Meer der Geschichten heißt. Es gibt Zeiten, da sich Rushdies Situation anfühlt wie eine bedeutungslose Nebensächlichkeit, ein chaotischer Zwischenfall; zu anderen Zeiten erscheint sie als etwas von entscheidender Bedeutung, ungeheuer, exemplarisch. Ich vermute, Rushdies Freunde denken jeden Tag an ihn. Die Schriftsteller unter seinen Freunden aber dürften wohl jede halbe Stunde an ihn denken. Er ist immer noch bei uns. Und wir sind bei ihm.
»Als ich die Nachricht zuerst gehört habe, da habe ich gedacht: Ich bin ein toter Mann. Du verstehst: Das wars. Ein Tag noch. Zwei Tage.« Dieses Interview fand im September statt, an einem geheimen Ort. Wir hatten uns über etwas in Verbindung gesetzt, das Harun ein P2C2E genannt hätte: einen Prozess, der zu kompliziert ist, als dass man ihn erklären könnte. »In solchen Augenblicken kommen einem die üblichen sentimentalen Gedanken. Man denkt: Du kannst nicht dabei zusehen, wie deine Kinder erwachsen werden. Du kannst die Arbeit nicht mehr abschließen, die du dir vorgenommen hast. Eigenartigerweise tun einem diese Dinge mehr weh als die eigentliche Vorstellung, tot zu sein. Diese Realität kann man irgendwie nicht fassen.«
Die Realität schien ganz allgemein etwas unwirklich an jenem Tag, dem 14. Februar 1989 – dem Tag von Chomeinis Fatwa. Selbst der Himmel war, wie ich mich erinnere, übernatürlich strahlend. Rushdie erfuhr die Neuigkeit, als ein Radiosender bei ihm anrief – um seine Reaktion zu erfahren. »Was sagen Sie dazu, dass der Ajatollah Sie zum Tod verurteilt hat? Wie wärs mit einem kurzen Kommentar, den wir zitieren können?« Er brachte den Kommentar zustande (»Weiß Gott, was ich da gesagt habe«) und rannte durchs Haus, um die Vorhänge zuzuziehen und die Läden vorzulegen. Als Nächstes absolvierte er schlafwandlerisch ein Interview mit den Morgennachrichten der CBS und ging dann zu seinem bislang letzten Auftritt in der Öffentlichkeit: dem Gedenkgottesdienst für seinen Freund Bruce Chatwin.
Es war eine griechisch-orthodoxe Kirche, düster, staubig, hochgewölbt und voller Schriftsteller. Rushdie trat rasch ein, mit seiner damaligen Ehefrau, der amerikanischen Romanautorin Marianne Wiggins. »Ich stand unter Schock«, sagte er jetzt. Er sah aufgeregt aus. Wir sahen alle aufgeregt aus. Saul Bellow nennt das »Ereignisglamour«. »Salman«, sagte ich, als wir uns umarmten (er umarmt gern seine Freunde, nie routinemäßig, immer bedeutungsvoll), »wir machen uns Sorgen um dich.« Und er antwortete: »Ich mache mir Sorgen um mich.« Die Rushdies setzten sich neben mich und meine Frau. Ich spürte den beschämenden Impuls, ihn auf die schönen leeren Sitze am anderen Ende der Kirche hinzuweisen. Rushdie sah immer wieder über die Schulter: Die Journalisten wurden von seinem Agenten Gillon Aitken zurückgehalten. »Salman!«, rief Paul Theroux lustig wie ein Schuljunge. »Nächste Woche sind wir wieder hier, für dich!«
Angemessenerweise war der Gottesdienst eine Qual – schon in sich, mit vielen unverständlichen Jodeleinlagen und Fürbitten. Ich stellte fest, dass alle meine Gedanken leise, aber hartnäckig um Blasphemien kreisten. Die Priester in ihren Gewändern schwenkten die rauchenden Gefäße in der Luft wie griechische Kellner, die in Brand geratene Aschenbecher abräumen. Dies, schloss ich, war der letzte Scherz, den Bruce Chatwin sich mit seinen Freunden und Verwandten machte: Sein heterodoxer Theismus hatte sich am Ende unbeirrbar eine Religion ausgesucht, die niemand, den er kannte, begreifen oder mitempfinden konnte. Wir setzten uns hin und standen auf, standen auf und setzten uns hin und versuchten, das langweilige Theater eines fremden Glaubens nicht durch Seufzen oder Gähnen zu stören. Als es vorbei war, liefen Salman und Marianne mit eingezogenen Köpfen an den wartenden Journalisten vorbei und wurden in der Limousine eines Freundes weggefahren. Rushdie verbrachte dann den Rest des Tages auf der Suche nach seinem Sohn Zafar – und, nehme ich an, nach einer Form, sich von ihm zu verabschieden, da er nun sein neues Leben beginnen musste.
Ich blieb noch kurz auf dem Empfang nach dem Gottesdienst. Unter gewöhnlichen Umständen hätten wir die Gelegenheit ergriffen und über den von uns betrauerten Freund gesprochen. Aber es dachte niemand an Bruce, niemand sprach von ihm. Alle Gedanken und Gespräche galten Salman, seiner Gefahr, seiner drastischen Erhebung in fremde Höhen. Auf dem Heimweg tat ich etwa ein halbes Dutzend Dinge, die Salman Rushdie nun nicht mehr gestattet waren. Ich ging in einen Buchladen, ein Spielzeuggeschäft, einen Imbiss; ich ging nach Hause. Unterwegs kaufte ich eine Abendzeitung. Die riesige Schlagzeile: richtet rushdie hin, sagt der ajatollah. Salman war in der Welt der gigantischen Blockbuchstaben verschwunden. Verschwunden in den Schlagzeilen der Zeitungen.
Sein Fall ist natürlich einzigartig. Er ist von peinlicher Einzigartigkeit. Die Formulierungen der Fatwa (die gleichzeitig ein Todesurteil ist und eine lebenslängliche Verurteilung); die Höhe des Kopfgeldes (dreimal so viel wie das vermutete Honorar für den Lockerbie-Anschlag); das Wesen des Exils, das den Romancier sowohl von seinem Gegenstand (der Gesellschaft) wie von seinem Arbeitsziel (gelassene literarische Reflexion) abhält: Rushdie ist, mit seinen eigenen Worten, »fest an die Historie angekettet«. Seine Einzigartigkeit ergibt das Maß seiner Isolation. Vielleicht ist sie auch das Maß seines Stoizismus. Denn niemand – gewiss kein anderer Autor – hätte so gut überlebt wie er.
Ich sage ihm das oft. Ich sage ihm oft: Wenn der Rushdie-Skandal beispielsweise der Amis-Skandal wäre, dann wäre ich mittlerweile ein weinerlicher sedierter Dickwanst ohne Wimpern und Nasenhaare (wegen diverser Missgeschicke mit der Spritze und der Crack-Pfeife). Er hat ein wenig zugenommen (»nicht genug Bewegung«) und hat sein sehr mäßiges Zigarettenrauchen wieder angefangen; eine Weile litt er an einer Art Stress-Asthma. Aber Rushdie ist unverändert: die rosige Hautfarbe, die seitliche Falte in der Oberlippe, wenn er lächelt (die den Eindruck hinterlässt, er habe kindlich kurze Schneidezähne), die Augen, deren Lider so exotisch tief hängen, dass er sich schon lange mit dem Gedanken an eine Operation auseinandergesetzt hat, welche verhindern würde, dass die Augenlider am Ende die Pupillen verdecken. Seine dringlich intensive Gegenwart ist unvermindert, ungeschmälert. Manchmal, wenn man ihn anruft, fehlt seinem »Ach, mir gehts gut!« die letzte Überzeugungskraft. Ansonsten ist er ein Wunder an Gelassenheit.
Wie kommt das? Fraglos verfügt Rushdie über eine große Menge natürlichen Ballast. Er kennt sich aus mit dem Exil, mit dessen Entwurzelungen und dessen überraschenden Möglichkeiten zu neuer Ausdehnung, er weiß, wie man sich dort anfühlt, gleichzeitig nackt und unsichtbar, wie im Traum. Es war immer etwas Olympisches an Salman Rushdie. Sein Glaube an die eigene Begabung ist jedoch (im Gegensatz zu anderen Glaubensformen) nicht monolithisch und hat insofern etwas Prekäres. Dieser Glaube ist agil, kapriziös, drollig. Als ich ihm vor sieben Jahren zum ersten Mal begegnete, erwähnte er, er habe kürzlich an dem historischen Fußballspiel einer Schriftsteller-Elf in Finnland teilgenommen.
»Tatsächlich?«, sagte ich. »Wie ists dir ergangen?« Ich rechnete mit der üblichen komödiantischen Nummer: Hab mir den Knöchel verstaucht, Herzattacke, Unbeholfenheit, Beschämung. Aber er führte eine andere Komödie auf, eine ganz und gar unerwartete.
Er sagte: »Nun, ich habe, ähhm, einen Hattrick hingelegt.«
»Das soll wohl ein Witz sein. Du hast wahrscheinlich einfach den Fuß hingehalten. Die Bälle sind irgendwie reingekullert.«
»Das erste Tor war ein hüfthoher Volley aus knapp zwanzig Metern. Beim nächsten bin ich am Strafraumrand an zwei Gegenspielern vorbei und...
| Erscheint lt. Verlag | 12.9.2018 |
|---|---|
| Übersetzer | Joachim Kalka |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Essays / Feuilleton |
| Literatur ► Romane / Erzählungen | |
| Schlagworte | 11. September • Amerika • Analysen • Brian de Palma • Daniel Kehlmann • Donald Trump • Essays • Film • John Lennon • John Updike • Kulturkritik • Kunst • Literatur • Madonna • Malcom Lowry • Oktoberfest • Politik • Prominente • Republikaner • Sachbuch ebook • Salman Rushdie • Sammlung • Steven Spielberg • Terrorismus • Tony Blair • Truman Capote • Vladimir Nabokov |
| ISBN-10 | 3-0369-9397-5 / 3036993975 |
| ISBN-13 | 978-3-0369-9397-3 / 9783036993973 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,8 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich