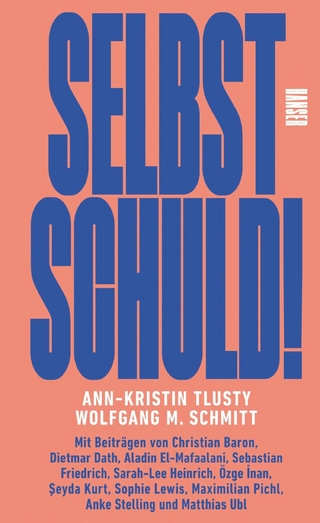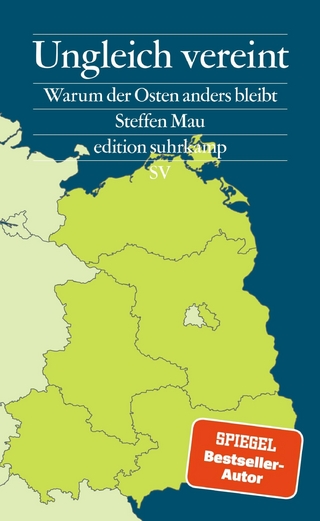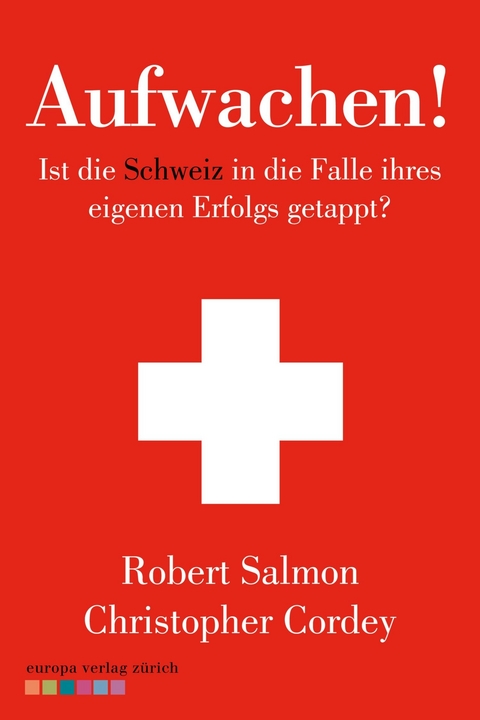
Aufwachen! (eBook)
104 Seiten
Europa Verlag GmbH & Co. KG
978-3-906272-08-5 (ISBN)
Kapitel 2
EINIGE TATSACHEN ÜBER DIE SCHWEIZ VON GESTERN. WAS ABER WIRD AUS DER SCHWEIZ VON HEUTE?
«Eine Hälfte der Schweiz ist die Hölle, die andere das Paradies.»
VOLTAIRE
Die Neutralität, die lange ein unbestrittener Vorteil war, hat die Schweiz zu einem ruhigen und friedlichen Zufluchtsort mitten in einem Europa gemacht, das über Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte hinweg von Rivalitäten und Kriegen zerrüttet wurde. Jedes Land zog einen Nutzen daraus, einen tröstlichen Hafen des Friedens vor der Haustür zu haben. Heute hat diese Neutralitätsidee stark an Relevanz eingebüßt: Einerseits durch die Weiterentwicklung der Welt, andererseits durch den Aufbau der Europäischen Union, die den Kontinent jetzt vor Konflikten wie den beiden vergangenen Weltkriegen oder dem Kalten Krieg schützt.
Bereits vor der schweren Bank- und Finanzkrise im Herbst 2008 stellten sich die Schweizer Journalisten Fragen über die Position des Landes auf dem Schachbrett der Welt und über die Rolle, die dieses attraktive Einwanderungsland mit 9,5 Millionen Einwohnern bis 2030 in Zukunft spielen könnte. Handeln oder erdulden?
Pläne, Budgets, Jahresvergleiche und Analysen geben vor, einen sich wiederholenden Entwicklungsprozess anzutreiben, der Ungewissheiten reduziere. Was macht man aber, wenn die Zukunft keine Wiederholung, keine Neuauflage der Vergangenheit mehr ist, um sich ihr mit all ihrer Komplexität und Ungewissheit zu stellen und die Vergangenheit nicht länger einfach nur zu reproduzieren?
HEIDIS ACHT GEHEIMNISSE, DIE DIE ANDEREN RASEND MACHEN
Die Schweiz ist eines der reichsten Länder der Welt und bleibt ein politischer Zwerg, was uns wahrscheinlich ganz gelegen kommt. Wir sind eine Ausnahme. Der Jahresbericht des IMD (International Institute for Management Development) stellt uns auf den ersten Rang in Sachen Wettbewerbsfähigkeit, so auch das Weltwirtschaftsforum (WEF – World Economic Forum) mit einer Note von 5,7/7. Im Bereich Innovation behält die Schweiz ihren ersten Platz im Global Innovation Index 2013 und 2014, der jährlich von der Cornell University, der Business-School Insead und der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO – World Intellectual Property Organization) veröffentlicht wird. Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, räumt die Schweiz den ersten Platz im Country Brand Index (CBI) 2012/2013 ab, der von Futurebrand herausgegeben wird, und wird zudem als «Modellnation für eine moderne Ära» angesehen.
Im Nation Brands Index (NBI) von Präsenz Schweiz – dem Organ für die «Wahrnehmung der Schweiz im Ausland»– ist die Ehre gerettet, da wir 2012 und 2013 den 2011 verlorenen achten Platz zurückerobert haben.
Was haben wir also, was die anderen nicht haben? Welche Geheimnisse verbergen sich hinter dem Erfolg, der dieses Land mit acht Millionen Einwohnern zu einem so beliebten Sündenbock macht?
Wir verzichten auf die sieben Zwerge von Schneewittchen, die vielfach in den Schweizer Durchschnittsgärten hübsch aufgestellt vorzufinden sind, und schließen uns lieber Gerd Habermann bei seiner Aufzählung der sieben Geheimnisse an, die uns den Neid der anderen bescheren.
1) Glück ist eine Tugend: Eine ideale geografische Lage durch die Position als Knotenpunkt aller Transporte aus ganz Europa. Behüteter Wohlstand mit der Wahl der Neutralität, die von dem Wohlwollen der Großmächte in guten Zeiten wie in Kriegszeiten ermuntert wurde.
2) Die Ehrung der Geheimhaltung: Egal, ob es sich um das Bankgeheimnis, Pastoralgeheimnis oder die Schweigepflicht von Ärzten oder Anwälten handelt, die Schweiz stellt die Geheimhaltung und die Wahrung der Privatsphäre über alles. Eine Tradition der Geheimhaltung, die sich über Jahrhunderte hinweg entwickelt hat. Dank einer Bourgeoisie, die sich im Laufe der Jahre bereichern konnte und von den menschlichen und wirtschaftlichen Dramen, die ihre Nachbarländer erlitten haben, verschont geblieben ist.
3) Der Staat, das sind wir: «Die Schweiz ist in der Tat mehr eine ‹Genossenschaft› als eine ‹Herrschaft›», so der deutsche Wirtschaftsphilosoph Gerd Habermann. In der Schweiz ist die bürgerliche Gleichstellung ein Wert an sich. Die Bürger haben ein Mitspracherecht und können die Politik direkt beeinflussen: von der Wahl eines Richters bis hin zu unterschiedlichsten Abstimmungen. Das demokratische Arsenal ist beeindruckend: Bürgerinitiativen, Volksentscheide usw.
4) Die Non-Zentralisierung: Kein allmächtiges Staatsoberhaupt, sondern ein per Rotation jährlich gewählter Bundespräsident. Macht und Steuerhoheit befinden sich in den Händen der Kantone und Gemeinden, die Eidgenossenschaft hat nur ein prekäres Besteuerungsrecht. Es besteht keine zerstörerische Vorherrschaft der Parteien, sondern ein Ganz-Schweizerisches Gleichgewicht innerhalb des Bundesrats. Eine Bürokratie, die sicher nicht zu den dynamischsten zählt, aber auch nicht völlig bewegungslos ist.
5) Subsidiarität: Hiermit ist die Bewegung zur Eigenverantwortung gemeint, die von der untersten Ebene ausgeht und nach oben vordringt. Es handelt sich um eine Kompromissbereitschaft in Reinform. Zugeständnisse machen, um besser kooperieren zu können.
6) Kleine Fläche – strategisch wichtiger Knotenpunkt: Die geringe Größe der Schweiz (maximal ca. 350 km von West nach Ost gegenüber höchstens ca. 220 km in der Nord-Süd-Ausdehnung) ist eine Glückssache. Vor allem in turbulenten Phasen ist es stets einfacher, die Zukunft von acht Millionen Menschen (entspricht etwa einem Stadtviertel von Tokio) als von immensen Bevölkerungsansammlungen zu steuern. Zudem sind kurze Distanzen dialogfördernd und erleichtern die Verwaltung politischer Einheiten. Die Schweiz hat von jeher dank der Kontrolle der Alpenpässe von ihrer Lage als Knotenpunkt profitiert.
7) Ein willkommener Zufluchtsort: Sei es aus migratorischen, ökonomischen, steuerlichen, politischen oder intellektuellen Gründen. Schon immer hat die Schweiz auch hier von ihrer durch die Neutralität geförderten Mittler-Rolle profitiert.
Sicher ist die Schweiz ein Einwanderungsland, aber nur für «ausgewählte Zuwanderung».
8) Eine Verwaltung im Dienste des Volkes: Weitgehend auch Milizsystem genannt: Diese Verwaltung dient vor allem dem politischen Willen der Bürger und keinen privaten Interessengemeinschaften.
François Garçon erwähnt in seinem Buch Le modèle suisse, dass einer der Schlüsselfaktoren des Schweizer Erfolgs das System der direkten Demokratie sei. Der oft gerühmte Schweizer Föderalismus sei nichts anderes als ein dynamischer Prozess, der «nach einem Gleichgewicht zwischen zentripetalen und zentrifugalen Kräften sucht».
Das bedeutet herausragendes Know-how bei der Verteilung der Aufgaben. Also, unleugbare geopolitische Faktoren, die Stärke der Neutralität und die Tugend der Geheimhaltung. Zudem aber auch Föderalismus und Liberalismus, nationale Unabhängigkeit und auserwählte Immigration, nicht vorhandene Zentralisierung und eine Konsenskultur. Und außerdem: Garantien für Privateigentum und steuerliche Attraktivität. Deshalb werden wir beneidet. Nicht nur für unseren derzeitigen Erfolg, sondern vor allem, weil dieser Erfolg nicht nur das Ergebnis unseres politischen und wirtschaftlichen Systems ist. Das Glück hat sein Scherflein dazu beigetragen, und wir profitieren von dieser Grundrente, ähnlich wie in Frankreich, «dem Rentenland», wie Jacques Attali zu sagen pflegt. Können wir, um morgen fortzubestehen, dieselben siegreichen Schemata nach Lust und Laune wiederholen?
Wie sieht die Kehrseite der Medaille dieser allgemeinen Zufriedenheit, dieser den Schweizern ach so lieben Konsensbereitschaft aus? Macht diese Konsensbereitschaft nicht jede unternehmerische Regung, jeden Elan einer (alles in allem) gut ausgebildeten Jugend zunichte?
Das sind einige Tatsachen über die Schweiz von gestern. Aber was wird aus der Schweiz von heute? Sorgt sich überhaupt noch jemand um seine Zukunft? Sollte gar die Schweizer Jugend eine neue Vision in sich tragen, an der es heute so schmerzhaft fehlt? Wird sie den Mut besitzen, sich zu engagieren und den Status quo infrage zu stellen?
ZÜGELN WIR UNSEREN STOLZ!
«Die Schweizerinnen und Schweizer sind so stolz auf ihr Land (86 %) wie noch nie. Das geht so weit, dass sie sich stärker mit der Nation als mit der eigenen Wohngemeinde identifizieren», stellt das «Sorgenbarometer 2012» der Crédit Suisse fest. Dennoch bleiben die Angst vor Arbeitslosigkeit und vor Ausländern sowie die Reform der AHV (Alters- und Hinterlassenenversicherung) die Hauptsorgen der Schweizer. Was die Wirtschaftslage betrifft, blicken die Befragten zuversichtlich in die Zukunft, solange ihre Renten sicher sind. Die Mehrheit beurteilt die Situation mittelfristig als stabil, ein Fünftel ist davon überzeugt, dass sie sich verbessern wird. Nichts ist jedoch sicher. Das Schweizer Volk muss sich auf mehr Mäßigkeit und Solidarität mit der Welt gefasst machen und somit darauf, dass der Verlust einiger ihrer Privilegien unumgänglich ist. Was jedoch neu ist, ist, dass die Schweizer sich heute mit weitaus mehr Sorgen herumschlagen als zuvor. Das dürfen die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verantwortlichen nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Aber sind sie darauf vorbereitet?
Ein von Crédit Suisse 2013 veröffentlichter Artikel versetzt unserem Stolz einen Dämpfer:
1. Ein Land, das für Erpressung anfällig...
| Erscheint lt. Verlag | 19.2.2015 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management | |
| ISBN-10 | 3-906272-08-7 / 3906272087 |
| ISBN-13 | 978-3-906272-08-5 / 9783906272085 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich