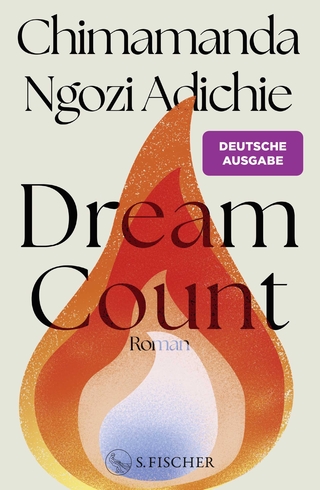Irgendwo in diesem Dunkel (eBook)
240 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-644-00165-7 (ISBN)
Natascha Wodin, 1945 als Kind sowjetischer Zwangsarbeiter in Fürth/Bayern geboren, wuchs erst in deutschen DP-Lagern, dann, nach dem frühen Tod der Mutter, in einem katholischen Mädchenheim auf. Auf ihr Romandebüt Die gläserne Stadt, das 1983 erschien, folgten zahlreiche Veröffentlichungen, darunter die Romane Nachtgeschwister und Irgendwo in diesem Dunkel. Ihr Werk wurde unter anderem mit dem Hermann-Hesse-Preis, dem Brüder-Grimm-Preis und dem Adelbert-von-Chamisso-Preis ausgezeichnet, für Sie kam aus Mariupol wurden ihr der Alfred-Döblin-Preis, der Preis der Leipziger Buchmesse und der Hilde-Domin-Preis für Literatur im Exil 2019 verliehen. 2022 wurde sie mit dem Joseph-Breitbach-Preis für ihr Gesamtwerk ausgezeichnet. Natascha Wodin lebt in Berlin und Mecklenburg.
Natascha Wodin, 1945 als Kind sowjetischer Zwangsarbeiter in Fürth/Bayern geboren, wuchs erst in deutschen DP-Lagern, dann, nach dem frühen Tod der Mutter, in einem katholischen Mädchenheim auf. Auf ihr Romandebüt Die gläserne Stadt, das 1983 erschien, folgten zahlreiche Veröffentlichungen, darunter die Romane Nachtgeschwister und Irgendwo in diesem Dunkel. Ihr Werk wurde unter anderem mit dem Hermann-Hesse-Preis, dem Brüder-Grimm-Preis und dem Adelbert-von-Chamisso-Preis ausgezeichnet, für Sie kam aus Mariupol wurden ihr der Alfred-Döblin-Preis, der Preis der Leipziger Buchmesse und der Hilde-Domin-Preis für Literatur im Exil 2019 verliehen. 2022 wurde sie mit dem Joseph-Breitbach-Preis für ihr Gesamtwerk ausgezeichnet. Natascha Wodin lebt in Berlin und Mecklenburg.
Es war ein stürmischer, verregneter Tag im Dezember. Ich steuerte das Auto durch die fränkische Mittelgebirgslandschaft, die kahl und abweisend unter den grauen, schnell ziehenden Wolken lag. Längst war der Ort, an dem ich den größten Teil meiner Kindheit und Jugend verbracht hatte, ein innerer Ort für mich geworden, der kaum noch Ähnlichkeit hatte mit der Realität, die ich jetzt durchs Autofenster sah. Der Wind schleuderte große, vereinzelte Regentropfen gegen die Windschutzscheibe, prallte in wütenden Böen aufs Dach.
Seit meinem letzten Besuch war eine lange Zeit vergangen. Ich fragte mich, ob die «Häuser» noch standen, in denen wir gewohnt hatten, die primitiven, für ehemalige Zwangsarbeiter erbauten Nachkriegsblocks, die außerhalb der ländlichen Kleinstadt lagen, an der Regnitz, die schon in den sechziger Jahren zu einem Teil des Rhein-Main-Donau-Kanals geworden war. Im Vorbeifahren konnte ich sie nicht sofort entdecken, erst auf den zweiten Blick begriff ich, was sich verändert hatte: Die Blocks waren verschwunden, jedenfalls deckte sich, was ich jetzt sah, nicht mit meiner Erinnerung. Mich blickten ganz neue, pastellfarbene Fassaden mit modernen Kunststofffenstern an, hinter denen Wohnungen mit Zentralheizung und Warmwasser zu vermuten waren. Man hatte die Blocks nicht abgerissen, ganz im Gegenteil, man hatte sie saniert. Es erschien mir unwirklich, aber nun gehörten sie zur Stadt, waren eingebettet in ein belebtes Neubaugebiet. Wer jetzt hier wohnte, sah aus den Fenstern nicht in die Wildnis, in das Niemandsland, das zwischen uns und den Deutschen gelegen hatte, sondern auf ein Einkaufszentrum an einer stark befahrenen Straße. Der einst abseitige, wie aus der Welt verbannte Ort war in einer gewöhnlichen Wohnlandschaft aufgegangen, im Organismus der Stadt, die für mich, als ich in den fünfziger und sechziger Jahren hier gewohnt hatte, der unerreichbare Planet der Deutschen gewesen war. Nichts hatte ich mir damals mehr gewünscht, als den «Häusern» zu entrinnen. Nun, im Jahr 1989, da kaum noch etwas an ihr früheres Erscheinungsbild erinnerte, war mir, als hätte man mir etwas genommen, das, ohne dass ich es wusste, ein Teil von mir geworden war.
Ich parkte vor dem Friedhof, wir stiegen aus. Meine Schwester machte eine zu laute, schrill klingende Bemerkung, Wolfgang, meine Freundin Heike und ich schwiegen. Zwei Minuten später standen wir vor der Scheibe des Leichenschauhauses, das mir von früher noch so gut bekannt war, und da sah ich ihn, den offenen Sarg, in dem der tote Körper meines Vaters lag. Der Anblick seines Todes erschien mir viel selbstverständlicher und natürlicher als das Leben seiner letzten Jahre.
Fast bis zu seinem siebzigsten Lebensjahr war er von zäher, beinah unnatürlicher Gesundheit gewesen, aber eines Nachts, als er zur Toilette gehen wollte, fiel er neben dem Bett hin und konnte nicht mehr aufstehen. Er war 1944 mit meiner Mutter aus der südukrainischen Hafenstadt Mariupol nach Deutschland gekommen, wo er als Zwangsarbeiter in einem Rüstungsbetrieb der Firma Flick arbeiten musste. Die ersten Jahre nach dem Krieg hatten wir in Lagern für Displaced Persons verbracht, schließlich wurde uns eine Wohnung in jenen Blocks zugewiesen, an denen ich eben vorbeigefahren war. Damals hatte man sie speziell für ehemalige Zwangsarbeiter erbaut, die, seit sie aus der Verantwortlichkeit der amerikanischen Besatzungsmacht entlassen und den deutschen Verwaltungsorganen übergeben waren, heimatlose Ausländer genannt wurden. Hier lebte mein Vater bis zu seinem Schlaganfall inmitten von Osteuropäern, auf einer Insel, auf der die deutsche Sprache weitgehend unbekannt war, allenfalls als eine Art Hilfsesperanto, mit dem sich die in babylonischer Sprachverwirrung lebenden Verschleppten aus dem gesamten osteuropäischen Raum radebrechend miteinander verständigten. In dem Altersheim, in das er nach dem Schlaganfall umziehen musste, befand er sich zum ersten Mal unter Deutschen, aber obwohl er jetzt Tür an Tür mit ihnen wohnte, gelang es ihm auch hier, seine deutsche Umwelt zu ignorieren – er lebte noch fünfzehn Jahre lang so weiter, als existiere diese Umwelt gar nicht. Die einzigen deutschen Wörter, die er in fast fünf Jahrzehnten in Deutschland gelernt hatte, waren «brauche» und «brauche nix». Das genügte ihm, um seiner deutschen Umgebung alles zu sagen, was er ihr zu sagen hatte.
Abgesehen von meiner Schwester, die weit entfernt wohnte und die er nicht öfter als einmal im Jahr sah, war ich, soviel ich wusste, bis zu seinem Tod der einzige Mensch, mit dem er sprach, einmal in vierzehn Tagen etwa, wenn ich ihn besuchte in seinem Zimmer mit Waschbecken und Balkon, den er nie benutzte, weil er den Blick in die Tiefe nicht mehr vertrug. Wie er sich mit dem deutschen Pflegepersonal verständigte, wusste ich nicht. In allen Angelegenheiten, die, wie minimal auch immer, über das Alltägliche hinausgingen, hatte er seit dem Tod meiner Mutter immer mich oder meine Schwester als Dolmetscherin gebraucht. Schon als Zehnjährige musste ich auf Ämtern dolmetschen, Formulare ausfüllen und alle anderen Verbindungen zur deutschen Umwelt herstellen, die sich nun einmal nicht vermeiden ließen. Seit das Leben meines Vaters in die Zuständigkeit der Medizin übergegangen war, wagte ich es kaum noch, meinen Wohnort zu verlassen, da ich jeden Augenblick gebraucht werden konnte zur lebensnotwendigen sprachlichen Vermittlung zwischen ihm und den Ärzten.
Im Jahr 1900 geboren, war er sein Leben lang immer so alt gewesen wie das Jahrhundert. Wann immer ich das Datum auf ein Blatt geschrieben hatte, standen die letzten zwei Zahlen für das Alter meines Vaters. Aber die Zeit blieb nicht stehen mit seinem Tod. Ich sah auf seine Leiche, und vor ihren Anblick schob sich ein weit zurückliegendes Bild, die Schlüsselszene unserer Beziehung. Ich war zehn Jahre alt, als meine Mutter sich im Oktober 1956 in der Regnitz ertränkte. Zu dieser Zeit war mein Vater nicht zu Hause, sondern auf Tournee mit dem russischen Kosakenchor, in dem er damals sang. Die Behörden suchten nach ihm, konnten ihn aber nicht finden. Mindestens zwei Wochen lang lag die Leiche seiner jungen Frau in einer Kühlkammer, während man erfolglos nach ihm fahndete. Ich hatte schon fast aufgehört, auf ihn zu warten, er schien für immer verschollen, da fand man ihn irgendwo in Spanien, und kurz darauf traf er zu Hause ein. Ich war gerade draußen, jemand rief es mir zu, und ich rannte sofort los, ich flog. Außer ihm und meiner Schwester, die erst vier Jahre alt war, hatte ich niemanden mehr. Er stand auf der Treppe vor unserer Wohnungstür, für die er keinen Schlüssel hatte, mit Hut, in seinem straff gegürteten Popelinemantel, neben ihm sein abgestellter Koffer. In meiner Vorstellung war ich jetzt, da seine Frau nicht mehr lebte, als die ältere seiner zwei Töchter ins Zentrum seines Lebens gerückt, seine erste Bezugsperson, mit der er alle wichtigen Dinge teilen und besprechen würde. Ich stürzte außer Atem auf ihn zu, aber in einer einzigen Sekunde prallte ich an ihm ab – an dem grün schimmernden Popeline seines Mantels, an seinem versteinerten Gesicht, in dem sich keine Miene verzog, als er mich erblickte. Er hatte im Treppenhaus nicht auf mich gewartet, sondern auf den Schlüssel. Wortlos nahm er ihn mir aus der Hand und schloss die Tür auf.
Auf meinem nächsten Erinnerungsbild saß er in der Küche und rauchte, eine Zigarette nach der anderen, Nacht für Nacht. Ich wusste, worüber er nachdachte, während er in den Rauch starrte, den er aus seinen Lungen ausstieß. Er musste wieder auf Tournee, er hatte nichts anderes als seine Stimme, um Geld zu verdienen, und er wusste nicht, wohin mit meiner Schwester und mit mir. Seine Frau hatte ihn allein gelassen mit den zwei Kindern, sie hatte ihn zum Witwer einer Selbstmörderin gemacht, ihn, den schon gealterten sechsundfünfzigjährigen Mann, den Fremdling, der sich mit nichts auskannte in Deutschland und keine Ahnung hatte, wie es jetzt weitergehen sollte. Ich stand im Nachthemd auf dem dunklen Flur und sah durchs Schlüsselloch in die Küche, sah meinen Vater am Tisch sitzen, mit seiner schwarzen Zigarettenspitze in der Hand, die er in kurzen Abständen zum Mund führte. Er saugte den Rauch mit zugekniffenen Augen ein, hielt ihn einen Atemzug lang in sich fest, dann stieß er ihn wieder aus, in das graue Gewölk, in dem er saß, reglos wie eine Sphinx, während sich hinter der steilen Falte auf seiner Stirn mein Schicksal entschied.
Immer, seit ich denken konnte, war es ein Fluch für mich gewesen, das Kind meiner Eltern zu sein. Ich wollte nicht zu einer Welt außerhalb der Welt gehören, zu den Fremden, den Aussätzigen, die hinter der Stadt wohnten, von allen gemieden und verachtet, irgendein Abschaum, von dem ich nicht wusste, wo er herkam und wie er entstanden war. Ich wollte deutsche Eltern haben, in einem deutschen Haus wohnen, wollte Ursula oder Susanne heißen. Nun, nachdem mein Vater eine Entscheidung getroffen hatte, kam ich der Erfüllung dieses Wunsches schwindelerregend nah.
Für meine Schwester hatte er eine Unterkunft bei zwei alten Frauen gefunden, die als einzige Deutsche noch hinter unseren Blocks in einem verwunschenen Häuschen am Fluss wohnten. Frau Lerner war eine aufgeschwemmte, herzkranke Alte mit wasserblauen Augen, die, wann immer meine Mutter sich über den Zaun hinweg mit ihr unterhalten hatte, um ihren Sohn weinte, der Pfarrer geworden war und irgendwo weit entfernt am Ort seiner Pfarrei lebte. Ihre winzige, ausgedorrte Schwester Kuni, eine alte Jungfer, ging so gekrümmt, als würde sie mit ihrer Nase die Erde pflügen. Wie mein Vater den beiden seinen Wunsch vermittelt hatte, eine seiner Töchter bei ihnen abzugeben, wusste ich nicht. Vielleicht hatte er...
| Erscheint lt. Verlag | 21.8.2018 |
|---|---|
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | 1961 • Aussenseiterdasein • Displaced Persons • Einmal lebt ich • Entwurzelung • Forchheim • Gewalt • Integration • Isolation • Nachkriegszeit • Preis der Leipziger Buchmesse • Regnitz • Russland • Schweigen • Sechziger Jahre • Sie kam aus Mariupol • Ukraine • Vater • Zwangsarbeiter |
| ISBN-10 | 3-644-00165-0 / 3644001650 |
| ISBN-13 | 978-3-644-00165-7 / 9783644001657 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 7,6 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich