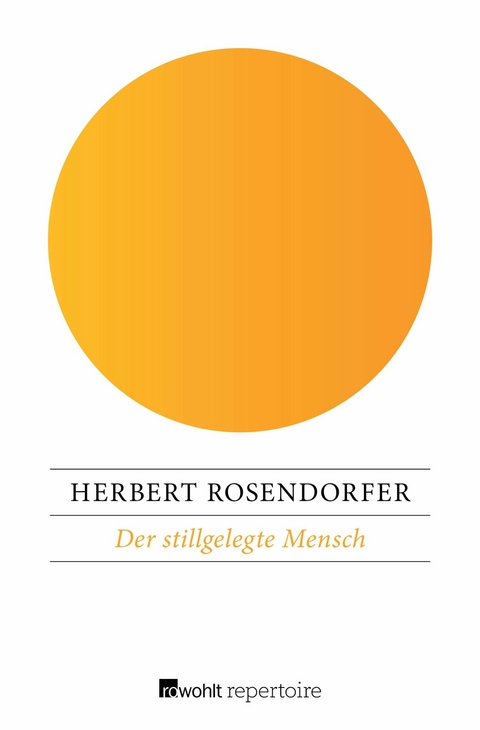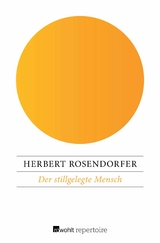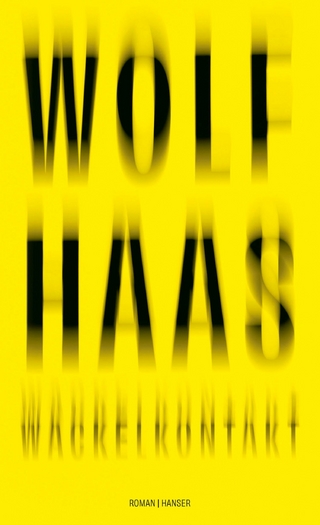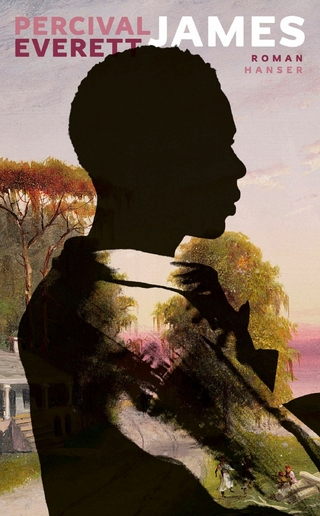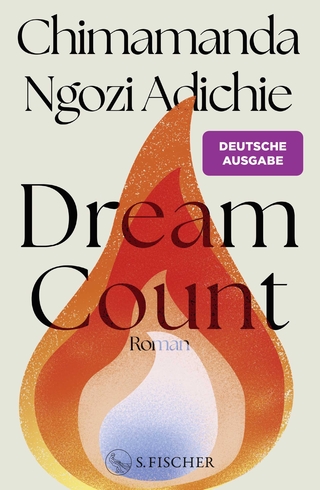Der stillgelegte Mensch (eBook)
124 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-688-11251-7 (ISBN)
Herbert Rosendorfer wurde 1934 in Bozen/Südtirol geboren und wuchs in München und Kitzbühel auf. Nach dem Abitur studierte er zunächst an der Kunstakademie, dann Jura. Er lebte als Amtsgerichtsrat in München. 1970 erschien sein erster Roman «Der Ruinenbaumeister». Rosendorfer starb 2012 in Bozen.
Herbert Rosendorfer wurde 1934 in Bozen/Südtirol geboren und wuchs in München und Kitzbühel auf. Nach dem Abitur studierte er zunächst an der Kunstakademie, dann Jura. Er lebte als Amtsgerichtsrat in München. 1970 erschien sein erster Roman «Der Ruinenbaumeister». Rosendorfer starb 2012 in Bozen.
Knabe, mit einer Katze spielend
Der alte Oberstaatsanwalt F. erzählt:
Wenn Sie von hier aus zum Café ‹Hippodrom› gehen, das Sie ja, meine lieben jungen Kollegen, besser kennen als die Strafprozeßordnung, kommen Sie an einem alten Brunnen vorbei. Gleich neben dem Brunnen öffnet sich die Häuserfront ein wenig, denn dort mündet eine stille Gasse in den Lärm des vorüberflutenden Verkehrs – einer der wenigen stillen Winkel, die wir hier herum noch haben. Die stille Gasse erweitert sich drinnen ein wenig und bildet an der ziemlich schäbigen Hinterfassade eines großen Hotels einen dreieckigen Platz, den die alten Leute ‹Blasiusbergl› nennen; kein Mensch weiß warum, denn es geht dort weder bergauf noch bergab. Es ist wohl auch längst gleichgültig, denn die Gasse heißt inzwischen Straße und benennt sich nach irgendeinem vermutlich verdienstvollen Bürgermeister oder Bischof.
Das ‹Blasiusbergl› wird von der erwähnten schmutzigen sechsstöckigen Fassade der Hotelrückseite beherrscht, aber in ihrem Schatten gibt es ein paar alte Häuser, und in einem dieser Häuser würden Sie, ohne lange suchen zu müssen, einen jahraus, jahrein verschlossenen Laden finden, über dem in langsam abblätternden Goldbuchstaben ‹Kunsthandlung Krantz› steht. Im Mordfall Krantz hat es nie ein Urteil gegeben, obwohl nicht nur ich den Mörder kenne. Ob allerdings der Mörder heute noch lebt, weiß ich nicht, denn die Sache liegt viele Jahre zurück.
Anselm Krantz, der alleinige Inhaber der Kunsthandlung Krantz, war ein Sonderling gewesen. Ich habe ihn noch als Lebenden gekannt, war hie und da in seinem Laden und habe natürlich nicht geahnt, daß ich ihn eines Tages als Toten, als gräßlich verstümmeltes Opfer eines Mordes würde sehen müssen. Krantz lebte ganz allein, war unverheiratet, hatte keine näheren und, wie sich nach seinem Tod herausstellte, kaum entferntere Verwandte, hatte keinen Anhang und, jedenfalls schien es so, auch keine Freunde. Er war, sooft man in seinen Laden kam, gleichbleibend unfreundlich und strahlte ein penetrantes Mißtrauen aus, wie ich es sonst kaum jemals bei einem Menschen beobachtet habe. Es mag sein, daß das auf sein körperliches Gebrechen zurückzuführen war: der große, füllige Mann war verwachsen. Er hatte einen Buckel wie der Glöckner von Notre Dame. Mag sein, dies war schuld an seinem ständigen Mißtrauen, mag sein, auch etwas anderes …
Er war übrigens ein wirklicher Kunsthändler, ein Fachmann von Rang und nicht etwa einer von den zahlreichen größenwahnsinnigen Gemüsehändlern, die jetzt alte Kaffeemühlen verkaufen, so wie sie früher Gurken und Zichorie verkauft haben. Krantz galt als Spezialist für Ostasiatica und handelte außerdem sehr viel mit moderner Graphik.
Der Mord an Anselm Krantz wurde deswegen in Anbetracht der Krantzschen Lebensgewohnheiten verhältnismäßig rasch entdeckt, weil die Inhaber der Nachbarläden bemerkten, daß Krantz’ Laden einige Tage lang geschlossen blieb, wobei nur das Scherengitter vor den beiden Auslagen und der Tür geschlossen war, während Krantz, wenn er – was öfter vorkam – verreiste, stets auch die Rolläden herunterzog und an der Tür einen Zettel anzubringen pflegte, auf dem er für seine Kunden die Dauer seiner Abwesenheit vermerkte. Nie, ohne jede Ausnahme in all den Jahren, in denen er sein Geschäft betrieb, hatte er einen Angestellten oder eine Aushilfe, einen Buchhalter und nicht einmal eine Putzfrau beschäftigt.
Man fand Krantz in seinem Schlafzimmer. Die Wohnung lag hinter seinem Laden, auch zu ebener Erde. Wohnung ist dabei fast zuviel gesagt. Krantz hatte offenbar schon vor Jahren die hinteren Nebenräume seines Ladens zu einem Schlafzimmer, einer Art Wohnküche und einem Bad ausbauen lassen. Mehr brauchte Krantz wohl nicht, denn eigentlich lebte er im Laden zwischen seinen antiken Möbeln, von denen er immer nur soviel verkaufte, daß eine notdürftige Einrichtung zurückblieb.
Die hinteren Räume waren finster, verwinkelt und glichen einem Fuchsbau. Es gibt solche Häuser, die sich, an der Straßenfront schmal und engbrüstig, wie Kitt in einer verzahnten Fuge hinziehen und ausdehnen, an der unglaublichsten Stelle einen Innenhof haben und vielleicht sogar – wo man es am wenigsten erwartet – einen Garten. So ein Haus war das, in dem Krantz seinen Laden hatte. Sein Schlafzimmer war gewissermaßen das hintere Ende seines ‹Fuchsbaues›, und von dort aus führte nach einem kleinen Flur ein Separateingang auf eine ganz andere Straße hinaus. Eines war von vornherein klar, aber das half nicht viel, daß der Mörder durch diese hintere Tür die Wohnung nach der Tat verlassen haben mußte. Ob er die Wohnung auch durch diese Tür betreten hatte, war schon ungewiß.
Krantz lag mit dem Gesicht zur Erde mitten im Zimmer auf dem Boden. Er war nur mit Unterwäsche und einem Morgenmantel bekleidet. Die Arme waren seitwärts ausgestreckt. Die rechte Hand umklammerte die Lehne eines umgefallenen Stuhles. Krantz’ Schädel war völlig zertrümmert. Die Obduktion ergab, daß fünfzehn bis zwanzig Schläge mit einem stumpfen Gegenstand gegen den Schädel geführt worden waren. Da seit der Tat fünf bis sechs Tage vergangen waren, ehe man die Leiche fand, war sie schon in Verwesung übergegangen. Vor allem der zertrümmerte Schädel war grünlich verfärbt, und, mit allem Respekt vor dem lebenden Krantz, der tote stank bereits fürchterlich, als ich mit der Mordkommission – ich war damals Erster Staatsanwalt und hatte eines der Kapitaldeliktsreferate – das Zimmer betrat.
Der Polizeifotograf war gerade dabei, die Leiche und den Tatort zu fotografieren. Ich bemühte mich, den toten Krantz möglichst wenig zu sehen und vor allem nicht zu riechen, und schaute mir das Zimmer an. Ein großes, schweres Eichenbett war zerwühlt, aber nicht von einem Schlafenden, sondern so, als wäre jemand mehrmals auf das gemachte Bett geworfen worden. Das Bettzeug war blutverschmiert. Ein großer Blutfleck hatte den wertvollen alten persischen Seidenteppich getränkt, der offensichtlich vom gewaltigen Fall Krantz’ zusammengeschoben und aufgefaltet war. Neben der übrigen Unordnung, die, wie es so heißt, darauf schließen ließ, daß sich das Opfer verzweifelt gewehrt hatte, fielen vor allem drei Dinge auf: eine große bronzene Buddha-Statue, die mit Blut verschmiert und vermutlich der stumpfe Gegenstand war, mit dem der Mörder sein Opfer erschlagen hatte, weiter die Scherben einer großen chinesischen Vase, die keine Blutspuren aufwies, also vielleicht von Krantz dem Mörder auf den Kopf geschlagen worden war, und schließlich ein zierlicher Biedermeier- Sekretär aus Kirschbaumholz, dessen Schubladen durchwühlt worden waren. Es ergab sich also, um hier gleich spätere Erwägungen vorwegzunehmen, die Frage, ob der Mord an Krantz ein Raubmord war. Ob der Mörder in Krantz’ Sekretär nach Geld gesucht hatte oder nach etwas anderem, wußten wir nicht. Unter den ganzen Papieren, die verstreut an, in und um den Sekretär lagen, befand sich kein Geld. Ob der Mörder kein Geld gefunden oder aber das vorhandene Geld mitgenommen hatte, konnten wir nicht feststellen, weil ja niemand über Krantz’ Vermögensverhältnisse Bescheid wußte und ob und wo er Geld aufbewahrt hatte. Die Polizei neigte zur These ‹Raubmord›, denn auf dem Stuhl vor dem Sekretär lag eine große leere Geldtasche, eine Geldtasche, wie sie etwa Kellner haben: aus schwarzem Leder, ziehharmonikaförmig gefaltet, mit vielen Fächern. Mir schien aber diese Geldtasche so auffällig, so absichtsvoll und ins Auge springend hingelegt, als habe der Mörder seinen künftigen Verfolgern keinen Zweifel an seiner Raubabsicht lassen wollen. Diese leere Geldtasche war förmlich aufgepflanzt wie eine Fahne des Eroberers auf der gefallenen Festung. Das ist, drängte es sich mir auf, eine absichtliche Fährte, also eine falsche Fährte. Brauchbare Fingerspuren und ähnliches gab es übrigens nicht. Das Türschloß zur Wohnung war unversehrt, das hieß, das Opfer mußte seinen Mörder freiwillig in die Wohnung gelassen haben. Hatte das Opfer ihn gekannt?
Mit meinem Verdacht über die falsche Fährte kam ich bei der Polizei nicht recht an. Es war ja auch nur ein unwägbares, kaum zu schilderndes Gefühl bei mir. Demgegenüber brachte die Polizei sehr bald heraus, daß der Mörder tatsächlich etwa achthundert Mark mitgenommen haben mußte. Das war ziemlich einfach zu ermitteln, denn man überprüfte Krantz’ Bankkonten und seine recht sorgfältige Buchführung und kam so auf den fehlenden Betrag. Gut, sagte ich, der Mörder hat das Geld mitgenommen. Das besagt aber lange noch nicht, daß er es auf das Geld abgesehen hatte.
Es war da nämlich noch etwas anderes. Die große Buddha-Statue, mit der der Mörder Krantz erschlagen hatte, gehörte nicht zum Mobiliar von Krantz’ Schlafzimmer, sondern hatte vorher vorn im Laden gestanden. Der Buddha hatte einen eigenartig achteckigen Sockel mit geschweiften Ecken. Wir fanden vorn im Laden eine Stelle, einen Fleck, wo genau achteckig-geschweift weniger Staub war als rundherum. Der Sockel paßte genau auf den Fleck. Der Buddha mußte dort gestanden haben, und das war unmittelbar neben einer alten, gußeisernen Registrierkasse. In dieser Kasse waren 4000 Mark. Es war nämlich offenbar so, rekonstruierten wir, daß Krantz seine Tageseinnahmen jeden Abend mit nach hinten nahm und in die große Geldtasche tat. Alle zwei oder drei Wochen zahlte er, wenn er nicht irgend etwas ankaufte, das gesammelte Geld bei der Bank ein. Etwa zehn Tage, bevor er getötet wurde, hatte Krantz das letztemal etwas auf die Bank eingezahlt. In den zehn Tagen hatte er dann die vom Mörder mitgenommenen achthundert Mark eingenommen. (Angekauft hatte er in dieser Zeit nichts, das hätte er, wie stets, in...
| Erscheint lt. Verlag | 20.7.2018 |
|---|---|
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | Absurdität • Adel • Eigenarten • Esoteriker • Künstler • Militär |
| ISBN-10 | 3-688-11251-2 / 3688112512 |
| ISBN-13 | 978-3-688-11251-7 / 9783688112517 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 691 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich