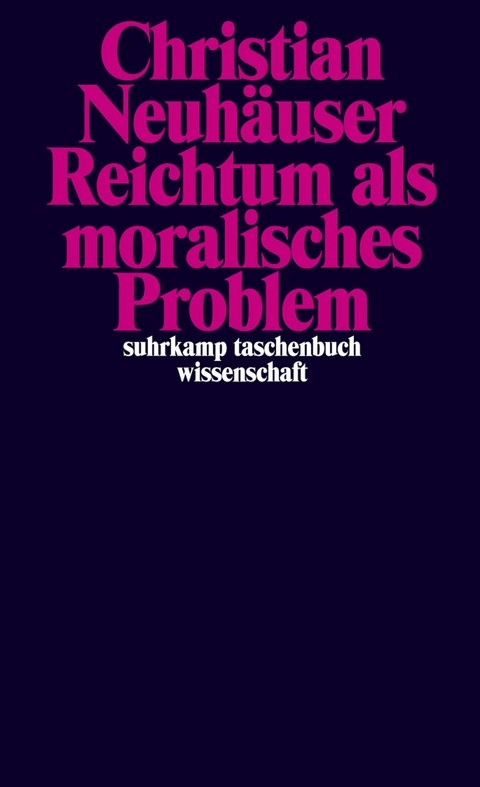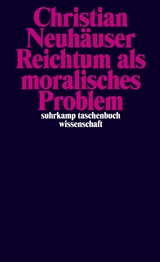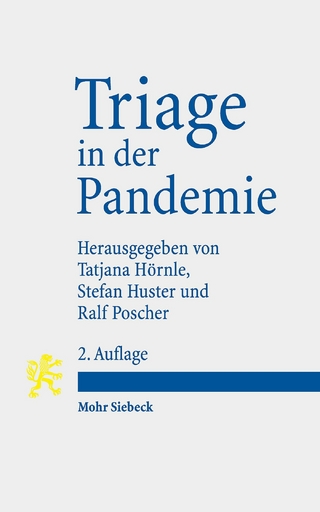Reichtum als moralisches Problem (eBook)
281 Seiten
Suhrkamp (Verlag)
978-3-518-75778-9 (ISBN)
Reichtum gilt als gut, sogar als begehrenswert. Selbst wer nicht nach ihm strebt, würde ihn kaum zurückweisen, und wer anderen ihren Reichtum nicht gönnt, gilt schnell als neidisch. Christian Neuhäuser stellt in seinem neuen Buch solche Selbstverständlichkeiten in Frage und behauptet: Man kann nicht nur reich, man kann auch zu reich sein. Er zeigt, dass das gesellschaftliche Streben nach immer mehr ein Zusammenleben in Würde gefährdet und argumentiert für einen Umgang mit dem erreichten Wohlstand, der deutlich verantwortungsvoller ist als derjenige, den wir gegenwärtig pflegen.
<p>Christian Neuhäuser ist Professor für Praktische Philosophie an der TU Dortmund. Zuletzt erschienen: <em>Unternehmen als moralische Akteure</em> (stw 1999) und<em> Reichtum als moralisches Problem</em> (stw 2249).</p>
Christian Neuhäuser ist Professor für Praktische Philosophie an der TU Dortmund.
17Kapitel 1:
Reichtum, Gerechtigkeit und Anständigkeit
Im Jahre 2014 betrug das Bruttoweltprodukt 71 830 Milliarden US-Dollar.[1] Das ist eine kaum vorstellbar große Zahl und jedenfalls ziemlich viel Geld. Sind wir, ist die Menschheit also reich? Vor 200 Jahren betrug das Bruttoweltprodukt nur etwa 175 Milliarden US-Dollar. Der Reichtum der Menschheit hat sich also vervierhundertfacht. Die frühen Ökonomen des klassischen Liberalismus haben davon geträumt, dass die Menschheit durch Reichtum das Problem der ökonomischen Knappheit überwinden wird. Ist dieser Traum in Erfüllung gegangen und endlich die Phase eines unvorstellbaren Überflusses eingetreten? Wenn das so ist, dann haben die meisten von uns das jedenfalls noch nicht so richtig bemerkt.[2] Zwar trifft es zu, dass es in den letzten 200 Jahren zu jenem rasanten ökonomischen Wachstum aufgrund einer enorm gesteigerten Produktivität gekommen ist, wie beispielsweise bereits Adam Smith gehofft hatte.[3] Allerdings gibt es auch eine lange Reihe von Problemen, die entweder bestehen blieben oder gerade neu entstanden sind. Noch immer leben sehr viele Menschen in absoluter oder relativer Armut. Einkommen sind weiterhin sehr und sogar zunehmend un18gleich verteilt. Viele Menschen finden überhaupt keine und noch mehr Menschen keine anständige Arbeit. Zahlreiche Länder sind nicht demokratisch verfasst, und selbst in Europa nimmt die vernünftige politische Selbstbestimmung der Bürger rasant ab. Märkte und insbesondere Finanzmärkte werden zunehmend instabil und unkontrollierbar, was desaströse Konsequenzen hat. Dem Klimawandel und seinen Folgen stehen wir trotz unserer großen materiellen Ressourcen ziemlich hilf- oder zumindest tatenlos gegenüber.
Man könnte auf diese Probleme mit dem Hinweis reagieren, dass wir eben noch nicht reich genug seien. Die etwas mehr als 70 000 Milliarden Dollar reichen eben einfach noch nicht aus. Die Wirtschaft muss noch weiter wachsen, das Bruttoweltprodukt noch größer werden. Erst dann werden wir in der Lage sein, die genannten Probleme auch zu lösen, so der Gedanke. Die zentrale wirtschaftspolitische Aufgabe bestünde dann weiterhin darin, mehr ökonomisches Wachstum zu organisieren. Alles andere wäre nachrangig. Man könnte demgegenüber aber auch auf die Idee kommen, dass die Menschheit insgesamt eigentlich schon reich genug ist und die genannten Probleme sich durch mehr Wachstum nicht mehr lösen lassen. Dann liegt die Wurzel dieser Schwierigkeiten möglicherweise eher in der ungleichen Verteilung des Reichtums, und die Wirtschaftspolitik müsste vor allem auf Umverteilung und nicht auf Wachstum ausgerichtet werden. Tatsächlich lassen sich in der gegenwärtigen Politiklandschaft und politischen Ökonomie beide Positionen finden, und beide haben offensichtlich einigen Einfluss auf die unterschiedlichen Programme verschiedener politischer Parteien.
Es gibt aber auch noch eine dritte Möglichkeit, die bis vor kurzem kaum ausgesprochen – an die kaum einmal gedacht wurde. Vielleicht sind wir ja sogar zu reich und haben zu viele materielle Güter. Dann wären mehr Wachstum und mehr Reichtum nicht nur wenig hilfreich, sondern sogar schädlich. Die Politik müsste dann für Postwachstum oder sogar für eine ökonomische Schrumpfung sorgen. Wir dürften folglich nicht noch reicher, sondern müssten sogar ärmer werden. Bescheidenheit wäre das neue Paradigma für Wirtschaft und Politik. Vor dem Hintergrund des Klimawandels, aber auch aufgrund der demographischen Entwicklung in vielen hochentwickelten Ländern, die zu einer schrumpfenden Bevölkerung und damit zu einer geringeren Arbeitsleistung führt, sowie 19der anhaltenden Konjunkturschwäche der Weltwirtschaft wird diese Position inzwischen tatsächlich diskutiert, auch wenn sie noch keine politische Wirkungsmacht entfaltet.[4] Kann es also stimmen? Sind wir vielleicht zu reich?
Reichtumsprobleme
Ist Reichtum ein moralisches Problem oder zumindest eine Quelle moralischer Probleme? Diese Frage klingt zunächst seltsam, haben wir doch üblicherweise eine äußerst positive Einstellung zum ökonomischen Reichtum. Wer will denn nicht reich sein? Oder ein klein wenig reicher zumindest? Unsere unreflektierten subjektiven Wünsche verraten natürlich wenig darüber, ob Reichtum objektiv betrachtet ein Problem darstellt oder nicht. Es gibt aber auch allgemeine Argumente für dessen positive Bewertung. Bereits Bernard Mandeville und Adam Smith haben wirtschaftliches Reichtumsstreben geradezu zur Bürgerpflicht erklärt, weil solch ein Streben das Allgemeinwohl in Form eines Wirtschaftswachstums besonders gut fördere.[5] Nicht zuletzt durch den Einfluss dieser Denker und ihrer Nachfolger ist eine gewisse Reichtumsorientierung und Reichtumskultur zum festen Bestandteil des kulturellen Selbstverständnisses der europäischen Länder und zum ideengeschichtlichen Exportschlager geworden.[6] Unsere subjektiven Einstellungen zu Reichtum sind stark von dieser inzwischen schon jahrhunder20tealten Tradition geprägt. Dennoch wird es vielleicht Zeit, sie zu hinterfragen.
Eine positive Einstellung gegenüber Reichtum gibt es natürlich auch in anderen Kulturen und ihren Weltanschauungen, beispielsweise im Konfuzianismus.[7] Neu ist seit Smith eher die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Frage, wie sich das Wirtschaftsleben besonders gut auf Reichtumssteigerung ausrichten lässt. Die positive Reichtumsorientierung hat so in Gestalt der politischen Ökonomie ein wissenschaftliches Fundament bekommen.[8] Das hat nicht nur zu einem enormen Wirtschaftswachstum geführt, sondern Reichtum auch noch fester in sozialen Strukturen verankert. Diese Verankerung erscheint mir inzwischen so fest zu sein, dass eine kritische Auseinandersetzung mit Reichtum lange Zeit kein Thema und fast schon ein Tabu war.[9] Natürlich war und ist es weiterhin möglich, einzelne Menschen für ihren obszönen Reichtum zu kritisieren. Zwar besteht die Reaktion auf solch eine Kritik häufig aus einer Gegenkritik in Form des Neidvorwurfes. Dennoch mehren sich in den letzten Jahren kritische Stimmen gegenüber den sogenannten Superreichen und finden zumindest in der kritischen Zivilgesellschaft auch Gehör.[10]
21Demgegenüber befindet sich eine breiter und fundierter angelegte Reichtumskritik mit Blick auf eine gesamtgesellschaftliche Reichtumsorientierung eher noch in der Anfangsphase. Dabei geht es nicht so sehr um einige Superreiche und die Frage, ob diese ihren Reichtum verdient haben oder nicht und ob es obszön ist, wenn einzelne Menschen mehrere Milliarden Dollar besitzen. Das sind alles wichtige Fragen, die in diesem Buch hin und wieder auch angesprochen werden. Aber sie haben nur eine begrenzte Reichweite und lenken von dem eigentlichen Problem allzu schnell ab. Die zentrale Frage lautet nämlich, ob und inwiefern die geradezu singuläre Orientierung von Wirtschaft und Politik auf die Steigerung des Bruttosozialproduktes durch Wachstum der Gütermenge auf fundamentale Weise problematisch und entsprechend kritikwürdig ist. Vor dem Hintergrund des drohenden Klimawandels entwickelt sich unter dem Stichwort Postwachstum allmählich eine Debatte zu dieser Thematik.[11] Dazu möchte ich einen philosophischen Beitrag leisten. Allerdings geht es mir tatsächlich ganz allgemein darum, danach zu fragen, ob ökonomischer Reichtum und unser Umgang mit Reichtum ein moralisches Problem darstellen.
Der Klimawandel ist wahrscheinlich das Beispiel, bei dem diese Fragestellung besonders schnell einleuchtet. Ich möchte ihn und andere Beispiele hier kurz vorstellen, um sie dann im fünften und sechsten Kapitel ausführlich zu diskutieren. Die gegenwärtige gesellschaftliche Reichtumsorientierung geht mit einem Primat des ökonomischen Wachstums einher. Denn nur durch Wirtschaftswachstum lässt sich ständig eine neue Pareto-Superiorität herstellen, so dass einige reicher und niemand ärmer wird.[12] Inzwischen zeigt sich aber sehr deutlich, dass eine große und zunehmende Wirtschaftsleistung ...
| Erscheint lt. Verlag | 12.3.2018 |
|---|---|
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Philosophie ► Ethik |
| Geisteswissenschaften ► Philosophie ► Philosophie der Neuzeit | |
| Schlagworte | Altruismus • Kapitalismus • Moralphilosophie • STW 2249 • STW2249 • suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2249 • Würde |
| ISBN-10 | 3-518-75778-4 / 3518757784 |
| ISBN-13 | 978-3-518-75778-9 / 9783518757789 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,7 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich