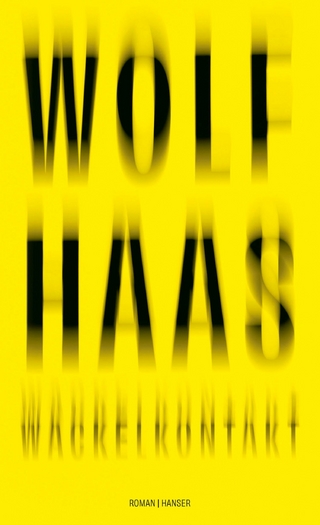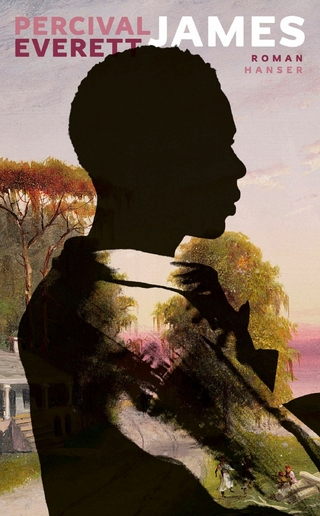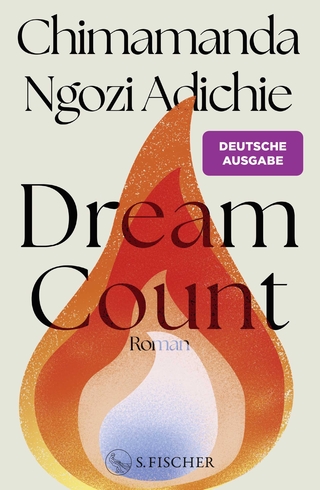Die Prinzessinnen im Krautgarten (eBook)
240 Seiten
S. Fischer Verlag GmbH
978-3-10-490641-6 (ISBN)
Wulf Kirsten wurde 1934 in Klipphausen bei Meißen geboren und starb 2022 in Weimar. Nach seinem Pädagogikstudium arbeitete er kurzzeitig als Lehrer, war dann von 1965 bis 1987 Lektor des Aufbau Verlags. Seitdem lebte er als freier Schriftsteller in Weimar. Er war Stadtschreiber in Salzburg, Dresden und Bergen-Enkheim. Für sein literarisches Schaffen wurden ihm zudem u.a. der Peter-Huchel-Preis und der Joseph-Breitbach-Preis verliehen, zuletzt 2015 der Thüringer Literaturpreis.
Wulf Kirsten wurde 1934 in Klipphausen bei Meißen geboren und starb 2022 in Weimar. Nach seinem Pädagogikstudium arbeitete er kurzzeitig als Lehrer, war dann von 1965 bis 1987 Lektor des Aufbau Verlags. Seitdem lebte er als freier Schriftsteller in Weimar. Er war Stadtschreiber in Salzburg, Dresden und Bergen-Enkheim. Für sein literarisches Schaffen wurden ihm zudem u.a. der Peter-Huchel-Preis und der Joseph-Breitbach-Preis verliehen, zuletzt 2015 der Thüringer Literaturpreis.
Der Hof
Da ich keine falschen Vorstellungen aufkommen lassen möchte, gestehe ich lieber gleich, daß unser Hof in Wirklichkeit gar keiner war. Jedenfalls nicht das, was man gemeinhin mit einem so bezeichneten Ort verbindet. Man kann in dieser Bezeichnung den Wunsch erkennen, der sich in dieser verbalen Aufbesserung zu erkennen gab: einen richtigen Hof zu besitzen. Räumlich, der puren Platznot geschuldet, ließ sich dies jedoch nicht bewerkstelligen. Unser Hof war nur ein halbwegs eben gemachter Gang vor der Längsseite des Hauses von allenfalls doppelter Breite einer Heiste. Eingezwängt zwischen Garten und Schuppen, der nur ein Schauer war. Dieser bescheidene Anbau war im rechten Winkel ans Haus gesetzt worden. Bis in urgroßväterliche Zeiten hatte er als Schmiedewerkstatt gedient. Ein paar vom Rost angenagte Ackerwagenreifen galten als Beweisstücke für diese Behauptung. Das Mauerwerk war quer von stattlichen Rissen durchzogen. Die nicht tief genug gesetzte Grundmauer auf der laufenden Berglehne, die bestrebt war, nach Wettergüssen ins Tal der Wilden Sau zu gelangen, wollte nicht aufhören, sich zu senken. Der zu gewärtigende Einsturz ließ jedoch wunderbarerweise auf sich warten. Jahr um Jahr. Immerhin solange meine Kindheit währte. Zuweilen wurden die Risse, von denen es halb scherzhaft, halb verächtlich hieß, man könne durch sie einen Hut werfen, mittels saftiger Kellenladungen zugeworfen, zugestopft und am Ende einigermaßen geglättet mit der blanken Kellenunterseite und dem Streichbrett, das zur Hand zu sein hatte. Wie sorgfältig auch ausgeschmiert wurde, es blieb auf Dauer ein vergebliches Unterfangen. Denn bald zeigten die Risse ihr Geäder, das sich durch die Bruchsteinwand zog, wieder in alter Schönheit.
Hinter dem auf einer teils meter-, teils mannshohen Trockenmauer stehenden Lattenzaun, der so lawede geworden war, daß er längst einer Erneuerung bedurft hätte, fiel der Berg sogleich ab bis in den Talgrund, aus dem das geschwätzige Gemurmel des Baches heraufdrang, das alle Zuhörer auf eine mildherzige Weise zu beruhigen und zu besänftigen wußte. Für alle Dorfbewohner blieb das über ein steinernes Geröllbett schlürfende Wasser immer und ewig nur die Bach. Dieser stete, festgewordene Genusgebrauch prägte diese Form so hart, daß ich späterhin in anderen Regionen meine Schwierigkeiten haben sollte, mich an den Gebrauch des maskulinen Artikels zu gewöhnen. Und ich muß gestehen, in meinen Ohren klingt die Bach auch heute noch viel passender und schöner als der Bach.
Das normalerweise ausgesprochen friedfertige Nebenflüßchen der Elbe wußte eine beachtliche Fülle vokalisierter Wasserzustands- und Befindlichkeitsformen von sich zu geben. Je nach Wasserführung. Wir verstanden die Sprache des fließenden Wassers, das es unterhalb unseres Hauses ein wenig eiliger hatte als andernorts, ganz gut. So wie bei lang anhaltender Sommertrockenheit die Bach ganz verstummen konnte, ließ sie nach starken Regenfällen ein geradezu leidenschaftliches Rauschen und Gurgeln vernehmen. Ganz zu schweigen von jenen gefährlichen Tagen, an denen sie Hochwasser mit sich führte und zum reißenden Strom wurde, der breit über die Ufer trat und die Brückenbögen zu zerstören trachtete. Dann lag das harmlose Flüßchen den Anliegern im Tale bedrohlich genug in den Ohren, während wir oben auf dem Berge nichts von ihm zu befürchten hatten. Unser Teil war und blieb immer nur sein Gesang.
Der mit Apfel- und Birnbäumen geschmückte Wiesenhang, auf den sich zwei Eichen und eine Salweide selbsttätig eingeschmuggelt hatten, gehörte zur Rittermühle und wurde als Futterfläche genutzt. Nutznießer waren die beiden Pferde, die vor den Brotwagen gespannt wurden und sich als Feldbesteller zu bewähren hatten. Im Mai schäumte die Berglehne zu einem einzigen weißen Blütenmeer auf. Wer würde heutzutage noch an einem solchen Hang die Sense schwingen wollen? Wozu auch? Auf den Bandstegen, die sich in gleichmäßig gewellten Linien am Bergrücken entlangzogen, ließ sich der Schiebbock nur mit großem Geschick bugsieren. Wenn er hoch mit Gras bepackt war, Sense, Gabel, Rechen tief in die Ladung gestochen, mußten der Müller oder seine Viehmagd höllisch aufpassen beim Schieben und Balancieren mittels der beiden Holme, um nicht samt Ladung und Gefährt von der schmalen Fahrbahn abzukommen.
Auf diesem abschüssigen Gelände, in dessen Umzäunung sich immer wieder ein Durchschlupf fand, hatten sich die Kinder der Nachbarschaft unveräußerbare Besitzerrechte eingeräumt. Der Wiesenhang zwischen dem Mühlgraben und unserem Gartenzaun war ein Ort, an dem es sich wunderbar ungestört spielen ließ. Aber auch einfach dazusitzen, zu beobachten, ins Tal und ins Dorf zu blicken, dem blanken Müßiggang zu obliegen, geriet, wenn ich es leibhaftig bin, den ich da in meiner Erinnerung sehe, zu intensiver Weltbetrachtung aus eigenem Anschauen, wo nichts im Husch vorüberflog, wo man vielmehr alles schön langsam in sich einziehen lassen konnte.
Der wettergeschützte Hof wäre ein idealer Ort für Sonnenbäder gewesen. Des öfteren schlugen Besucher meinen Eltern vor, die Freilandterrasse zu überdachen und in eine Veranda zu verwandeln. So dachten Städter. Der Hof blieb ein Arbeitsplatz. So wie er dem Gelände abgerungen und eingerichtet war, schien er die einzig mögliche Fasson zu haben. Die vielen Gegenstände und Materialien, die auf dem Hof ihren Platz finden und halten mußten, warteten darauf, gebraucht zu werden. Schubkarre, Hackstock, Wäscheböcke und gegabelte Wäschesteifen standen auf Armlänge jederzeit griffbereit. Mittendrin noch eine Schattenmorelle. Eine selbstverständliche Ordnung, die sich aus Unordnung zusammensetzte. So wie minus mal minus plus ergibt. Ein phantastisches Ergebnis dieser Umschlag. Enge und Schlichtheit wurden nie als solche wahrgenommen. Etwa mit einem Gefühl des Bedauerns. Großzügigkeit konnte unter solchen Umständen allerdings schwerlich gedeihen. Erst viel später ging mir auf, welcher Reichtum und welche bereichernde Dingfülle in dem so bescheiden dimensionierten Geviert beschlossen lagen und welchen Schutz dieser Platz bot. Nicht nur vor den rauhen Winden, die sich dem Haus auf dem Berge klangreich mitteilten, besonders deutlich, wenn sie im Ofenrohr winselten und wir diese Ankündigung eines Wetterwechsels sehr wohl zu deuten und zu berechnen wußten. Die Enge des zusammengedrückten Hofes, eine Faltschachtel, die sich nicht entfalten ließ, war das alltägliche Maß, an das man von klein auf gewöhnt war und das man widerstandslos hinnahm.
Die Sicht reichte weit über das Tal hinweg. Ins Dorf hinein und bis zum Sachsdorfer Gemeindebusch hinüber, aus dem Kuckuck und Pirol riefen, bis zur Ochsenwiese, auf der wir im Winter rodelten, solo und in Kette. Die sich jenseits des völlig zerfahrenen Schimmricher Weges aufbuckelnden Felder reichten bis zum Horizont und schienen sich in der Unendlichkeit zu verlieren. In diesem Gefühl wurde man vor allem dann bestärkt, wenn die riesigen Getreideschläge eingepuppt standen. Hocke an Hocke, Reihe neben Reihe. Die ansonsten einförmig geglättete Landschaft war dann mit einem grobkörnigen Raster überzogen. Im Mittelpunkt des Gesichtsfeldes thronte das Rittergut mit den Wirtschaftsgebäuden. Einen Flügel davon nahm das Schloß ein, das allerdings nur wenig Ähnlichkeit mit einem der sonst üblichen, meist prächtigen feudalen Landsitze hatte. Jedenfalls architektonisch gesehen. Dieser Herrensitz erinnerte sehr stark an den voluminösen Kornspeicher mit mehrstöckigen Schüttböden, in dem sich nach dem Bauernkrieg zunächst die Herren und Damen von Ziegler und Klipphausen, später im Wechsel eine Reihe anderer dem sächsischen Landadel zugehörige Geschlechter herrschaftsmäßig etabliert hatten, um die Bauern besser im Blickfeld zu haben und leichter dämpfen zu können, wenn es sie noch einmal gelüsten sollte, sich unbotmäßig zu zeigen und an den Herrschaftsverhältnissen zu rütteln. Der Schreck muß tief gesessen haben.
Der zum Schloß umfunktionierte Kornspeicher blieb durch die Jahrhunderte in den auf profane Zweckmäßigkeit ausgerichteten Betrieb eingebunden. So befand sich denn auch im Zentrum des vorderen Gutshofes anstelle eines dekorativen Springbrunnens als einziger Zierat ein bemooster Sandsteintrog. Jederzeit mit klarem Wasser gefüllt, das eine nie versiegende und versagende Röhrfahrt von weither zuführte. Dort tränkten die Kutscher die Ackergäule und Zugochsen, wenn die Tiere den Weg nicht von selbst dorthin fanden. Hoch über der Hofeinfahrt verband ein überdachter Fachwerkbau das Schloß mit dem Inspektorhaus. Diese auf Balken ruhende Brücke mit den vier kleinen Fenstern auf jeder Seite ist in meiner Erinnerung in den Rang eines Triumphbogens aufgerückt, unter dem hindurch die Rittergutskutscher mit angeklatschten Mistfuhren oder tropfenden Jauchefässern auf die Felder zockelten.
Vor dem Schloß duckten sich die Gärtnerei mit den Gewächshäusern, die Mühle, zu der eine Bäckerei gehörte und die gleichzeitig Bauernhof war. Um die Mühle herum wie mit einer Hand verstreut die Häuser des Winkels. Wohnung und Stall unter einem Dach. Am Ende stand das unsere, von der Straße ein Stück zurückgesetzt. Das Stück Land vor dem Haus blieb ein ewiges Streitobjekt. Der Inspektor erklärte es zum Eigentum des Ritterguts. Vater hingegen behauptete steif und fest, es gehöre zum Haus. Diese Fläche wurde als Wendeplatz und Zugang zum Feimenplatz beansprucht, weil benötigt. Über dem Mühlteich erhob sich die ehemalige Brauerei, die halb in den Berg hineingesetzt worden war. Eine hohe Steintreppe führte zum Hauseingang. Darüber gleich eine zweite, die scharf am Haus vorbei auf die Schäferei...
| Erscheint lt. Verlag | 25.4.2018 |
|---|---|
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | Dorfkindheit • Erinnerungen • Kindheit • Krieg • Landschaft • Meißen |
| ISBN-10 | 3-10-490641-6 / 3104906416 |
| ISBN-13 | 978-3-10-490641-6 / 9783104906416 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 5,8 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich