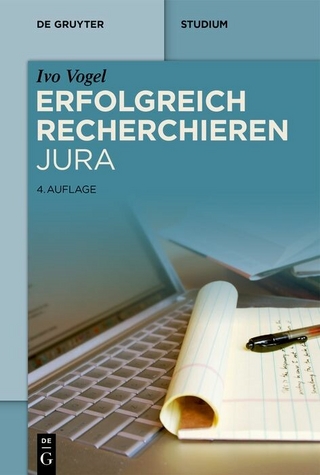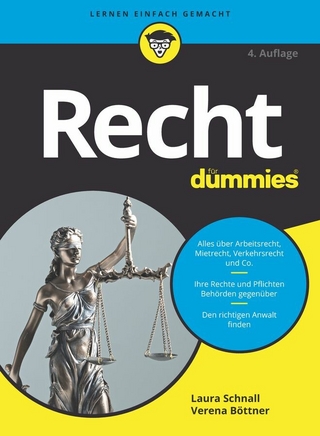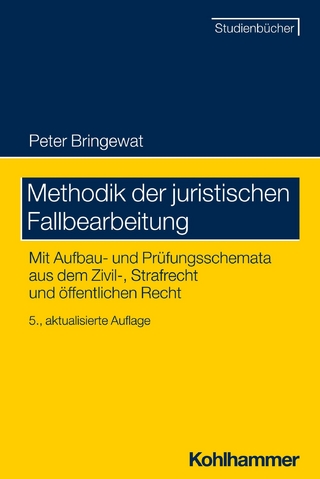Parteiautonomie im Internationalen Immaterialgüterrecht (eBook)
464 Seiten
Mohr Siebeck (Verlag)
978-3-16-155052-2 (ISBN)
Geboren 1985; Studium der Rechtswissenschaften an der Bucerius Law School, Hamburg; wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Internationales Privat- und Handelsrecht und Rechtsvergleichung an der Bucerius Law School; Master of Laws an der Boston University School of Law; Referendariat am Hanseatischen Oberlandesgericht; seit 2016 Rechtsanwalt in Hamburg.
Cover 1
Vorwort 8
Inhaltsübersicht 10
Inhaltsverzeichnis 12
Einführung 36
A. Gegenstand der Arbeit 36
B. Gang der Untersuchung 40
Teil 1: Grundlagen 42
§ 1 Internationales Immaterialgüterrecht 42
A. Geistiges Eigentum und Immaterialgüterrecht 42
I. Völkerrechtliche Grundlagen 42
II. Sachrechtliche Definitionen 45
1. Begriffsbestimmung in Deutschland 45
2. Verständnis des „geistigen Eigentums“ in der Schweiz 47
3. Intellectual property in den USA 48
III. Wesensmerkmale immaterieller Rechtspositionen 51
1. Unkörperlichkeit und Ubiquität 51
2. Immaterielle Güter als public goods: Die Notwendigkeit rechtlicher Zuweisung 51
3. Ausschließliche Rechte (Absolutheit) 53
4. Sozialbindung: Exklusivität und Gemeinnutzen? 54
5. Numerus clausus 55
6. Publizität 55
7. Subjektive, private Rechte 56
8. Zwischenergebnis 56
IV. Autonome kollisionsrechtliche Begriffsbildungen 57
1. Das europäische Kollisionsrecht 57
2. Weite Begriffsbildung in der Schweiz 60
3. Zwischenergebnis 62
B. Grundprinzipien des Internationalen Immaterialgüterrechts 63
I. Das Territorialitätsprinzip 63
1. Definition und Herkunft 63
2. Sachlich-räumliche Wirkung als Prinzip des Sachrechts 65
3. Prozessuale Bedeutung 66
II. Das Schutzlandprinzip 67
1. Definition und Zusammenhang mit dem Territorialitätsprinzip 67
2. Das Schutzlandprinzip als völkerrechtliche Kollisionsnorm? 69
a) Ausgangssituation 69
b) Kollisionsrechtlicher Gehalt der Übereinkommen 70
c) Rein fremdenrechtliches Verständnis 71
d) Stellungnahme 72
III. Rechtfertigung von Territorialitäts- und Schutzlandprinzip 75
1. Souveränitätserwägungen 75
2. Politische Interessen des Schutzlandes 77
a) Wirtschaftspolitische Interessen 77
b) Sozial- und kulturpolitische Interessen 78
c) Verkehrsschutz 79
IV. Zwischenergebnis 80
§ 2 Parteiautonomie 81
A. Parteiautonomie als Grundprinzip des internationalen Vertragsrechts 81
I. Definition, Ursprung und Verbreitung 81
II. Anerkennung als Anknüpfungsprinzip 83
B. Ausdehnung auf weitere Bereiche des Kollisionsrechts 84
C. Rechtfertigungsansätze 86
I. „Äußere“ Legitimation 86
II. Naturrechtliche („innere“) Rechtfertigung 86
III. Primärrechtliche Absicherung der Parteiautonomie 88
1. Absicherung durch die Unionsgrundrechte 88
a) Überprüfung des europäischen Kollisionsrechts nur am Maßstab der EU-Grundrechte 88
b) Vertragsfreiheit als in der Europäischen Union gewährtes Grundrecht 89
(1) Quellenpluralismus der EU-Grundrechte 89
(2) Verwurzelung in den Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten 89
(3) Fortführung in der EU-Grundrechtecharta 90
(4) Auffangfunktion der Allgemeinen Handlungsfreiheit hinsichtlich privaten Handelns 90
(5) Schutz durch die EMRK 91
(6) Zwischenergebnis 91
c) Schutz der Parteiautonomie nach dem Grundgesetz 92
d) Grundrechtliche Absicherung der Parteiautonomie auch auf Unionsebene? 94
e) Absicherung auch außerhalb des Internationalen Vertragsrechts 95
2. Absicherung durch die Grundfreiheiten 95
a) Die Bindung der Europäischen Union durch die Grundfreiheiten 96
b) Gebot zur Gewährung von Parteiautonomie im Internationalen Vertragsrecht? 96
(1) Keine kollisionsrechtliche Relevanz 96
(2) Gebot zur Anwendung des Rechts des Herkunftslandes und favor offerentis 97
(3) Gebot freier Rechtswahl 98
(4) Stellungnahme 98
c) Ausdehnung des Gebots auf Immaterialgüterrechts-verletzungen? 101
3. Zwischenergebnis 103
D. Grenzen der Parteiautonomie 103
I. Begrenzung der wählbaren Rechte 104
II. Zusätzliche tatbestandliche Voraussetzungen 105
III. Beschränkung der Rechtswahl auf Teile eines Rechtsverhältnisses 105
IV. Völliger Ausschluss der Rechtswahl 105
V. Ordre public-Vorbehalt und Eingriffsnormen 106
VI. Binnen- und Binnenmarktsachverhalt 107
E. Bedeutung für die Untersuchung 107
Teil 2: Immaterialgüterrechtsverletzungen und Rechtsfolgen 110
§ 3 Vorüberlegungen 110
A. Multi-State-Verstöße und ubiquitäre Verletzungen 110
I. Problemstellung 110
II. Beispielfall 111
III. Prozessuale Vorüberlegungen 112
IV. Kollisionsrechtliche Mosaikbetrachtung aufgrund des Schutzlandprinzips 114
V. Einschränkungen des Schutzlandprinzips und alternative Anknüpfungsregeln 115
1. In der Literatur diskutierte Lösungsmöglichkeiten 115
a) Anknüpfung an den Handlungsort 116
b) Bogsch-Theorie 116
c) Anknüpfung an das Ursprungsland 117
d) Kollisionsrechtliche market impact rule 117
e) Heimatrecht des Rechtsinhabers 118
f) Substantive law method 118
2. Lösungsvorschläge in den Modellgesetzen 119
a) ALI-Principles 119
b) CLIP-Principles 120
B. Parteiautonomie als kollisionsrechtlicher Lösungsansatz? 121
C. Arten der Parteiautonomie 122
I. Direkte Parteiautonomie 122
II. Indirekte Parteiautonomie: Anknüpfung an ein gewähltes Sonderverbindungsstatut 122
III. Schwindende Bedeutung weiterer Erscheinungsformen 123
§ 4 Rechtslage de lege lata 124
A. Das Europäische Kollisionsrecht 124
I. Grundsatz der lex loci protectionis nach Art. 8 Abs. 1 Rom II-VO 124
II. Reichweite der Anknüpfung nach Art. 8 Rom II-VO 126
1. Unklare Aussage der Verordnung und vertretenes Meinungsspektrum 126
a) Ausschließlich Rechtsfolgen der Verletzung 126
b) Bestand, Inhalt, Verletzung, Inhaberschaft und Übertragung des Rechts 126
c) Erste Inhaberschaft und Bestand des Rechts als unselbstständige Teilfragen 127
d) Vermittelnde Ansicht 128
2. Stellungnahme 128
III. Bedeutung völkerrechtlicher Übereinkommen 132
IV. Bestimmung des Ortes der Verletzung erst auf sachrechtlicher Ebene 133
V. Einräumung von Parteiautonomie 135
1. Historische Betrachtung innerhalb der Europäischen Union 135
a) Deutschland 135
b) Österreich 139
c) Belgien 141
d) Frankreich 144
e) Vereinigtes Königreich 147
f) Zwischenergebnis 153
2. Ausschluss von Parteiautonomie durch die Rom II-VO 153
a) Art. 8 Abs. 3 Rom II-VO 153
b) Art. 8 Abs. 1 Rom II-VO als starre Anknüpfungsnorm 154
c) Überblick über das Gesetzgebungsverfahren 155
3. Teleologische Reduktion bei unionsweit einheitlichen Rechten? 158
a) Ausgangssituation 159
(1) Unionsweit einheitliche Schutzrechte 160
(2) Verweisungen in den jeweiligen Rechtsakten 162
b) Verhältnis der jeweiligen Sonderkollisionsnormen zu Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO 163
(1) Subsidiarität des Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO 163
(2) Vorrang des Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO 164
(3) Vermittelnder Ansatz 165
(4) Stellungnahme 167
c) Lösungsansätze für ubiquitäre und Multi-State-Verletzungen 168
d) Methodische Grundfragen der teleologischen Reduktion 171
e) Regelungszweck von Art. 8 Abs. 3 Rom II-VO: Wahrung des Territorialitätsprinzips 174
f) Keine Gefährdung der marktordnungsrechtlichen Funktion des Territorialitätsprinzips 175
g) Primärrechtskonforme Rechtsfortbildung wegen Verletzung der EU-Grundrechte 177
(1) Eingriff in die auch auf Unionsebene grundrechtlich geschützte Parteiautonomie 177
(2) Fehlschlagen der Rechtfertigung des Eingriffs 178
h) Primärrechtskonforme Rechtsfortbildung wegen Einschränkung der Grundfreiheiten 179
(1) Beschränkung durch Art. 8 Abs. 3 Rom II-VO und Rechtfertigungsmaßstab 180
(2) Fehlschlagen der Rechtfertigung der Beschränkung 181
i) Zwischenergebnis 183
j) Beschränkung der Rechtswahl auf das Recht eines Mitgliedstaates 183
4. Akzessorische Anknüpfung: Analoge Anwendung des Art. 4 Abs. 3 Rom II-VO? 185
VI. Ergebnis 186
B. Das schweizerische Kollisionsrecht 186
I. Maßgeblichkeit des Schutzlandrechts 186
1. Ausdrückliche Normierung des Internationalen Immaterialgüterrechts 186
2. Abgrenzung von der lex loci delicti commissi: Maßgeblichkeit des Klägervortrages 188
II. Gewährung von Parteiautonomie durch Art. 110 Abs. 2 schwIPRG 190
III. Begrenzungen der Parteiautonomie 191
1. Zeitliche Begrenzung auf eine nachträgliche Rechtswahl 191
2. Begrenzung der wählbaren Rechtsordnungen 192
3. Beschränkung der sachlichen Reichweite der Parteiautonomie 192
a) Rechtswahl nur für vermögensrechtliche Ansprüche 192
b) Erstreckung auf den Verletzungstatbestand 193
c) Vollumfassende Rechtswahl 194
d) Rechtswahl hinsichtlich der umfassend verstandenen Rechtsfolgen 195
e) Stellungnahme 195
IV. Akzessorische Anknüpfung über die Ausweichklausel des Art. 15 schwIPRG? 201
V. Ergebnis 204
C. Das Kollisionsrecht in den USA 204
I. Struktur des Internationalen Privatrechts in den USA 204
II. Geltung des Schutzlandprinzips 206
1. Beschränkte Aussagekraft der Restatements 206
2. Grundsätzlich territoriale Wirkung der bundesrechtlichen Immaterialgüterrechte 207
3. Gründe für die beschränkte Aussagekraft des Restatement 209
4. Geltung der lex loci delicti commissi im Sinne des Rechts des protecting country 210
a) Die Itar-Tass-Entscheidung 210
(1) Internationales Immaterialgüterrecht als federal common law 210
(2) Konkretisierung von Anknüpfungsmomenten 212
b) Bestätigung von Itar-Tass trotz Tendenz zur Extraterritorialität 217
(1) Die Vorgehensweise im Ninth Circuit 218
(2) Entscheidungen mit Bezug zu Kanada und Einbeziehung des Patentrechts 219
III. Einräumung von Parteiautonomie 221
1. Ermittlung einer bundesrechtlichen Kollisionsregel 221
2. Das Restatement (Second) Conflict of Laws 221
3. Parteiautonomie im Internationalen Deliktsrecht von Oregon und Louisiana 222
4. Parteiautonomie durch extensive Auslegung von vertraglichen Rechtswahlklauseln 223
a) Contractual intent der Parteien im Internationalen Deliktsrecht 223
b) Korrektur über contractual power oder kodifiziertes Kollisionsrecht 224
c) Extensive Auslegung vertraglicher Rechtswahl-klauseln auch bei Immaterialgüterrechtsverletzungen? 226
(1) El Pollo Loco 226
(2) Philipps v. Audio Active Limited 227
IV. Ergebnis 229
§ 5 Modellgesetze 231
A. Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP-Principles) 231
I. Entstehungsgeschichte, Zweck und Struktur 231
II. Anwendungsbereich 233
III. Konzeption der Parteiautonomie nach den CLIP-Principles 234
1. Grundsätzliche Lockerung des Schutzlandprinzips 234
2. Parteiautonomie für die Rechtsfolgen von Immaterialgüterrechtsverletzungen 235
a) Grundkonzeption 235
b) Beschränkung der Rechtswahl 236
c) Möglichkeit vertragsakzessorischer Anknüpfung 237
B. Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes (ALI-Principles) 238
I. Entstehungsgeschichte und Zielsetzung 238
II. Anwendungsbereich 239
III. Konzeption der Parteiautonomie 240
1. Differenzierende Lösung für eine Grundanknüpfungsnorm 240
2. Beschränkung der Parteiautonomie ausschließlich durch Negativkatalog 241
C. Ergebnis 244
§ 6 Leitlinien für eine Konzeption de lege ferenda 245
A. Grundthese: Ersetzung der Schutzlandanknüpfung durch Parteiautonomie 245
B. Freie Rechtswahl für die Rechtsfolgen von Verletzungen 246
I. Allgemeines und Definition des Begriffes der Rechtsfolgen 246
II. Keine Gefährdung des Marktordnungsgedankens und der Rechte Dritter 248
1. Keine originär immaterialgüterrechtliche Prägung der Rechtsfolgen 248
2. Nähe zu Grundsätzen des allgemeinen Zivilrechts 251
III. Keine notwendige Einheit aus Verletzungsfolgen und Inhalt/ Verletzung des Schutzrechts 253
IV. Einheitliche Behandlung von vermögensrechtlichen und sonstigen Ansprüchen 257
V. Dauerverletzung als Hindernis für Parteiautonomie? 259
VI. Ins Leere zielende Rechtswahl? 260
VII. Keine entgegenstehenden völkerrechtlichen Übereinkommen 262
VIII. Verstoß gegen europäisches Primärrecht de lege lata 263
1. Verletzung der Unionsgrundrechte 264
a) Eingriff in die unternehmerische Freiheit sowie die allgemeine Handlungsfreiheit 264
b) Fehlschlagen der Rechtfertigung aus Gründen der Anknüpfungsgerechtigkeit und Prozessbeschleunigung 265
2. Weitere Verstöße gegen das europäische Primärrecht 268
a) Beschränkung von Warenverkehrs- und Dienstleistungsfreiheit 268
b) Verstoß gegen das Gebot der Binnenmarktförderung 269
IX. Umgehungsmöglichkeiten 272
1. Lizenzverträge und Vergleiche 272
2. Schiedsgerichtsbarkeit 273
X. Keine mangelnde Anerkennung und Vollstreckung 275
XI. Mangelnde praktische Relevanz der Rechtswahl im außervertraglichen Bereich? 276
XII. Zwischenergebnis 277
C. Einbeziehung der Verletzungshandlung 277
I. Beschränkte Nutzbarkeit der Argumente Jeghers für die Situation de lege ferenda in der Europäischen Union 278
II. Grundsätzlicher Vorrang des Schutzlandrechts 279
1. Kein versteckter Anspruchsverzicht durch umfassende „als-ob“-Betrachtung 279
2. Vorrang (wettbewerbs-)politischer Interessen 281
III. Wahrung wirtschaftspolitischer Interessen durch die Anwendung von Eingriffsnormen 282
IV. Durchbrechung bei ubiquitären Verletzungen? 286
1. Grundsätzliche Möglichkeit der Durchbrechung 286
2. Definition des Kriteriums der „ubiquitären Verletzung“ 287
V. Sonderlösung nach de Boer 291
VI. Zwischenergebnis 292
D. Notwendigkeit von Begrenzungen der Rechtswahl? 293
I. Keine Begrenzung auf eine nachträgliche Rechtswahl 293
II. Keine Begrenzung der wählbaren Rechte 297
1. Ausschließliche Wählbarkeit der lex fori? 297
2. Begrenzung auf mitgliedstaatliche Rechte bei unionsweit einheitlichen Schutzrechten? 298
E. Vertragsakzessorische Anknüpfung 299
I. Parallelen zur unmittelbaren Einräumung von Parteiautonomie 299
II. Rechtslage de lege ferenda für einzelstaatliche Schutzrechte 301
III. Rechtslage de lege ferenda für unionsweit einheitliche Schutzrechte 302
F. Gesamtergebnis und Normvorschlag 304
Teil 3: Verträge über Immaterialgüterrechte 308
§ 7 Vorüberlegungen 308
A. Definition des Immaterialgüterrechtsvertrages 308
B. Immaterialgüter- und Vertragsstatut 308
C. Trennungs- und Abstraktionsprinzip im internationalen Kontext 309
I. Unterschiedliche dogmatische Ausgestaltung in einzelnen Jurisdiktionen 309
1. Deutschland 310
a) Gewerbliche Schutzrechte 310
b) Urheberrecht 311
2. USA 312
3. Schweiz 313
II. Abgrenzung als Frage der Qualifikation 314
§ 8 Rechtslage de lege lata 315
A. Das Europäische Kollisionsrecht 315
I. Reichweite des Vertragsstatuts als Ausgangsfrage 315
II. Europäisch-autonome Qualifikation im Internationalen Privatrecht 315
III. Unmittelbarer Anwendungsbereich der Rom-Verordnungen? 316
1. Maßgeblichkeit der Rom I-VO? 316
2. Maßgeblichkeit der Rom II-VO? 319
IV. Überantwortung an das autonome Kollisionsrecht? 320
1. Spaltungstheorien 320
a) Territoriale Spaltungstheorie 320
b) Universale Spaltungstheorie im Urheberrecht 322
2. Einheitstheorien 322
a) Grundgedanke und Verwurzelung im Urheberrecht 322
b) Verhältnis zur Rom I-VO 323
c) Einschränkungen der Reichweite des Vertragsstatuts? 324
(1) Reine Einheitstheorie 324
(2) Eingeschränkte Einheitstheorie 325
3. Reine Maßgeblichkeit des Schutzlandstatuts 326
V. Analoge Anwendung von Art. 14 Rom I-VO 326
VI. Stellungnahme zugunsten einer analogen Anwendung des Art. 14 Rom I-VO 328
1. Bedeutung des Art. 33 EGBGB a.F. für die Spaltungs-theorie im autonomen Kollisionsrecht 328
2. Schwächung der Spaltungstheorie durch das europäische Kollisionsrecht 330
3. Auslegung der Norm: Drittwirkung der Zession? 331
4. Methodische Grundfragen 338
5. Voraussetzungen der analogen Anwendung des Art. 14 Rom I-VO 340
a) Planungswidrige Regelungslücke 340
b) Vergleichbare Interessenlage im Sinne des unionsrechtlichen Gleichheitssatzes 342
(1) Vergleichbarkeit von Internationalem Zessions-und Immaterialgütervertragsrecht 343
(2) Das Verhältnis zwischen Zedent und Zessionar nach Art. 14 Abs. 1 Rom I-VO 343
(3) Das Verhältnis zwischen Zessionar und Schuldner nach Art. 14 Abs. 2 Rom I-VO 344
(4) Das Verhältnis zu Gläubigern, weiteren Zessionaren und anderen Dritten 347
(5) Fehlende kollisionsrechtliche Unterscheidung zwischen Verpflichtung und Verfügung als der Rom I-VO immanentes Prinzip? 350
(6) Zwischenergebnis 354
6. Rechtsfortbildung im Sinne des Gesamttelos der Verordnung und des Primärrechts 354
a) Förderung des Binnenmarktes und des Raumes des Rechts 354
b) Berücksichtigung des effet utile-Grundsatzes 355
7. Zwischenergebnis 359
8. Umfang der Analogie vor dem Hintergrund der Interessen des Schutzlandes 360
a) Kein Konflikt mit den wirtschaftspolitischen Interessen des Schutzlandes 360
b) Keine Erstreckung auf Entstehung, Bestand und erste Inhaberschaft des Schutzrechts 361
c) Form 361
VII. Ergebnis 363
B. Das schweizerische Kollisionsrecht 365
I. Genese und Aufbau der Sonderanknüpfungsnorm 365
II. Keine Auflösung des Spannungsfeldes zwischen Vertrags- und Immaterialgüterstatut 368
III. Unterschiedliche Ansätze hinsichtlich der Abgrenzung beider Statute 369
1. Vorüberlegungen und Präzisierung der Fragestellung 369
2. Spaltungstheorie 370
3. Einheitstheorien 373
a) Reine Einheitstheorie 373
b) Einheitstheorie bei Internet-Verträgen 374
c) Eingeschränkte Einheitstheorie nach Vischer 374
IV. Ergebnis 376
C. Das Kollisionsrecht in den USA 376
I. Grundsatz der Parteiautonomie nach § 187 (1) Restatement (Second) Conflicts of the Laws 376
II. Begrenzung des Vertragsstatuts durch das Immaterialgüterstatut 377
1. Itar-Tass und die most significant relationship 378
2. Konkretisierungsansätze in der Literatur 379
a) Nimmers Ansatz 379
b) Patrys Ansatz 379
3. Lösungsansätze der Rechtsprechung 381
a) Campbell Connelly & Co. Ltd. v. Noble
b) Corcovado Music Corp. v. Hollis Music, Inc. 383
c) Corbello v. DeVito 385
d) Saregama India Ltd. v. Mosley 388
4. Zwischenergebnis 389
III. Ergebnis 390
§ 9 Modellgesetze 391
A. Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP-Principles) 391
I. Formale Trennung von Vertragsanknüpfung, Übertragbarkeit und Grundanknüpfung 391
II. Der eingeschränkten Einheitstheorie folgende Konzeption? 392
III. Ergebnis 396
B. Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes (ALI-Principles) 397
I. Grundsätzlicher Vorrang der Parteiautonomie 397
II. Durchbrechung hinsichtlich der Übertragbarkeit und Formerfordernissen 398
III. Einheitliche Anknüpfung von Verpflichtung und Verfügung? 399
IV. Ergebnis 402
§ 10 Leitlinien für eine Konzeption de lege ferenda 402
A. Ausgangspunkt: Vergleichbares Theorienspektrum 402
B. Sinnvolles Anliegen der Einheitstheorie 403
C. Absage an die reine Einheitstheorie und die universale Spaltungstheorie 404
D. Plädoyer für die eingeschränkte Einheitstheorie 407
I. Rechtssichere Wahrung von Schutzlandinteressen durch klare Sonderanknüpfungen 408
II. Ableitbarkeit der Spaltungstheorie aus dem Internationalen Sachenrecht? 409
III. Vermeidung der Qualifikation nach der lex causae 410
IV. Anwendbarkeit auf alle Immaterialgüterrechte 411
V. Grundsätzliche Funktionsweise 413
VI. Bestimmung des Ausnahmekatalogs 414
E. Gesamtergebnis und Normvorschlag 417
Zusammenfassung und abschließende Würdigung 420
A. Zusammenfassung in Thesen 420
I. Grundlagen 420
II. Immaterialgüterrechtsverletzungen 420
III. Immaterialgüterrechtsverträge 421
B. Abschließende Würdigung 422
Literatur- und Materialienverzeichnis 426
Literatur 426
Materialien 450
Entscheidungsverzeichnis 454
Europäische Entscheidungen 454
Britische Entscheidungen 456
Deutsche Entscheidungen 457
Französische Entscheidungen 458
Niederländische Entscheidung 459
Östereichische Entscheidungen 459
Schweizer Entscheidungen 459
US-amerikanische Entscheidungen 460
Sachverzeichnis 462
| Erscheint lt. Verlag | 1.6.2017 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Recht / Steuern ► Allgemeines / Lexika |
| Recht / Steuern ► EU / Internationales Recht | |
| Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht | |
| ISBN-10 | 3-16-155052-8 / 3161550528 |
| ISBN-13 | 978-3-16-155052-2 / 9783161550522 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 7,7 MB
Kopierschutz: Adobe-DRM
Adobe-DRM ist ein Kopierschutz, der das eBook vor Mißbrauch schützen soll. Dabei wird das eBook bereits beim Download auf Ihre persönliche Adobe-ID autorisiert. Lesen können Sie das eBook dann nur auf den Geräten, welche ebenfalls auf Ihre Adobe-ID registriert sind.
Details zum Adobe-DRM
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen eine
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen eine
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich