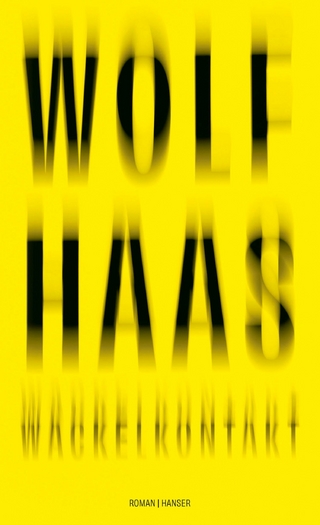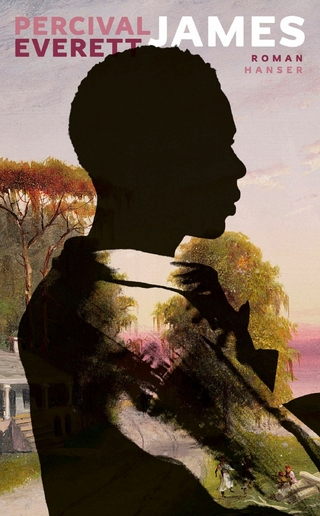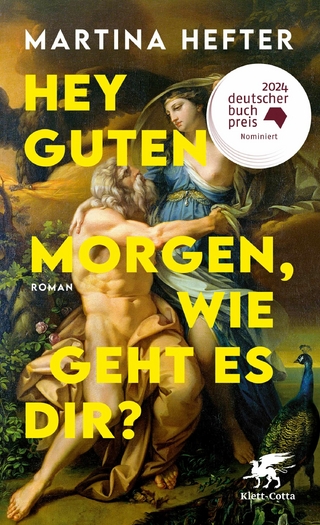Die Wasser der Hügel (eBook)
432 Seiten
Piper Verlag
978-3-492-97747-0 (ISBN)
Marcel Pagnol, geboren am 28. Februar 1895 in Aubagne bei Marseille und am 18. April 1974 in Paris gestorben, studierte Literaturwissenschaft in Aix en Provence und war von 1946 an Mitglied der Académie française. Seine ersten großen Erfolge hatte er ab 1928 mit Theaterstücken, danach wandte er sich dem Filmschaffen zu. Erst mit sechzig Jahren begann er, seine Jugendgeschichte aufzuschreiben, mit der er Weltruhm erlangte: »Eine Kindheit in der Provence« umfasst die beiden weltberühmten Klassiker »Marcel« (1957) und »Marcel und Isabelle« (1958).
Marcel Pagnol, geboren am 28. Februar 1895 in Aubagne bei Marseille und am 18. April 1974 in Paris gestorben, studierte Literaturwissenschaft in Aix en Provence und war von 1946 an Mitglied der Académie française. Seine ersten großen Erfolge hatte er ab 1928 mit Theaterstücken, danach wandte er sich dem Filmschaffen zu. Erst mit sechzig Jahren begann er, seine Jugendgeschichte aufzuschreiben, mit der er Weltruhm erlangte: "Eine Kindheit in der Provence" umfasst die beiden weltberühmten Klassiker "Marcel" (1957) und "Marcel und Isabelle" (1958).
Les Bastides Blanches war eine Gemeinde von hundertfünfzig Einwohnern auf einem der letzten Ausläufer des Etoile-Massivs, zwei Meilen von Aubagne entfernt … dorthin führte eine ungepflasterte Landstraße mit so abrupter Steigung, daß sie von weitem senkrecht wirkte, und zur Gebirgsseite setzte sie sich nur als ein Maultierpfad fort, von dem einige Fußwege zum Himmel strebten.
Dazwischen lagen etwa fünfzig Häuser, deren Weiße im Ortsnamen noch übrig geblieben war; sie säumten fünf oder sechs weder geteerte noch gepflasterte Straßen, enge Straßen, der Sonne wegen gekrümmt, um den Mistral abzufangen.
Immerhin gab es eine ziemlich lange Esplanade, die das Tal nach Sonnenuntergang beherrschte, gestützt von einem Quadersteinwall, der gut zehn Meter hoch war und als Brüstung unter einer uralten Platanenallee endete: dieser Platz wurde der »Boulevard« genannt, und hierher kamen die Alten des Dorfes, um im Schatten zu sitzen und Konversation zu machen.
In der Mitte des Boulevard führte eine breite Treppe von zehn Stufen auf das »Plätzchen«, auf dem von Häuserfronten umgeben, der Quellbrunnen lag. Eine steinerne Muschel schmückte die Mitte des Brunnenrandes und wies ihn auch äußerlich als die Mutter der Ansiedlung aus. Tatsächlich hatte ein »Sommergast« aus Marseille (denn zur Jagdzeit kamen deren zwei oder drei) der Gemeinde vor fünfzig Jahren einen kleinen Sack Goldstücke gestiftet, der erlaubte, das klare Wasser der einzigen, ergiebigen Quelle des Landes bis auf das Plätzchen zu leiten … Damals waren die in Tälern oder auf Hügelhängen verstreuten kleinen Bauernhöfe nach und nach aufgegeben worden, die Familien hatten sich um den Brunnen gruppiert, der Weiler war ein Dorf geworden.
Den ganzen Tag sah man Kannen oder Krüge unter dem Wasserstrahl stehen und daneben die Klatschbasen, die Neuigkeiten austauschten, während sie auf die Musik des einlaufenden Wasserstrahls horchten.
Um den Platz einige Läden: die Tabak-Bar, der Krämer, der Bäcker, der Metzger, dann, weit geöffnet, die Schreinerwerkstatt neben der Schmiede des Schlossers und im Hintergrund die Kirche: sie war altertümlich, aber nicht alt, und ihr Turm war kaum höher als die Häuser. Eine kleine Straße zweigte links von dem Plätzchen ab, um in eine andere schattige Allee zu münden, die sich bis vor das größte Gebäude des Dorfes hinzog. Dieses Gebäude war das Gemeindeamt und der Sitz des republikanischen Klubs, dessen politische Betätigung in der Hauptsache die Organisation des Lottos und der Boulewettspiele war, deren sonntägliche Turniere unter den Platanen beider Alleen abgehalten wurden.
Die Bastidianer waren meist groß, mager und muskulös. Zwanzig Kilometer vom alten Marseiller Hafen entfernt geboren, ähnelten sie weder den Einwohnern dieser Stadt noch den Provenzalen der weiteren Umgebung. Eine weitere Eigentümlichkeit der Bastidianer war schließlich, daß es dort nicht mehr als fünf oder sechs Namen gab: Anglade, Chabert, Olivier, Cascavel, Soubeyran; um Verwechslungen zu vermeiden, fügte man dem Vornamen nicht den Familiennamen, sondern den Vornamen der Mutter hinzu: Pamphile von Fortunette, Louis von Etiennette, Clarius von Reine. Es handelte sich zweifellos um die Nachkommen irgendeines ligurischen Stammes, der ehemals durch die Invasion der Römer in die Hügel zurückgedrängt worden war; was soviel hieß, daß sie vielleicht die ältesten Einwohner des provenzalischen Landes waren.
Weil die Straße, die zu ihnen führte, auf dem Boulevard endete, sah man dort nur selten »Fremde«, und weil sie selbst mit ihrem Los zufrieden waren, stiegen sie nur nach Aubagne hinunter, um ihr Gemüse auf den Markt zu tragen. Vor dem Krieg von 1914 fand man auf den Bauernhöfen noch Greise und Greisinnen, die nichts als das Provenzalisch der Hochebene sprachen. Sie ließen sich von den jungen Leuten, die aus der Kaserne kamen, »Marseille erzählen« und wunderten sich, daß man in solchem Lärm leben konnte, auf der Straße Menschen begegnete, deren Namen man nicht kannte, und überall Polizisten antraf. Doch schwatzten sie gern und verachteten es nicht, einander aufzuziehen … Aber während sie sich über alles und nichts unterhielten, respektierten sie unerbittlich die erste Regel der bastidianischen Moral: »Man kümmert sich nicht um die Angelegenheiten anderer Leute.«
Die zweite Regel hieß, daß man les Bastides für das schönste Dorf der Provence halten mußte, für unendlich viel wichtiger als den Marktflecken des Ombrées oder den von Ruissatel, die mehr als fünfhundert Einwohner zählten.
Wie in allen Dörfern gab es Eifersüchteleien, Rivalitäten und sogar hartnäckigen Haß, der sich auf Geschichten von verbrannten Testamenten oder schlecht geteilten Grundstücken gründete. Aber vor jedem Angriff, der von außen kam, wie das Eindringen eines Wilderers aus des Ombrées oder eines Pilzsammlers aus Crespin, hielten alle Bastidianer zusammen, zu allgemeiner Schlägerei oder gemeinsam geschworenem Meineid bereit. Und die Solidarität war so stark, daß die seit zwei Generationen mit dem Bäcker verfeindeten Médérics trotzdem immer ihr Brot bei ihm kauften, allerdings nur durch Zeichen und ohne je das Wort an ihn zu richten. Dabei wohnten sie in den Hügeln, und der Bäcker von des Ombrées war von ihrem Hof aus viel näher: aber um nichts auf der Welt hätten sie auf dem Boden der Gemeinde das Brot der »Fremde« gegessen.
Ihr Hauptfehler: sie waren geizig, weil sie arm an Geld waren. Sie bezahlten das Brot mit Getreide oder Gemüse, und für drei oder vier Koteletts gaben sie dem Metzger eine Henne oder ein Kaninchen in Tausch oder ein paar Flaschen Wein; was die »Sous« betraf, die sie von Zeit zu Zeit aus Aubagne vom Markt mitbrachten, so verschwanden sie spurlos wie durch Zauberei, und nur beim Eintreffen des Hausierers sah man sie als Fünf Francs-Stücke wieder auftauchen, um ein Paar Bastschuhe, eine Mütze oder eine Gartenschere zu kaufen.
Die Gebirgshänge, aus denen ihr einziger Grund und Boden bestand, waren nichts weiter als unendliche Schichten von bläulichem Kalkstein, zerteilt in tiefe Schluchten, die sie Tälchen nannten, weil man hier und dort kleine Seen von nicht sehr tiefreichender Erde fand, die Wind und Regenbäche im Lauf der Jahrhunderte hier abgelagert hatten. Dort waren ihre Felder angebaut, von Oliven-, Mandel- und Feigenbäumen eingesäumt. Hier zogen sie Kichererbsen, Linsen und Roggen, also Pflanzen, die ohne Wasser leben können. Und kleine Rebengehege von Jaquezwein, die die Reblaus überlistet hatten. Aber im Umkreis des Dorfes sah man, dank einiger Anzapfungen der Brunnenkanalisation, reiche Gemüsegärten grünen und Obstbäume voller Pfirsiche und Aprikosen, deren Früchte sie zum Markt trugen.
Sie lebten von ihrem Gemüse, von der Milch ihrer Ziegen, dem mageren Schwein, das alljährlich geschlachtet wurde, einigen Hühnern und vor allem von Wild, das sie in der Unermeßlichkeit der Hügel jagten. Indessen gab es einige reiche Familien, deren Vermögen die Entbehrungen und Ersparnisse von Generationen darstellte. Sie hatten die Goldstücke in den Dachbalken versteckt oder in Kochtöpfen auf dem Grund der Zisterne vergraben oder in eine dicke Mauer eingemauert. Sie wurden nie angerührt, außer für eine Heirat oder den Ankauf eines Mitgiftgutes. Und danach verdoppelte die ganze Familie ihre Anstrengungen, um den verminderten Schatz wieder aufzufüllen.
Bürgermeister war Philoxène von Clarisse. Siebenundvierzig Jahre alt, dick und rund mit schönen, schwarzen Augen und einem Römerprofil ohne Bart und Schnurrbart. Seine behaarten Hände waren ziemlich fett, denn sie hatten niemals einen Spaten geführt; er war Besitzer der Tabak-Bar, die er dank einer Kriegsverwundung zusammen mit einer Rente erhalten hatte. Man respektierte ihn seiner (übrigens nicht sichtbaren) Verwundung wegen, aber vor allem wegen seiner Rente.
Er gab vor, mit den Sozialisten zu sympathisieren, war antiklerikal, las auf seiner Terrasse ganz offen den ›Petit Provençal‹ und stichelte gern gegen die Jesuiten, die Frankreich in den Abgrund führten. Er war das Haupt der Freigeister (übrigens nicht mehr als fünf oder sechs an der Zahl), deren antiklerikale Handlungsweise sich nur am Sonntag offenbarte, wo sie auf der Kaffeeterrasse Apéritifs tranken, anstatt in die Messe zu gehen. Bei den Gemeindewahlen erhielt er jedoch immer eine schwache, aber ausreichende Mehrheit, weil man ihn als einen »Kopf« bezeichnete, gerade so, als ob andere Leute keinen gehabt hätten. In allen schwierigen Angelegenheiten fragte man ihn um Rat, denn er kannte sich im Gesetzbuch etwas aus; er war imstande, mit den Stadtleuten eine Unterhaltung zu führen, und am Telefon in seiner Bar sprach er mit unvergleichlicher Ungezwungenheit. Er hatte nicht geheiratet: aber er lebte mit seiner Schwester, einer ziemlich verschwiegenen alten Jungfer, und begab sich (das war Gefühlssache) dienstags nach des Ombrées, um im Vorübergehen eine üppig-frische Witwe zu begrüßen, die ihm wohlgesinnt war, ohne dabei den Briefträger zu verachten – einen unterhaltsamen Blondkopf – noch den Apotheker oder gar einen Herrn aus Marseille, der in lackiertem Dogcart mit luxuriösen Gummirädern gelegentlich vorbeikam.
Schreiner, Zimmermann, Wagenbauer war Pamphile von Fortunette. Er war fünfunddreißig, mit einem hübschen, kastanienbraunen Schnurrbart und dem einzigen Paar blauer Augen, das man im Dorf je gesehen hatte. Da er weniger geizig und kein so großer Geheimniskrämer war wie die anderen, betrachteten die Älteren ihn als Feuerkopf, der sicher auf dem Stroh enden würde. Eine Voraussage, die noch dadurch erhärtet wurde, daß er die dicke Amélie von Angèle...
| Erscheint lt. Verlag | 3.7.2017 |
|---|---|
| Übersetzer | Pamela Wedekind |
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | Betrug • Buch • Bücher • Dorf • eBook • eBooks • Film 1953 • Klassiker • Liebe • Manon • Marseille • Missgunst • Provence • Quelle • Schuld und Sühne • Verfilmung • Vergangenheit • Verrat • Yves Montand |
| ISBN-10 | 3-492-97747-2 / 3492977472 |
| ISBN-13 | 978-3-492-97747-0 / 9783492977470 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 7,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich