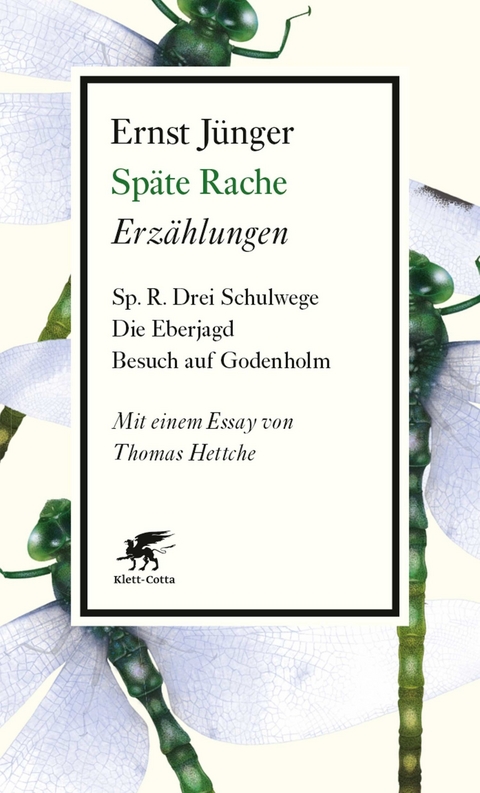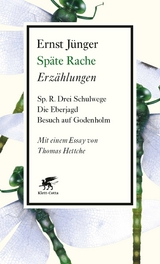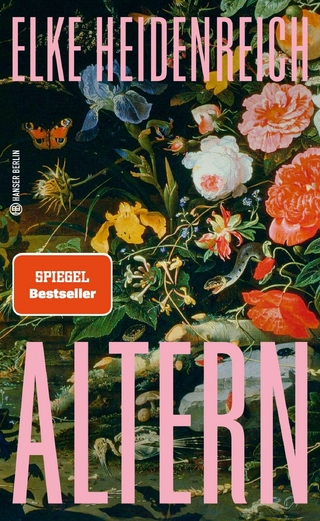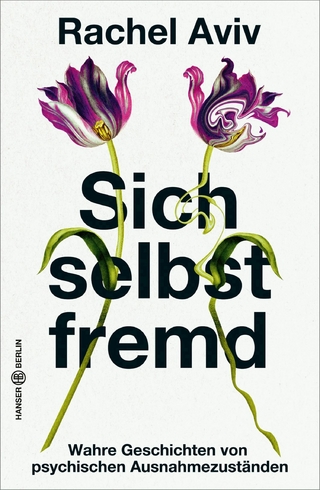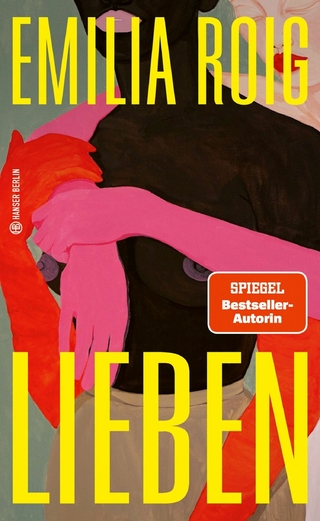Späte Rache (eBook)
125 Seiten
Klett-Cotta (Verlag)
978-3-608-10867-5 (ISBN)
Ernst Jünger, am 29. März 1895 in Heidelberg geboren. 1901-1912 Schüler in Hannover, Schwarzenberg, Braunschweig u. a. 1913 Flucht in die Fremdenlegion, nach sechs Wochen auf Intervention des Vaters entlassen 1914-1918 Kriegsfreiwilliger 1918 Verleihung des Ordens »Pour le Mérite«. 1919-1923 Dienst in der Reichswehr. Veröffentlichung seines Erstlings »In Stahlgewittern«. Studium in Leipzig, 1927 Übersiedlung nach Berlin. Mitarbeit an politischen und literarischen Zeitschriften. 1936-1938 Reisen nach Brasilien und Marokko. »Afrikanische Spiele« und »Das Abenteuerliche Herz«. Übersiedlung nach Überlingen. 1939-1941 im Stab des Militärbefehlshabers Frankreich. 1944 Rückkehr Jüngers aus Paris nach Kirchhorst. 1946-1947 »Der Friede«. 1950 Übersiedlung nach Wilflingen. 1965 Abschluß der zehnbändigen »Werke«. 1966-1981 Reisen. Schiller-Gedächtnispreis. 1982 Goethe-Preis der Stadt Frankfurt/Main.1988 Mit Bundeskanzler Kohl bei den Feierlichkeiten des 25. Jahrestags des Deutsch-Französischen Vertrags. 1993 Mitterrand und Kohl in Wilflingen. 1998 Ernst Jünger stirbt in Riedlingen.
Ernst Jünger, am 29. März 1895 in Heidelberg geboren. 1901–1912 Schüler in Hannover, Schwarzenberg, Braunschweig u. a. 1913 Flucht in die Fremdenlegion, nach sechs Wochen auf Intervention des Vaters entlassen 1914–1918 Kriegsfreiwilliger 1918 Verleihung des Ordens »Pour le Mérite«. 1919–1923 Dienst in der Reichswehr. Veröffentlichung seines Erstlings »In Stahlgewittern«. Studium in Leipzig, 1927 Übersiedlung nach Berlin. Mitarbeit an politischen und literarischen Zeitschriften. 1936–1938 Reisen nach Brasilien und Marokko. »Afrikanische Spiele« und »Das Abenteuerliche Herz«. Übersiedlung nach Überlingen. 1939–1941 im Stab des Militärbefehlshabers Frankreich. 1944 Rückkehr Jüngers aus Paris nach Kirchhorst. 1946–1947 »Der Friede«. 1950 Übersiedlung nach Wilflingen. 1965 Abschluß der zehnbändigen »Werke«. 1966–1981 Reisen. Schiller-Gedächtnispreis. 1982 Goethe-Preis der Stadt Frankfurt/Main.1988 Mit Bundeskanzler Kohl bei den Feierlichkeiten des 25. Jahrestags des Deutsch-Französischen Vertrags. 1993 Mitterrand und Kohl in Wilflingen. 1998 Ernst Jünger stirbt in Riedlingen.
ERSTER TEIL
DER ERSTE SCHULWEG
Das Schönste an der Schule war der Schulweg, daher hätte Wolfram ihn gern so lang wie möglich gedehnt. Aber dann wäre er zu spät gekommen, und Zuspätkommen war schlimm.
In der Aufregung fand er nicht die richtige Türe; er verirrte sich sogar in den Stockwerken und störte in anderen Klassen den Unterricht. Die Lehrer, von denen die meisten Stehkragen und Kneifer trugen, fixierten ihn grimmig, und die Schüler waren über die Unterbrechung erfreut. Fast eine Viertelstunde war versäumt, ehe er die Entschuldigung vorstottern konnte – doch da gab es keine Entschuldigung. Bevor er sich setzen durfte, kam die Ermahnung: »An dir kann man nur tadeln« und die Eintragung ins Klassenbuch. Zudem war er unordentlich angezogen; die Hauptsache am Schulweg waren die Gebüsche und das sumpfige Ufer am See.
*
Schön wäre es gewiß, wenn es nur den Weg gäbe, aber die Schule warf schon den Schatten auf ihn. Die Schatten waren dunkler geworden, denn Wolfram war ein Versager; er befand sich bereits auf dem dritten Schulwege. Der erste hatte zur Vorschule, der zweite zu Tegtmayers Institut, der dritte zum Gymnasium geführt. Alle drei durchquerten den Park, der das Haus der Eltern von der Stadt trennte.
Da die Schulen voneinander getrennt lagen, war jedes Mal ein neuer Weg zu lernen: der erste über eine Brücke, die beiden anderen am Stadtsee entlang. Da konnte man sich leicht verirren, besonders da er weniger auf den See als auf die Vögel achtete, die dort schwammen oder sich am Ufer in der Morgensonne ausruhten. Das Ufer war im Frühling von gelben Schwertlilien, im Herbst von Schilfkolben, den »Zylinderputzern«, gesäumt. Von der Brücke aus waren fette Karpfen, die träge ihre Flossen regten, zu beobachten.
*
Der Weg zur Vorschule war Wolfram am leichtesten gefallen – schon deshalb, weil er den Großvater begleitete, der dort unterrichtete. Man hätte auch sagen können, daß der Großvater die Begleitperson war oder der Leibwächter. Es kam vor, daß er des Enkels wegen eine oder selbst zwei Stunden früher aufbrach, als es sein Dienst erforderte.
Für Wolfram hatte dieses Miteinander den Vorteil, daß er nicht zu spät kam, denn der Großvater war pünktlich wie die Uhr, aber es war ein Freiheitsentzug voll pädagogischer Mahnungen, die erfreuliche Mitteilungen milderten. Der Großvater wußte viel. Er kannte die Namen der verschiedenen Enten, die auf dem See schwammen; es war sogar eine japanische dabei. Die Stadtgärtner setzten jeden Monat neue Blumen in die Rabatten; wie sie hießen, erfuhr Wolfram nebenbei. Es gab auch seltene Bäume wie die Kornelkirsche und die Araukaria, aber selbst von den Eichen so viel Sorten, daß man damit einen Wald bestellen könnte, und es wäre keine wie die anderen. »Und wenn du von diesem Walde jedes Blatt unter die Lupe nähmest, so würdest du doch nicht zwei davon finden, die sich glichen«, sagte der Großvater.
*
Der Großvater rauchte unterwegs eine halblange und zu Haus eine lange Pfeife; er trug einen Bart wie die vom Siebziger Krieg. Damals war er nicht dabei gewesen, und zuvor waren die Schulmeister vom Militärdienst befreit. Dafür war ihr Salär auch kümmerlich genug. Trotzdem meinte er, daß gerade sie es bei Königgrätz geschafft hätten. Auch von Krieg und fernen Ländern wußte der Großvater viel – von den Düppeler Schanzen bis zum Kanonenboot »Iltis«, den Aufständen der Sepoys in Indien und des Mahdi im Sudan, der gelben Chinesen und der schwarzen Herero. Wenn er von ihnen sprach, stieß er mit dem Spazierstock auf.
Wolfram konnte davon nicht genug hören. Nur war es lästig, daß er sich nicht bewegen durfte, wie er wollte, vor allem nicht stehn bleiben. Der Großvater war nicht streng, doch genau. Das ging bis ins Kleinste – wie man die Füße zu setzen und wie man zu atmen hatte: die Luft durch die Nase einziehen und langsam durch den Mund ausblasen. Die Haare wurden kurz gehalten, das ersparte die Frisur, obwohl die Mutter anderer Meinung war. Aber was half es – der Vater wurde oft versetzt. Auch das Sprechen war nicht so einfach, wie es schien. Der Großvater rügte, daß Wolfram die Vokale nicht scharf genug von einander absetzte. Er »nuschelte«. »Es heißt nicht ›der Unkel‹ sondern ›der Onkel‹ und nicht ›die Kersche‹ sondern ›die Kirsche‹.« – Derartiges hörte Wolfram öfter, als es ihm lieb war und nötig schien. Aber der Großvater hatte ein feines Ohr. Er war im Vorstand des Lehrer-Gesangvereins. Er ließ nichts durchgehen. Wenn er den Enkel beim Schreiben beobachtete, legte er Wert darauf, daß das kleine lateinische e nicht einfach durchgezogen würde, sondern im Aufstrich noch einen Haken bekam. Auch das schien Wolfram überflüssig, doch mußte er zugeben, daß der Buchstabe nun einen stattlicheren Bauch bekam.
*
Wie all- und jedes im Tag des Großvaters war auch die Zeit für den Schulgang reichlich bemessen, doch sah er es ungern, wenn der Enkel von sich aus stehen blieb. Dazu fühlte Wolfram sich besonders versucht, wenn sie an der Schotterbank, die den See säumte, entlang gingen. Das hatte mit seiner Steinsammlung zu tun.
Hier ist einzufügen, daß Wolfram bald für kurze, bald für längere Zeit bei den Großeltern wohnte, wenn die Eltern nicht in der Stadt weilten. Dafür gab es sowohl private wie dienstliche Anlässe. Die Großeltern wohnten zur Miete, die Eltern im eigenen Haus. Nur dort konnte Wolfram sein Panorama ausbreiten; die Terrasse bot genügend Platz dafür. Da die Eltern Emilie als bewährte Haushälterin zurückließen, konnte Wolfram auch während ihrer Abwesenheit hin und wieder einen Gang zum Panorama abzweigen. Gern wäre er überhaupt dort geblieben, doch wollte und konnte man ihn Emilie nicht anvertrauen – nicht einmal für Tage, nachdem sich die Absencen gezeigt hatten.
*
Das Panorama war eigentlich nicht mehr als der Stadtpark im Kleinen, doch sollte es größer und schöner sein. Wolfram hatte dafür seine eigenen Maßstäbe. Als die Mutter es komisch gefunden hatte, daß in seiner Landschaft die Enten größer wären als die Schafe, hatte er geantwortet: »Die Enten sind größer, weil ich sie lieber hab.« Auch hatte sie bemängelt, daß der Goldfisch die Flanke zeigte, wenn er schwamm. Aber Wolfram hatte ihn aus einem Katalog geschnitten und fand ihn stattlicher im Profil. Man sah auch die Flossen deutlicher. Er schwamm auf dem Bruchstück eines Spiegels, das den See darstellte.
Die Mutter rügte auch, daß das Panorama, das ihr auf der Terrasse viel Platz raubte, der reine Schutthaufen sei. Das stimmte insofern, als zur Ausstattung hauptsächlich Fundstücke und Abfall beitrugen. Aus einem Badeschwamm war der Sumpfrand am Wasser zurechtgebastelt, und die Fetzen eines Jägerhutes stellten waagrecht die Wiesen und senkrecht die Hecken dar. Es traf sich, daß die Hutschnalle sie unterbrach und einen Eingang öffnete. Es gab Glücksfunde, aber es war auch viel zu schneiden und zu kleben dabei. Der Vater sagte: »Wenn du in der Schule nur halb so eifrig wärest, würdest du der Erste sein.« Doch verbieten mochte er es nicht.
Bei gutem Wetter häuften sich die Glücksfunde. Das galt besonders für die Steine, wenn in der Nacht Regen gefallen war. Wenn von den Blättern keines dem anderen gleichen sollte, so übertrafen die Steine sie darin bei weitem noch. Der Großvater hatte gesagt, daß sie von weit her gekommen seien – als Geröll von den Alpen zur Zeit, in der es noch Mammute gab. Es war nicht leicht, sie zu ordnen – Wolfram hatte es nach Farben, Formen und Mustern versucht. Eines der Steinchen war schwarzweiß gestreift wie das Ordensband, das der Vater im Knopfloch trug, ein anderes war wie ein Kiebitzei gefleckt, in ein drittes war eine winzige Muschel eingeprägt. Wolfram verwahrte sie in einem Kasten und legte die Wege des Panoramas mit ihnen aus. Obwohl ein jeder seine Schönheit für sich bewahrte, konnte der Schotter am Seerand zur Juwelenkette werden, wenn die Morgensonne auf ihn fiel. Dann mußte Wolfram sich von der Hand des Alten losreißen.
*
Trotz allem erinnerte Wolfram sich an diesen Schulweg als an den besten von den dreien. Es war ihm schon früh aufgefallen, daß die Drei eine besondere Rolle spielt. Gut, besser, am besten – das war ein Stück Torte, auf dem über der Sahne noch eine grüne Engelwurz oder eine rote Kirsche liegt. Aber es gab auch das Gegenteil: schlecht, schlimmer, am schlimmsten – eben diese drei Schulwege, oder vielmehr den Schatten, der von der Schule aus darauf fiel.
Die Vorschule war nicht so schlimm gewesen nach allem, was er von ihr gehört hatte. »Warte, bis du erst zur Schule kommst« – so der Vater, wenn Wolfram vom Spiel, etwa vom Eislauf, erhitzt, die Tischzeit versäumt hatte.
Da die Vorschule zum Gymnasium gehörte, unterrichteten in ihr nicht, wie in der Volksschule, einfach Lehrer, sondern »Gymnasiallehrer«. Mit diesem Titel fiel etwas von humanistischer Würde auf sie ab. Das soll nicht heißen, daß ihnen Würde gefehlt hätte. Sie waren sich ihrer Bedeutung nicht minder und sogar problemloser als ihre promovierten Kollegen bewußt.
Bei allem Respekt hatte Wolfram zu ihnen recht bald eine familiäre Neigung schon deshalb empfunden, weil sie dem Großvater ähnlich sahen. Auch sie trugen halblange Bärte wie die Soldaten im Siebziger Krieg. Solche Bärte waren gut; sie flößten Vertrauen und Achtung ein. Man konnte sich schwer vorstellen, daß ein Offizier solch einen Bärtigen anschnauzen könnte wie einen Bartlosen.
Sie rauchten auch lange Pfeifen wie der Großvater – wie es sich...
| Erscheint lt. Verlag | 11.4.2017 |
|---|---|
| Verlagsort | Stuttgart |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Essays / Feuilleton |
| Literatur ► Romane / Erzählungen | |
| Schlagworte | Adoleszenz • Erzählungen • Jungen |
| ISBN-10 | 3-608-10867-X / 360810867X |
| ISBN-13 | 978-3-608-10867-5 / 9783608108675 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,0 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich