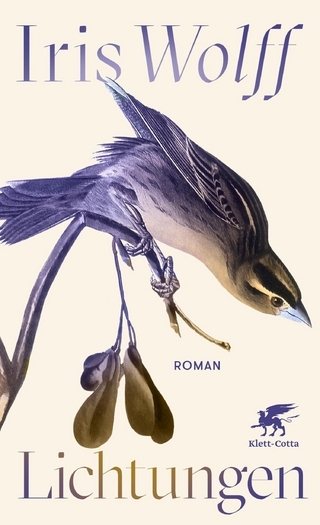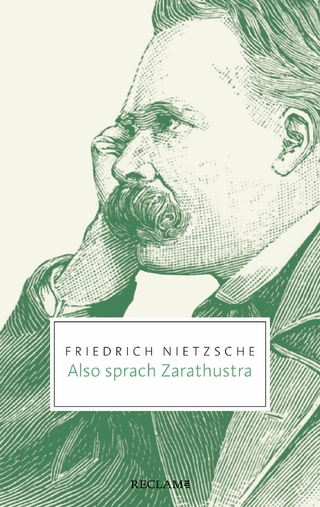Blaue Flamme (eBook)
138 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-688-10186-3 (ISBN)
Sidonie-Gabrielle Colette, 1873 in Saint-Sauveur-en-Puisaye (Burgund) geboren und 1954 in Paris gestorben, war eine französische Schriftstellerin, Varietékünstlerin und Journalistin.
Sidonie-Gabrielle Colette, 1873 in Saint-Sauveur-en-Puisaye (Burgund) geboren und 1954 in Paris gestorben, war eine französische Schriftstellerin, Varietékünstlerin und Journalistin. Angela Praesent (1945–2009) war Verlagslektorin, Übersetzerin und Schriftstellerin. Uli Aumüller übersetzt u. a. Siri Hustvedt, Jeffrey Eugenides, Jean Paul Sartre, Albert Camus und Milan Kundera. Für ihre Übersetzungen erhielt sie den Paul-Celan-Preis und den Jane-Scatcherd-Preis.
Daß unsere kostbaren Sinne mit zunehmendem Alter abstumpfen, darf uns nicht über Gebühr erschrecken. Ich schreibe «uns», doch gilt diese Ermahnung mir selbst. Vor allem möchte ich, daß der neue, allmählich erreichte Zustand mich auf keinen Fall über seine wahre Natur hinwegtäuscht. Er trägt einen Namen, er macht mich wachsam, unsicher und befähigt mich zu neuen Anpassungen. Ich freue mich nicht gerade darüber, aber mir bleibt keine andere Wahl.
Wenn ich mich von meiner Lektüre oder dem bläulichen Papier, auf dem ich schreibe, dem herrlichen Spielplatz zuwandte, dessen Anblick mir vergönnt ist, habe ich wiederholt gedacht: «Die Kinder im Park lärmen dieses Jahr weniger»; kurz darauf beschuldigte ich die Türklingel, das Telefon und alle Orchesterklänge des Radios, mehr und mehr zu verstummen. Für die Porzellanlampe wiederum - ich meine nicht das Tag und Nacht brennende blaue «Leuchtfeuer» - nein, die hübsche, mit Sträußen und Ornamenten bemalte Lampe - für sie hatte ich nur ein ungerechtes Brummeln übrig: «Was hat die denn nur gegessen, daß sie so schwer ist?» Oh, man macht immer wieder neue Entdeckungen! Man muß nur abwarten, damit alles sich klärt. Statt Inseln anzulaufen, treibe ich also dieser Weite entgegen, wo nur noch das einsame Geräusch des Herzens hingelangt, das dem der Brandung gleicht. Aber beruhigen wir uns: nichts stirbt ab, ich bin es, die sich entfernt. Die Weite, aber nicht die Wüste. Zu entdecken, daß es keine Wüste gibt: das ist genug, um Herr zu werden über das, was mich bedroht.
Vier Jahre sind vergangen, seit ich ‹L'étoile Vesper› veröffentlicht habe. Es waren kurze Jahre, wie Jahre es eben sind, die immer gleiche Vormittage haben und Abende wie verschlossene Gefäße, mit einem kleinen, unvorhergesehenen Mittelpunkt gleich einem Kern. Ich hatte ‹L'étoile Vesper› in aller Aufrichtigkeit mein letztes Buch genannt. Ich habe jedoch gemerkt, daß Aufhören ebenso schwierig ist wie Weitermachen. Unter meinem blauen Fanal sitzend, wird die Kette, an der ich liege, immer kürzer, mein körperlicher Schmerz dagegen immer beständiger. Aber wie viele Möglichkeiten, mich fortzubewegen, sind mir - vom Gehen abgesehen - doch noch verblieben! 1946 war ich in Uriage, 1947 in Genf und im Beaujolais, 1948 in der Provence - obwohl es mir verboten war. Von einem Auto oder einem Rollstuhl aus zählte ich voller Stolz die wiedergesehenen Landschaften, Ströme und Gestade: «Immerhin, dies kann ich alles noch besichtigen!» Besichtigen? Das sagt man so oder empfindet es zumindest so. Durch ihre ständig zugezogenen Vorhänge hindurch hat Anna de Noailles in der Hinfälligkeit ihrer letzten Lebensjahre mehr Städte, Meere und Berge gesehen als ich.
Eigentlich sollte dieses Buch ein Tagebuch werden. Aber ich bin unfähig, ein richtiges Tagebuch zu führen, nämlich Perle um Perle, Tag um Tag eine dieser Ketten aufzureihen, denen allein schon die Genauigkeit des Schriftstellers, die Betrachtungen, die er über sich und seine Zeit anstellt, einen Wert, das Farbenspiel eines Juwels geben. Es liegt mir nicht, auszuwählen, das Herausragende zu notieren, das Ungewöhnliche festzuhalten, das Banale auszusondern, denn meistens ist es ja das Gewöhnliche, das mich reizt und anregt. Hatte ich mir doch vorgenommen, nach ‹L'étoile Vesper› nichts mehr zu schreiben, und jetzt bin ich dabei, zweihundert Seiten zu füllen, und es sind weder Memoiren, noch ist es ein Tagebuch. Mein Leser möge sich damit abfinden: mein Leuchtfeuer, meine Tag und Nacht brennende Lampe, blau zwischen roten Vorhängen, dicht an das Fenster gedrückt wie einer der Schmetterlinge, die dort im Sommer morgens einschlafen - mein blaues Fanal beleuchtet keine Ereignisse, über deren Größe man staunen könnte.
Es ist zwanzig Jahre oder noch länger her, daß die Prinzessin Edmond de Polignac, die Freundin der Musik und der Musiker, mit einem Blick und einem Wort den vierbeinigen Pult-Tisch verurteilte, der mich von Paris nach Saint-Tropez und zurück begleitete, der in den Herbergen an meinem Bett haltmachte. Ich hing an diesem Möbelstück, das Luc-Albert Moreau, der Maler, Graveur und Oberbastler für mich improvisiert hatte, damit ich an ihm schreiben konnte, ohne mit herunterhängenden Füßen sitzen zu müssen, eine Haltung, die für mein Wohlbefinden und meine Arbeit schon immer schädlich war.
«Ich habe ein kleines englisches Möbelstück», sagte die Prinzessin de Polignac, «das, vergrößert, hervorragend für Sie geeignet wäre.»
Sie irrte sich nicht. Seitdem es verstärkt, befestigt und erhöht wurde und dabei seinen anmutigen englischen Stil des 19. Jahrhunderts weitgehend eingebüßt hat, steht es quer über meiner Bettcouch und dient tatsächlich meiner Erholung und meinem Beruf. In seine solide Mahagoniplatte ist ein verstellbares Pult eingelassen, auf dem Telefon, Obst, Kofferradio und die dicken Bildbände ruhen, die ich mir zur Entspannung von meiner eigenen Schreibarbeit anschaue. Der Aufbau gleitet bequem vom Kopfende bis zu meinen Füßen. Obenauf lege ich einige gute und angenehme Helfer zurecht, darunter das Allzweckmesser mit seinem Skorpiongriff, das Bündel Stifte und Nippsachen ohne bestimmten Nutzen.
Um mich herum herrscht große Unordnung an Blättern und Papieren, doch ist es nur der trügerische Anschein von Unordnung, die mal von gekochten Maronen, mal von einem angebissenen Apfel verstärkt wird. Und seit einem Monat liegt hier auch noch eine - womöglich exotische - Ähre, deren Kapseln feine silberne Samen umschließen und explosionsartig ausstoßen, an denen Fasern hängen, leichter noch als die einer Distel. Diese Quasten befreien sich eine nach der anderen, geraten in die erwärmte Luft unter der Zimmerdecke, schweben dort lange hin und her, fliegen wieder herab, und wenn der Luftsog des Kaminfeuers eine erhascht, schickt sie sich in den Raub, schwingt sich entschlossen in den Kamin und läßt sich willig verzehren. Den Namen der Pflanze kenne ich nicht, die so ihre fliegenden Seelen ausstreut, aber sie braucht sich nicht auszuweisen, um in meinem Museum, dem Museum einer Unwissenden, ihren Platz zu finden.
Wo sind jene geblieben, denen ich für sie selbst und für mich ein langes Leben wünschte? Wäre ich je auf den Gedanken gekommen, daß Marguerite Moreno mich verlassen würde? Bei ihr waren die Ermüdungserscheinungen gelinde; sie lachte geringschätzig, wenn ich die Untätigkeit und den Halbschlaf der Mittagsruhe pries. Aber Marguerite zieht sich eine Erkältung zu und stirbt acht Tage darauf. Und Luc-Albert Moreau trifft einen Freund, ruft fröhlich: «Ah, mein Freund, ich freue mich, dich zu sehen!» und stirbt auf der Stelle an Herzversagen. Und vor ihnen Léon-Paul Fargue. Kurz vor dem Sterben murmelte er in das Blau seiner Bettücher, die er hatte färben lassen: «Viel zu blau … unmöglich …» Und andere, die ich nicht alle nennen oder gar aufzählen kann. Insgeheim nehme ich ihnen ihr Ende übel, ich schelte sie unvorsichtig und fahrlässig. Mich so plötzlich zu verlassen, mir das anzutun! Daher habe ich ihren Anblick, wie sie zur letzten, endgültigen Ruhe aufgebahrt daliegen, aus meiner Vorstellung und meiner Erinnerung verbannt. Fargue soll plötzlich selbst eine Statue geworden sein? Das will ich nicht. Der Fargue meiner Erinnerung trägt noch seine staubigen Wanderschuhe, er redet, er krault den schwarzen Kopf des Katers, er telefoniert mit mir, er läuft von Lipp nach Ménilmontant, er hadert mit der allzu blauen Dünung seines Lagers. Und Marguerite Morenos goldbeschuhte Füße sollen bewegungslos sein? O nein! In meiner Erinnerung bleiben sie lässig, beweglich, verletzbar und nimmermüde …
Meine jüngeren Freunde, die noch höchst lebendig sind, betrachten mich manchmal mit strengem Blick; sie sind auf der Hut. Sie ziehen mir den Schal enger um die Schultern: «Spüren Sie den Luftzug nicht?» - Nein, ich spüre den Luftzug nicht, ‹den› Luftzug, den ihr meint, spüre ich nicht. So weit gehen meine Gedanken nicht, daß ich ihn spürte. Ich habe so viele Gelegenheiten, mich von dem abzuwenden, was ihr verschämt «schlechte Luft» nennt. Vor allem habe ich den Schmerz, diesen immer wieder jungen, aktiven Schmerz, der mir Erstaunen, Wut und Trotz einflößt, der meinen Lebensrhythmus bestimmt; der Schmerz, auf dessen Aufhören ich hoffe, der aber nicht auf das Lebensende hinweist. Glücklicherweise habe ich den Schmerz. Oh, ich gebe zu, daß ich die Kranke hervorkehre und mit ihm kokettiere, wenn ich das Adverb «glücklicherweise» gebrauche. Sehr wenige Kranke behalten ihr ursprüngliches Wesen, aber ich möchte nicht den Eindruck erwecken, als leitete ich aus meinem Gebrechen einen verwerflichen Stolz, das Recht auf Rücksichtnahme oder einen Minderwertigkeitskomplex ab, der der Ursprung für Verbitterung ist. Ich spreche nicht von denen, die Schmerzen simulieren, sie sind überhaupt nicht interessant und stellen außerdem eine verschwindende Minderheit dar. Ich spiele nicht auf eine bestimmte Kategorie Leidender an, denen es gar nicht so unangenehm ist, auf frischer Tat beim Leiden überrascht oder angetroffen zu werden. Mein Bruder, der Arzt, urteilte die Lustgefühle dieser Menschen in wenigen Worten ab: «Das ist eine Art Ekstase», sagte er. «Das ist so, wie wenn man sich mit einem Streichholz im Ohr bohrt. Das ist ein bißchen obszön.»
Ein großer Politiker, der hinkte, hat mir einmal ein Geständnis gemacht, das ich nicht abwegig fand, obwohl ich zu jener Zeit noch erfreulich gesund war. Dieser Politiker liebte es, mich auf das Niveau verallgemeinernder Gedanken zu heben, er versuchte es zumindest. Ich bemühte mich auch, ihm zu folgen, aber nicht lange. Ich glaube, er hätte mich in vielen Dingen mittelmäßig gefunden, wenn er nicht eines meiner Bücher, nämlich ‹Tagesanbruch› so...
| Erscheint lt. Verlag | 24.3.2017 |
|---|---|
| Nachwort | Angela Praesent |
| Übersetzer | Uli Aumüller |
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Klassiker / Moderne Klassiker |
| Literatur ► Romane / Erzählungen | |
| Schlagworte | Alter • Liebe • Paris |
| ISBN-10 | 3-688-10186-3 / 3688101863 |
| ISBN-13 | 978-3-688-10186-3 / 9783688101863 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 621 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich