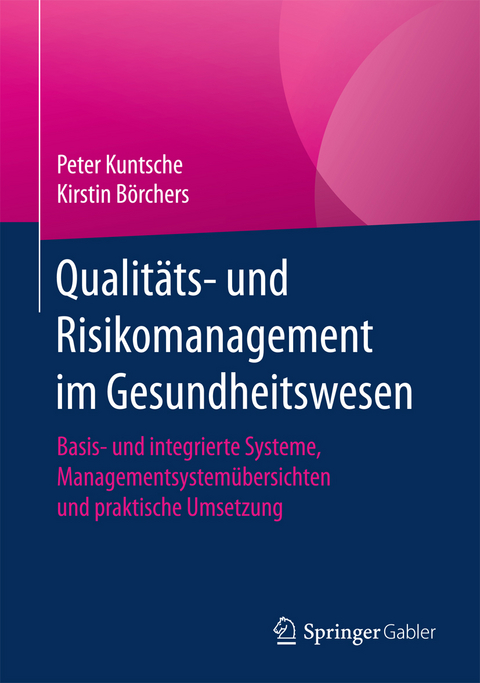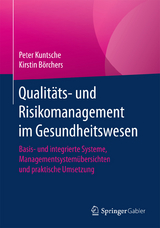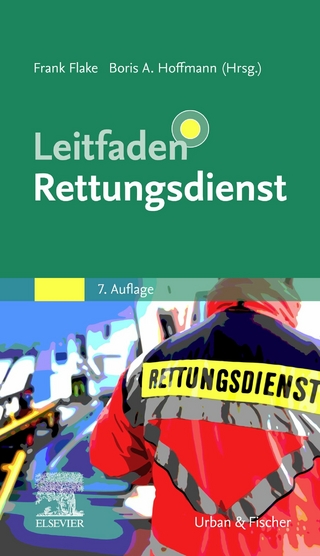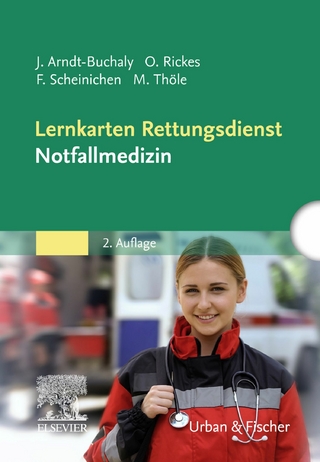Qualitäts- und Risikomanagement im Gesundheitswesen (eBook)
XXX, 752 Seiten
Springer Gabler (Verlag)
978-3-642-55185-7 (ISBN)
Das Buch liefert einen umfassenden Überblick über das Qualitäts- und Risikomanagement im Gesundheitswesen (QMRM) und stellt die Ziele und Ausrichtungen eines QMRM-Systems sowie die Prämissen und Stolpersteine bei der praktischen Umsetzung vor. Es beschreibt die Werkzeuge und Methoden für den Einsatz im QMRM sowie das Prozessmanagement und stellt die für das Gesundheitswesen relevanten QM- bzw. RM-Systeme und Verfahren anwendungsorientiert dar. Daneben erfolgt eine sektorenspezifische Skizze des gesetzlichen Rahmens für QM und RM aus Sicht des Gesetzgebers. Auch das Hygienemanagement wird grundlegend thematisiert. Unterstützt wird eine effiziente Gestaltung integrierter Systeme und deren phasenorientierter Aufbau bis zur Implementierung und ggf. Zertifizierung. Normen, Konzepte und Verfahren im Bereich QMRM und eine praxisnahe und komprimierte Aufbereitung mit einem über den 'Tellerrand' hinausgehenden Blick auf 12 für das Gesundheitswesen relevante Managementsysteme sowie ein Abriss über aktuelle Projektmanagementmethoden zur Unterstützung der Projektarbeit runden das Gesamtkonzept ab.
Dr.-Ing., Dr.sc.oec. Peter Kuntsche war nach seiner Assistenzzeit an der TU Dresden langjährig in der Industrie (Rechen- und Automatisierungstechnik, Telekommunikationstechnik) sowie in der Unternehmensberatung und der Weiterbildung von deutschen und ausländischen Fach- und Führungskräften tätig. Die inhaltlichen Schwerpunkte umfassten insbesondere die Bereiche Management, Strategie, Qualitäts- und Risikomanagement - inkl. Auditorentätigkeit - sowie Projektmanagement.
Als Lehrbeauftragter - inkl. Betreuer/Gutachter studentischer Abschlussarbeiten und Dissertationen - war er über 25 Jahre tätig, davon 12 Jahre in den Disziplinen Qualitäts- und Risikomanagement im Gesundheitswesen sowie Projektmanagement in Weiterbildungseinrichtungen Berlins, der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (Mannheim) und der Berufsakademie Sachsen (Bautzen).
Dr. med. Kirstin Börchers promovierte 1990 zum Doktor der Medizin, war als wissenschaftliche Assistentin in der Frauenklinik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig und schloss mit dem Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe ab. Seit 1998 arbeitet sie im Bereich des medizinischen Qualitätsmanagements. Zunächst als QM-Koordinatorin an zwei Universitätskliniken, seit 2002 als Unternehmensberaterin. Sie ist Mitglied der Gesellschaft für Qualitätsmanagement in der Gesundheitsversorgung e.V. (GQMG). Als Lehrbeauftragte gibt Dr. Börchers an der Universität Duisburg-Essen und der Hochschule Fulda ihr Wissen in Lehrveranstaltungen im Fachgebiet 'Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen' an Studenten verschiedener Fachrichtungen und Berufsgruppen weiter. Darüber hinaus ist sie Referentin bei Seminaren und Vorträgen. 2004 gründete Dr. Kirstin Börchers die QM BÖRCHERS CONSULTING + und bietet neben einer umfassenden Qualitätsmanagement- und Unternehmensberatung für das Gesundheitswesen auch die sogenannte Weinrote Seminarreihe an. 2015 folgte die Auszeichnung als TOP CONSULTANT (Mittelstand).
Dr.-Ing., Dr.sc.oec. Peter Kuntsche war nach seiner Assistenzzeit an der TU Dresden langjährig in der Industrie (Rechen- und Automatisierungstechnik, Telekommunikationstechnik) sowie in der Unternehmensberatung und der Weiterbildung von deutschen und ausländischen Fach- und Führungskräften tätig. Die inhaltlichen Schwerpunkte umfassten insbesondere die Bereiche Management, Strategie, Qualitäts- und Risikomanagement - inkl. Auditorentätigkeit - sowie Projektmanagement. Als Lehrbeauftragter - inkl. Betreuer/Gutachter studentischer Abschlussarbeiten und Dissertationen - war er über 25 Jahre tätig, davon 12 Jahre in den Disziplinen Qualitäts- und Risikomanagement im Gesundheitswesen sowie Projektmanagement in Weiterbildungseinrichtungen Berlins, der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (Mannheim) und der Berufsakademie Sachsen (Bautzen). Dr. med. Kirstin Börchers promovierte 1990 zum Doktor der Medizin, war als wissenschaftliche Assistentin in der Frauenklinik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig und schloss mit dem Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe ab. Seit 1998 arbeitet sie im Bereich des medizinischen Qualitätsmanagements. Zunächst als QM-Koordinatorin an zwei Universitätskliniken, seit 2002 als Unternehmensberaterin. Sie ist Mitglied der Gesellschaft für Qualitätsmanagement in der Gesundheitsversorgung e.V. (GQMG). Als Lehrbeauftragte gibt Dr. Börchers an der Universität Duisburg-Essen und der Hochschule Fulda ihr Wissen in Lehrveranstaltungen im Fachgebiet "Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen" an Studenten verschiedener Fachrichtungen und Berufsgruppen weiter. Darüber hinaus ist sie Referentin bei Seminaren und Vorträgen. 2004 gründete Dr. Kirstin Börchers die QM BÖRCHERS CONSULTING + und bietet neben einer umfassenden Qualitätsmanagement- und Unternehmensberatung für das Gesundheitswesen auch die sogenannte Weinrote Seminarreihe an. 2015 folgte die Auszeichnung als TOP CONSULTANT (Mittelstand).
Geleitwort von Prof. Waßmuth 5
Vorwort von Peter Kuntsche 7
Vorwort von Kirstin Börchers 11
Kurzcharakteristik des Buches 14
Inhaltsverzeichnis 19
Über die Autoren 26
1 Einführung 28
1.1Einordnung der Begriffe Qualität, Qualitätsmanagement, Gesundheit und Gesundheitswesen 28
1.1.1Begriff Qualität 28
1.1.2Begriff Qualitätsmanagement 31
1.1.3Begriff Gesundheit 35
1.1.4Begriff Gesundheitswesen 39
1.2Branchenspezifik des Gesundheitswesens 40
1.2.1Wesentliche gesundheitspolitische Spezifika 40
1.2.2Weitere Spezifika deren professionelle Gestaltung die Leistungsfähigkeit stabilisiert und optimiert 48
1.3Einordnung und Zielstellung des Qualitäts- und Risikomanagements im Gesundheitswesen 56
1.3.1Gesamtheitlicher Ansatz mit unternehmensspezifischem Zuschnitt 57
1.3.2Strategische Ausrichtung 57
1.3.3Wirtschaftliche Ausrichtung 58
1.3.4Dienstleistungsausrichtung 60
1.3.5Gesetzliche Ausrichtung 63
1.3.6Prämissen und Stolpersteine bei der praktischen Umsetzung eines Qualitäts- und Risikomanagementsystems 65
Quellen und weiterführende Literatur 72
2 Grundlagen des Qualitäts- und Risikomanagements 78
2.1Entwicklung des Qualitätsmanagements 78
2.2QM-Pioniere und was wir von ihnen lernen können 80
2.2.1Frederick Winslow Taylor und seine Pionierleistungen 80
2.2.1.1 Kurzbiografie 80
2.2.1.2 Die Grundsätze wissenschaftlicher Betriebsführung „The Principles of Scientific Management“ 81
2.2.1.3 Durchführung von Zeit- und Bewegungsstudien 81
2.2.1.4 Einführung Pensumlohn 83
2.2.1.5 Einrichtung Arbeiterbüro 83
2.2.2Kaoru Ishikawa und seine Pionierleistungen 84
2.2.2.1 Kurzbiografie 84
2.2.2.2 Bahnbrechende Pionierleistungen 85
Die acht Grundsätze von Ishikawas CWQC (Company Wide Quality Control) 85
Entwicklung von Gruppenarbeitskonzepten: Qualitätszirkel 86
Das Ishikawa-Diagramm 87
2.2.3William Edward Deming und seine Pionierleistungen 88
2.2.3.1 Kurzbiografie 88
2.2.3.2 Die Demingsche Reaktionskette 89
2.2.3.3 Der PDCA-Zyklus und das Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung (Deming-Kreis) 90
2.3Werkzeuge und Methoden für den Einsatz im Qualitäts- und Risikomanagement 91
2.3.1Hintergrund, Einführung und Übersicht 91
2.3.2Ausgewählte Werkzeuge und Methoden des Qualitäts- und Risikomanagements 92
2.3.2.1 Kennzahlsysteme zum Monitoring und Reporting 92
2.3.2.2 Balanced Scorecard (BSC) 98
2.3.2.3 Benchmarking 100
2.3.2.4 Reviews und Peer-Review-Verfahren 102
2.3.2.5 QFD Quality-Function-Deployment 103
2.3.2.6 Die sieben Qualitätswerkzeuge nach Ishikawa (Q7) 110
2.3.2.7 FMEA (Failure-Mode und Effect Analysis) 110
2.3.2.8 8 D-Methode 114
2.3.2.9 Six Sigma 117
2.4Prozessmanagement 120
2.4.1Hintergrund und Einführung 120
2.4.2Prozessgestaltung 125
2.4.3Prozessbeschreibung 129
2.5Total Quality Management (TQM) 137
Quellen und weiterführende Literatur 140
3 Basissysteme des Qualitäts- und Risikomanagements 146
3.1Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9000 147
3.1.1Anforderungen, Kennzeichen und Grundsätze an ein Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9000 148
3.1.2Verantwortung der Leitung 149
3.1.3Normforderungen zur Dokumentation, Dokumente und Aufzeichnungen 151
3.1.3.1 Dokumentenarten 152
3.1.3.2 Prozess der Dokumentenlenkung 153
3.1.3.3 Ausgewählte zentrale Verfahrensanweisungen 154
3.1.3.4 StandardOrientierung für Verfahrensanweisungen 155
3.1.4Datenanalyse 156
3.1.5Aufgaben der Funktionsträger eines Qualitätsmanagementsystems 156
3.1.6Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) 157
3.1.7Prozessmodell des Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001:2000 159
3.1.8Großrevision ISO 9001:2000 160
3.1.9Revision ISO 9001:2008 163
3.1.10DIN EN ISO 9004:2009 172
3.1.11Großrevision ISO 9001:2015 173
3.1.12Phasen beim Aufbau und der Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems 176
3.1.13Qualitätsorientierte Bewertung durch Audits 180
3.1.13.1 Planung und Vorbereitung 182
3.1.13.2 Durchführung und Nachbereitung 183
3.1.14Zertifizierung 185
3.1.15ISO 9001 Umsetzungsbeispiele Krankenhaus und stationäreambulante Pflege 187
3.2Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN 15224 (Norm für Dienstleistungen in der Gesundheitsversorgung, gemäß Anforderungen nach ISO 9001) 191
3.2.1Einordnung 192
3.2.2Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN 15224 192
3.2.3Überblick 194
3.2.4Elf Qualitätsmerkmale der DIN EN 15224 194
3.2.5Risikomanagement nach DIN EN 15224 197
3.3Risikomanagementsystem nach ISO 31000:2009 198
3.3.1Einordnung 198
3.3.2Anforderungen an ein Risikomanagementsystem nach ISO 31000:2009 200
3.4EFQM (European Foundation for Quality Management)-Modell 201
3.4.1Einordnung 201
3.4.2EFQM-Modell 202
3.4.2.1 Levels of Excellence 203
3.4.2.2 Ludwig-Erhard-Preis (LEP) 205
3.4.2.3 Grundkonzepte der Excellence 206
3.4.3EFQM-Kriterienmodell 206
3.4.4RADAR-Logik 210
3.4.5Revisionen des EFQM-Modells 212
3.4.5.1 Die Schwerpunkte der Revision des EFQM-Modells 20032004 212
3.4.5.2 Die Schwerpunkte der Revision des EFQM-Modells 2010 215
3.4.5.3 Die Schwerpunkte der Revision des EFQM-Modells 2013 217
3.4.6Weg zu Business Excellence 218
3.5KTQ (Kooperation für Transparenz und Qualität)-Modell 219
3.5.1Einordnung 219
3.5.2Einsatz des KTQ-Modells in den gesundheitsversorgenden Sektoren des Gesundheitswesens 221
3.5.3KTQ-Katalog 223
3.5.3.1 Entwicklung des KTQ-Katalogs 223
3.5.3.2 Bewertungssystematik des KTQ-Kataloges 227
3.5.4Zertifizierung 229
3.5.5KTQ und EFQM im Vergleich 232
3.5.6KTQ und DIN EN ISO 9001DIN EN 15224 im Vergleich 235
3.6Strukturierter Qualitätsbericht gemäß SGB V 240
3.6.1Einordnung 240
3.6.2Aufbau des Qualitätsberichtes 242
3.7Charakteristische Verfahren des Qualitäts- und Risikomanagements und der Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit und Soziales 244
3.7.1Charakteristische Verfahren des Qualitäts- und Risikomanagements und der Qualitätssicherung im stationären Sektor 244
3.7.2Charakteristische Verfahren des Qualitäts- und Risikomanagements und der Qualitätssicherung im ambulanten Sektor 244
3.7.2.1 Qualitäts- und Risikomanagement in Arztpraxen (Übersicht) 265
3.7.2.2 Qualitätsmanagementsysteme in der ambulanten Versorgung im Vergleich 267
3.7.2.3 Umsetzung des Qualitäts- und Risikomanagements in Arztpraxen 276
3.7.3Charakteristische Verfahren des Qualitäts- und Risikomanagements und der Qualitätssicherung im Sektor Rehabilitation 279
Die fundierte Kenntnis der Basissysteme des Qualitäts- und Risikomanagements stellt eine solide Säule einer erfolgreichen Unternehmensführung dar 290
Quellen und weiterführende Literatur 293
4 Gesetzlicher Rahmen für Qualitätsmanagement – und Sicherung sowie Risikomanagement 297
4.1Sektorspezifisches Qualitätsmanagement 301
4.1.1Qualität im stationären Sektor 301
4.1.2Qualität im ambulanten Sektor 302
4.1.3Qualität in der stationären und ambulanten Pflege 302
4.1.4Qualität in der medizinischen Rehabilitation 303
4.2Qualität aus Sicht des Gesetzgebers 304
4.3Risiko aus Sicht des Gesetzgebers (Patientenrechtegesetz) 305
4.3.1Einordnung 305
4.4Deutsche Institutionen der Qualitätssicherung 308
4.4.1ÄZQ Das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin 309
4.4.2AQUA – Institut 309
4.4.3BQS – Institut für Qualität und Patientensicherheit GmbH 309
4.4.4IQWiG – Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 310
4.4.5IQTiG – Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen 311
Quellen und weiterführende Literatur 313
5 Qualitätsmanagement in den gesundheitsversorgenden Sektoren des Gesundheitswesens 315
5.1Einordnung 315
5.2Qualität im stationären Sektor 315
5.2.1Wirksamkeit und Nutzen 316
5.2.2Gesetzlicher Rahmen 318
5.2.3Qualitätssichernde Verfahren, Mess- und Bewertungsinstrumente 320
5.3Qualität im ambulanten Sektor 325
5.3.1Wirksamkeit und Nutzen 325
5.3.2Gesetzlicher Rahmen 327
5.3.3Qualitätssichernde Verfahren, Mess-und Bewertungsinstrumente 334
5.4Qualität in der stationären und ambulanten Pflege 337
5.4.1Wirksamkeit und Nutzen 338
5.4.2Gesetzlicher Rahmen 340
5.4.3Qualitätssichernde Verfahren, Mess- und Bewertungsinstrumente 347
5.4.3.1 Pflegemodelle (AEDL, ATL, FEDL) 347
5.4.3.2 Expertenstandards des Deutschen Netzwerkes für Qualitätssicherung in der Pflege (DNQP) 350
5.4.3.3 Qualitätsniveaus der Bundeskonferenz zur Qualitätssicherung (BUKO) 353
5.4.3.4 Ergebnisorientierte Qualitätsindikatoren für Alten- und Pflegeheime (PROGRESS) 356
5.5Qualität im Sektor Rehabilitation 358
5.5.1Wirksamkeit und Nutzen 359
5.5.2Gesetzlicher Rahmen 361
5.5.3Qualitätssichernde Verfahren, Mess-und Bewertungsinstrumente 362
5.5.3.1 Verfahren der medizinischen Rehabilitation 362
5.5.3.2 Verfahren bei Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 365
5.5.3.3 Verfahren zur Sicherstellung der beruflichen (Re-)Integration 365
Qualität rückt immer mehr in den Fokus der Gesundheitsversorgung 369
Quellen und weiterführende Literatur 370
6 Hygienemanagement 374
6.1Hygiene im Rückblick: ein historischer Abriss 375
6.2Begriffe und Einordnung 376
6.3Zusammenhang Qualitäts- und Hygienemanagement 377
6.4Elemente eines systematischen Hygienemanagements 378
6.5Rechtliche Rahmenbedingungen 382
6.5.1Infektionsschutzgesetz 382
6.5.1.1 Einordnung und Zielstellung 383
6.5.1.2 Meldewesen 384
6.5.2Hygieneverordnungen der Bundesländer 386
6.5.2.1 Auswirkung, Chancen und Risiken 386
6.5.3Berufsgenossenschaftliche Vorgaben im Rahmen des Arbeitsschutzes 387
6.5.4Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) vom Robert-Koch-Institut (RKI) 387
6.6Hygiene und Patientensicherheit 388
6.7Hygienemanagement im stationären Sektor 391
6.8Hygienemanagement im ambulanten Sektor 393
6.9Hygienemanagement in der stationären und ambulanten Pflege 397
6.10Hygienemanagement in der medizinischen Rehabilitation 400
Quellen und weiterführende Literatur 402
7 Risikomanagement in den gesundheitsversorgenden Sektoren des Gesundheitswesens 405
7.1Begriffe und Einordnung 406
7.2Klinisches Risikomanagement 414
7.2.1Bedeutung des klinischen Risikomanagements 417
7.2.2Ursachen für qualitäts- und risikorelevante Probleme 419
7.2.3Sicherheitsstrategien zur Patientensicherheit 419
7.2.3.1 Sicherheitsstrategien in der Ablauforganisation 421
7.2.3.2 Sicherheitsstrategien in der Dokumentation 423
7.2.4Nutzen und Mehrwert des Risikomanagements 424
7.2.5Rahmen und Implementierung 426
7.2.5.1 Prozessschritte des Risikomanagements 427
Prozessschritte des Risikomanagements im tabellarischen Ablauf 427
Prozessschritte des Risikomanagements am Beispiel der stationären Pflege 430
Prozessschritte des Risikomanagements am Beispiel „Krankenhaus“ 436
7.2.6Ausgewählte Fehler, Schäden und Risiken 438
7.2.7Interne Kontrollsysteme zur Risikosystemüberwachung und Critical Incident Reporting Systems (CIRS) 440
7.2.7.1 Vorbemerkungen 442
7.2.7.2 Kurzcharakteristik 443
7.2.7.3 CIRS-Einführung 445
7.3Risikomanagement als kontinuierlicher Prozess im Qualitätsmanagement 448
7.3.1Risikoanalyse 451
7.3.2Risikobewertung 451
7.3.3Risikosteuerung 453
7.3.4Risikoüberwachung 453
7.3.4.1 Erfassung kritischer Ereignisse 453
7.3.4.2 Beschwerdemanagement 455
7.3.4.3 Risikoaudits 456
7.3.4.4 Durchführung von Schadensanalysen 456
7.4Risikomanagement in den gesundheitsversorgenden Sektoren des Gesundheitswesens 456
7.4.1Risikomanagement im stationären Sektor 457
7.4.2Risikomanagement im ambulanten Sektor 458
7.4.3Risikomanagement in stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen 459
7.4.3.1 Interdisziplinäre Implementierung von Qualitätsinstrumenten zur Versorgung von Menschen mit Demenz in Altenheimen (InDemA) 460
7.4.3.2 Risiko „Operation“ bei vorbestehender demenzieller Erkrankung (ROVDE) 460
7.4.4Risikomanagement im Sektor Rehabilitation 461
Quellen und weiterführende Literatur 462
8 Integrierte Managementsysteme 465
8.1Entwicklung des Integrationsgedanken 465
8.2Integrierte Managementsysteme (IMS) – Einführung 467
8.2.1Begriffe Managementsystem, Integration und Integrierte Managementsysteme 467
8.2.2Herausforderungen und Chancen, Vorteile und Nutzen integrierter Managementsysteme 470
8.3Aufbau, Implementierung und Zertifizierung integrierter Managementsysteme 474
8.3.1Grundlegende Referenzdokumente und Rahmenorientierungen 474
8.3.1.1 Referenzdokumente – wichtige IMS-Rahmenbasis 476
8.3.1.2 Ausgewählte methodische und führungsseitige Rahmenorientierungen 479
8.3.2Prinzipielle Vorgehensweise bei der Gestaltung eines integrierten Managementsystems 482
8.3.2.1 Phase 1 – Positionierung des Managements 482
8.3.2.2 Phase 2 – Vorbereitung 483
8.3.2.3 Phase 3 – Planung 485
8.3.2.4 Phase 4 – Umsetzung 489
8.3.2.5 Phase 5 – Auditierung 502
8.3.2.6 Phase 6 – Zertifizierung 506
8.3.2.7 „Navigator“ des 6-Phasenmodells 512
Quellen und weiterführende Literatur 520
9 Einordnung und Übersicht einschlägiger Normen, Konzepte und Verfahren im Gesundheitswesen 523
9.1Rahmenorientierung anhand des Neuen St. Galler Management-Modells 524
9.2Einordnung und zusammenfassende Kurzcharakteristik von ausgewählten Normen, Konzepten und Verfahren im Bereich Qualitäts- und Risikomanagement 532
9.3Einordnung und Charakteristik von ausgewählten Normen, Konzepte und Verfahren für weitere Managementsysteme 554
9.3.1Umweltmanagementsystem (UMS) DIN EN ISO 14001 556
9.3.2Umweltmanagementsystem (UMS) EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) 560
9.3.3Entsorgungsfachbetrieb nach EfbV (Entsorgungsfachbetriebsverordnung) 576
9.3.4Arbeitsschutzmanagementsystem (AMS) OHSAS 18001 und ISO 45001 587
9.3.5Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) DIN SPEC 91020 und SCOHS 607
9.3.6Business Continuity Management (BCM) DIN EN ISO 22301 621
9.3.7Corporate Social Responsibility (CSR) DIN ISO 26000 631
9.3.8Compliance Management System (CMS) ISO 19600 und Prüfungsstandard IDW PS 980 641
9.3.9Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) DIN ISOIEC 27001 654
9.3.10IT-Servicemanagementsystem (SMS) ISOIEC 20000 und ITIL 666
9.3.11Datenschutz 676
9.3.12Energiemanagementsystem (EnMS) DIN EN ISO 50001 692
9.4Einordnung und Charakteristik ausgewählter Normen, Konzepte und Verfahren im Bereich Projektmanagement 707
9.4.1PMBOK® Guide (PMI) 710
9.4.2Competence Baseline ICB (IPMA, GPM) 713
9.4.3PRINCE2® (AXELOS) 718
9.4.4Ergänzende PM-Normen 726
9.4.4.1 ISO 21500 726
9.4.4.2 DIN 69900, DIN 69901 und DIN 69909 727
9.4.4.3 ISO 10006 732
Inhalt und Gestaltung systemischer „Elemente“ -Übersicht und Einsatzsupport 733
Quellen und weiterführende Literatur 735
| Erscheint lt. Verlag | 22.2.2017 |
|---|---|
| Zusatzinfo | XXX, 728 S. 84 Abb., 10 Abb. in Farbe. |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Medizin / Pharmazie ► Gesundheitswesen |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management | |
| Schlagworte | Hygienemanagement • Patientenrechtegesetz • pflegemodelle • Qualitätsmanagement • Risikomanagement |
| ISBN-10 | 3-642-55185-8 / 3642551858 |
| ISBN-13 | 978-3-642-55185-7 / 9783642551857 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 10,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich