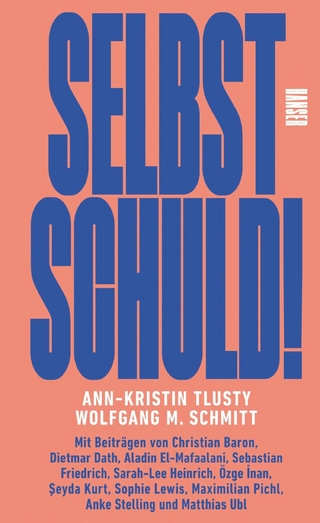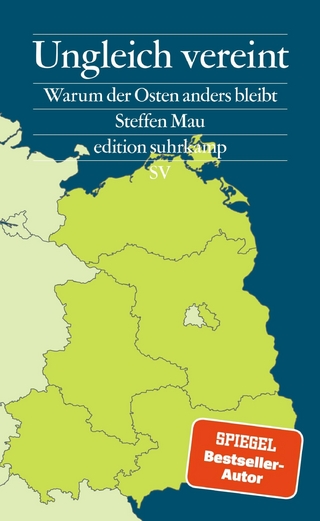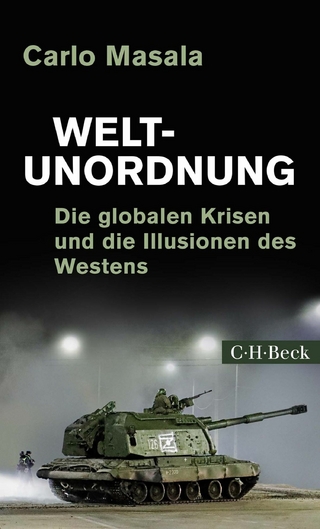Europa in der Falle (eBook)
160 Seiten
Suhrkamp (Verlag)
978-3-518-74092-7 (ISBN)
<p>Claus Offe, geboren 1940, lehrte Politikwissenschaft und Soziologie in Bielefeld, Bremen, an der Humboldt-Universität zu Berlin und an der Hertie School of Governance.</p>
Einleitung
Die Europäische Union befindet sich an einem Scheideweg: Entweder gelingt eine erhebliche Verbesserung ihrer institutionellen Struktur oder es kommt zu ihrem Zerfall. Der Status quo lässt sich jedenfalls nicht fortschreiben. Darüber, dass es nicht weitergehen kann wie bisher, sind sich so gut wie alle einig, sowohl in Europa selbst wie auch die auswärtigen Beobachter der Situation. Ich stehe insofern keineswegs allein mit der Auffassung da, dass die gegenwärtige Krisensituation – die sich zusammengebraut hat aus einer Finanzmarktkrise, einer Staatsschuldenkrise, einer Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise und einer Institutionenkrise der EU und ihrer demokratischen Qualität – wegen ihrer Komplexität und Ungewissheit beispiellos und dauerhaft besorgniserregend ist.[1] Wenn es nicht schnell (wobei niemand weiß, was in diesem Fall »schnell genug« bedeutet, weil wir nicht wissen, ob wir uns »am Anfang, in der Mitte oder am Ende der Krise« befinden[2]) gelingt, die Probleme durch eine institutionelle Generalüberholung der EU zu lösen, werden sowohl das Projekt der europäischen Integration als auch die Weltwirtschaft erheblichen Schaden nehmen – von den schweren sozialen Leiden, die die Gesellschaften der europäischen Peripherie schon durchstehen mussten, ganz zu schweigen.
Es erscheinen pro Monat Dutzende akademische Artikel, policy papers und journalistische Beiträge, in denen die Frage erörtert wird, was man tun könne, um die Krise zu »lösen«. Diese Analysen operieren häufig mit den Alternativen »Rückbau oder Vertiefung der europäischen Integration«.[3] Sie präsentieren zwei oder mehr vorgestellte Auswege aus der Krise und sortieren diese dann nach ihrer vermuteten Machbarkeit und den politischen Präferenzen der Verfasser.
Während diese erste Diagnose einer vielgesichtigen Krise weithin geteilt wird, ist eine zweite Beobachtung eher kontrovers: nämlich die, dass die Krise diejenigen Kräfte weitgehend gelähmt und zum Schweigen gebracht hat, die überhaupt fähig wären, Lösungen zu konzipieren, durchzusetzen und so konstruktive Auswege zu eröffnen. Anders als manche marxistische Denker ebenso wie selbstgewisse Technokraten behaupten, bringen Krisen die Kräfte zu ihrer Überwindung nicht immer selbst hervor. Wir beobachten heute das Gegenteil: Solche Kräfte werden durch die Krise nicht geweckt, sondern blockiert. Anstatt eine positive Dynamik des Lernens und des Widerstandes zu entfalten, werden potentielle Akteure der Veränderung durch die Auswirkungen der Krise selbst deaktiviert und entmutigt. Während es Hoffnungen (z. B. auf einen wirtschaftlichen Aufschwung) und Visionen (z. B. die einer föderativen europäischen Republik) oder auch rückwärtsgewandte Voten für eine Rückkehr zum Nationalstaat bzw. den Ausschluss wirtschaftlich schwacher Mitgliedsstaaten aus der Eurozone zuhauf gibt, bleibt doch die Frage offen, ob überhaupt irgendjemand (und ggf. wer) ausreichend legitimiert und mit genügend politischen und wirtschaftlichen Ressourcen ausgestattet ist, um eine Strategie zu entwickeln und umzusetzen, die Europa in eine wünschbare und nachhaltige Zukunft führen könnte. Auch gibt es keinen Konsens darüber, nach welchen Verfahrensregeln dies geschehen könnte. Man kann insofern von einer »Krise des Krisenmanagements« sprechen (wie ich es vor vierzig Jahren in einem anderen Kontext getan habe[4]). Selbst wenn Einigkeit darüber bestünde, was zu tun ist, so bliebe die zweite und schwierigere Frage unbeantwortet: Wer kann die notwendigen Schritte umsetzen? Das Identifizieren wünschenswerter strategischer Ziele hilft uns wenig, wenn niemand bereit und in der Lage ist, sie anzugehen. Solange wir keine Antwort auf diese Frage haben, befinden wir uns nicht nur in einer Krise – wir stecken in einer Falle. Eine Falle lässt sich als eine Situation definieren, die für jene, die darin gefangen sind, unerträglich ist, während gleichzeitig jeder Rück- oder Ausweg blockiert ist, weil es an den hierzu erforderlichen Kräften und Akteuren fehlt.
Eine Lage, von der wir alle passiv betroffen sind, kann nicht aktiv gestaltet und unter Kontrolle genommen werden, weil es auf europäischer Ebene an einer Instanz fehlt, die mit ausreichender legitimer Macht ausgestattet wäre. Mario Draghi und andere träumen z. B. öffentlich von einem »europäischen Finanzminister« – aber es gibt keinen europäischen Gesetzgeber mit umfassendem Budgetrecht, der befugt wäre, dessen Haushalt zu verabschieden. Die Diskrepanz zwischen der Reichweite von (europaweiten) Kausalketten und der Reichweite national bzw. »intergouvernemental« befangener Kontrollmöglichkeiten betrifft vor allem die Mitglieder der Eurozone: Sie wurden auf der einen Seite geldpolitisch entmachtet, weil sie ihre nationalen Währungen aufgegeben haben; auf der anderen Seite waren sie nach dem Wortlaut der Verträge daran gehindert, die gemeinsame Regierungsfähigkeit und wirtschaftspolitische Gestaltungskapazität aufzubauen, die ihnen erlauben würde, ihre Interdependenz in einer allerseits erträglichen Weise zu regeln und gleichzeitig die Macht der Finanzmärkte zu kontrollieren. Die Eurozone ist heute ein missgebildetes System aus neunzehn Staaten ohne eigene Zentralbank und einer Zentralbank ohne Staat. Soziologisch betrachtet geht der Horizont der »funktionalen« Integration und der Interdependenzen weit über den der »sozialen« Integration und der Beherrschbarkeit durch Akteure hinaus.
Mit dieser Problematik beschäftigt sich dieser Essay, auch wenn die hier entwickelten Lösungen hauptsächlich (wenn auch nicht ausschließlich) negative sind. Ich versuche zu zeigen, dass es eine Reihe von Akteuren gibt, deren Ideen und Ressourcen sich definitiv nicht als aussichtsreiche Krisenlösungen empfehlen. Zu ihnen gehören die EZB, der Europäische Rat, der Rat der Europäischen Union, die deutsche Bundesregierung, renationalisierte Regierungen der Mitgliedsstaaten, die Bewegung der europafeindlichen politischen Parteien und die Technokraten der Europäischen Kommission. Wenn die dramatischen Verhandlungen der Mitglieder der Eurogruppe vom Juli 2015 über die Bewältigung der griechischen Schulden- und Wirtschaftskrise eines überdeutlich demonstriert haben, dann ist es die Unfähigkeit der versammelten Regierungen, Lösungen zu finden, die zugleich effektiv und nachhaltig sind (im Gegensatz zu absehbar kontraproduktiven und kurzlebigen Scheinlösungen) und die zudem von allen Beteiligten als legitim anerkannt werden können (im Gegensatz zu einer unverhohlenen Nötigung eines Mitgliedsstaates durch einen anderen).
Die Tiefe der aktuellen Krise ist einem zentralen Widerspruch geschuldet: Die Dinge, die im Interesse der Stabilisierung von Union und Eurozone dringend angegangen werden müssen, sind innerhalb der Mitgliedsstaaten gleichzeitig in hohem Maße und offenbar zunehmend unpopulär. Das, was zu tun geboten ist (und worüber sich »im Prinzip« alle einig sind, nämlich irgendeine Art der Neuverteilung von Bürden und Zuständigkeiten innerhalb der EU), können die nationalstaatlichen Eliten, sowohl im Zentrum als auch an der Peripherie, ihren Wählern nicht »verkaufen«, d. h. erklären und akzeptabel machen. Schließlich sind die politischen Parteien, die diesen »Verkauf« zu organisieren hätten, nach wie vor wesentlich nationale Machterwerbsorganisationen, die im Geiste eines positivistischen Opportunismus den (vermeintlich) »gegebenen« und unabänderlichen Präferenzen der Wähler folgen, anstatt sich veranlasst zu sehen, diese Präferenzen zu prägen, einen Konsens zu bilden und grenzüberschreitende Vertrauensbeziehungen und Solidaritäten zu schaffen. Politische Parteien (und ebenso die Medien) müssten in der Lage sein, argumentativ Präferenzen zu bilden; dann wären sie imstande, verbreitete Ängste, Verdächtigungen, Anschuldigungen der Verlierer und die Deutung von Konflikten in nationalen Kategorien ein Stück weit zu neutralisieren. Eine verbreitete Einstellung, die politische Parteien eher noch bekräftigt als neutralisiert haben, besteht in einer reflexhaften Verdächtigung: Wenn »wir« für »die anderen« solidarische Opfer bringen, dann werden »die« unsere Großzügigkeit nur ausnutzen, sich selbst nicht weiter anstrengen und sich so auf »unsere« Kosten einen unfairen Vorteil verschaffen. Anders gesagt, die »anderen« werden pauschal nicht nur der mangelnden Leistungsfähigkeit, sondern darüber hinaus der bedenkenlosen Selbstbereicherung bezichtigt – eine bequeme Rahmung bzw. Unterstellung, die sich perfekt eignet zur Abweisung von Solidarpflichten. Die Wirtschaftswissenschaften stellen für diese Rahmung das Theorem des moral hazard zur Verfügung: Hilfe verdirbt den Charakter dessen, dem geholfen wird. Die kognitive Voreingenommenheit des Publikums, die von politischen Parteien noch ermutigt wird, läuft auf den Befund hinaus, dass die Probleme auf dem falschen Verhalten der »anderen« beruhen und sich nicht etwa aus der institutionellen Struktur der Eurozone und der EU ergeben; würde dies anerkannt und vermittelt, dann würden sich die Probleme als Probleme darstellen, die »wir alle« zu bewältigen haben.
Woran es demnach in entscheidender Weise fehlt, ist nicht so sehr Geld wie Konsens und geeignete institutionelle Mechanismen der Konsensbildung und...
| Erscheint lt. Verlag | 8.5.2016 |
|---|---|
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | Europe Entrapped |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Abstiegsgesellschaft • edition suhrkamp 2691 • ES 2691 • ES2691 • EU Europäische Union • Euro • Europa • Europe Entrapped deutsch • Eurozone • Krise • Krisenmanagement • Varoufakis • Wirtschaftspolitik |
| ISBN-10 | 3-518-74092-X / 351874092X |
| ISBN-13 | 978-3-518-74092-7 / 9783518740927 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 4,6 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich