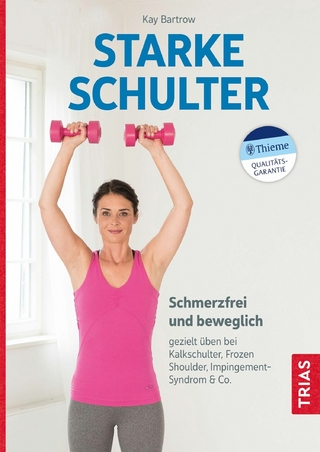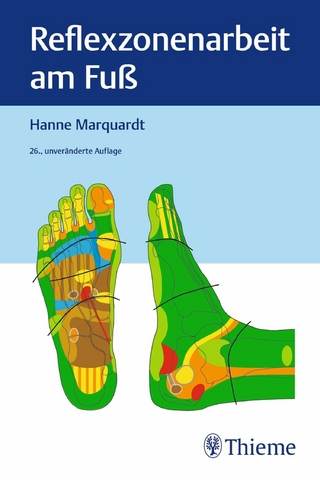Der Schmerz ist die Krankheit (eBook)
224 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-644-04361-9 (ISBN)
Birgit Schmitz, geboren 1971, studierte Geschichte, Germanistik und Soziologie in Köln. Sie arbeitet seit 15 Jahren im Verlagswesen.
Birgit Schmitz, geboren 1971, studierte Geschichte, Germanistik und Soziologie in Köln. Sie arbeitet seit 15 Jahren im Verlagswesen.
Besser als erhofft
Wir fuhren raus aus der Stadt in einen Vorort, der als sozialer Brennpunkt gilt. Viel Beton, Hochhäuser, in die Jahre gekommene Zukunftsvision aus den Siebzigern. Nur jedes zweite Ladenlokal noch vermietet, ein Kiosk, eine Bäckerei, eine Billigdrogerie.
Vor einem der Hochhäuser an der Ausfallstraße parkten wir. Hier war die Adresse, der Eingang eines Wohnhauses. Die Fahrstuhltüren waren zerkratzt, die Knöpfe für die einzelnen Etagen klein und zerbeult, überall Spuren der Abnutzung. Wir fuhren in den sechsten Stock und traten in einen düsteren Flur. Wir wandten uns nach links. Hier war es. Hinter der Eingangstür erwartete uns nicht das helle, freundliche Ambiente einer modernen Arztpraxis, sondern ein Ensemble aus schweren dunklen Möbeln, die vermutlich der Vorgänger vor langer Zeit angeschafft hatte, kombiniert mit ein paar Aushilfsregalen. Einzig der Blick über den Empfangstresen hinweg war erfreulich: eine spektakuläre Aussicht über viele Kilometer und die gesamte Stadt.
Im Wartezimmer war es voll, obwohl es erst 7.30 Uhr war. Überall lagen Broschüren über Demenz und multiple Sklerose herum. Ich hatte C. gebeten, mich an diesem Morgen zu begleiten. Nicht dass sein Beistand dringend erforderlich gewesen wäre. Hier wartete keine niederschmetternde Diagnose auf mich. Doch auf mein eigenes Urteil über Ärzte gab ich inzwischen nicht mehr viel. In den vorangegangenen Monaten hatte ich mehr Ärzte gesehen als je zuvor in meinem Leben und mich gelegentlich in ihnen getäuscht. Ich hatte nicht immer gründlich überlegt, ob ich auch in guten Händen war. Die Erfahrungen mit den Ärzten waren gemischt gewesen. Von souverän bis unsicher, von bescheiden bis überheblich, von empathisch bis gleichgültig – es war alles dabei. Was den Grad der medizinischen Kompetenz anging, verließ ich mich auf mein Gefühl. Zu keinem der Ärzte recherchierte ich ausführlich. Hörensagen, Empfehlungen und letztlich Zufälle gingen den Begegnungen voraus. Manchmal lief es gut, manchmal nicht. Auch über Doktor K., in dessen Wartezimmer ich jetzt saß, wusste ich nicht viel. Eine Freundin war vor Jahren wegen Migräne bei ihm gewesen.
C. und ich wollten uns jedoch keinen weiteren Fehler erlauben. Dieses Mal sollte es der richtige Arzt sein. Den Termin hier hatte meine Hausärztin besorgt. Sonst hätte ich drei Monate warten müssen, und so viel Zeit blieb mir nicht. Mich selbst hatte man am Telefon vertröstet, doch meiner Hausärztin, einer Kollegin, konnte man den Wunsch nicht abschlagen, weshalb ein Termin noch vor den regulären Sprechzeiten eingeschoben wurde.
Bald war kein Platz mehr im Wartezimmer, und einige setzten sich auf Stühle im Empfangsbereich und Flur. Erst viel später sollte ich verstehen, warum es hier so voll war: Zum Neurologen geht fast niemand allein. Die meisten haben einen Angehörigen oder Pfleger dabei, weil sie sich nur noch eingeschränkt bewegen können (multiple Sklerose) oder weil sie schon bei der Ankunft am Empfang die Fahrt im Aufzug vergessen haben (Demenz). Hier im sozialen Brennpunkt saß zudem häufig noch eine dritte Person dabei. Jemand, der Deutsch sprach und zwischen Kranken, Begleitung und Arzt übersetzte.
Traurig machte diesen Ort jedoch etwas anderes als die Überfüllung. Bei Krankheiten wie Alzheimer, Demenz, MS oder Epilepsie geht es nur noch darum, ihren Verlauf zu verzögern, Medikamente mit viel Geduld einzustellen und zu entscheiden, wann es nötig ist, den Betroffenen in ein Heim zu geben, weil zu Hause die Gefahren für das eigene Leben und das der Familie zu groß geworden sind. Heilbar sind sie nicht. Und ich saß hier wegen Kopfschmerzen.
Mein erster Besuch in einer neurologischen Praxis lag zu diesem Zeitpunkt sieben Monate zurück. Mir war zuvor eine Fistel in der Hirnhaut verschlossen worden, und in der Klinik hatte man mir empfohlen, anschließend einen niedergelassenen Neurologen für die Nachbehandlung zu suchen. Weil die Praxis in der Nähe meiner Arbeit lag, war ich einfach dort hingegangen, hatte zwei Stunden gewartet und dem Arzt die Unterlagen überreicht. In der darauffolgenden Zeit verwaltete er vor allem meine Krankenhausaufenthalte. Wenn ich zu ihm ging, erklärte ich ihm in immer neuen Anläufen, dass ich Kopfschmerzen habe. Er führte das Problem auf die vorausgegangenen Behandlungen zurück und sprach von Umbauprozessen. Das klang logisch, war nachvollziehbar, und deshalb glaubte ich es. Doch heute weiß ich: Umgebaut hatte sich in meiner Hirnhaut gar nichts.
Die erste Empfehlung dieses Neurologen hatte zur Jahreszeit gepasst: «Essen Sie mehr Adventsplätzchen.» Spätestens Ostern war der Rat nicht mehr angemessen. Um eine neue Fistel auszuschließen, war ich also noch einmal ins Krankenhaus gegangen. Mit der Diagnose chronischer Kopfschmerz verließ ich es wieder und stand am nächsten Morgen mit einem weiteren Arztbrief in der Hand vor der Praxishelferin.
«Der Termin ist dann am 11. Juni», sagte sie und drückte mir zwei Musterpackungen des Medikaments in die Hand, das man mir in der Klinik verschrieben hatte. Ich notierte mir das Datum und die Uhrzeit. Das würde in knapp zwei Monaten sein. Aber hatten die Ärzte in der Klinik nicht davon geredet, dass das Medikament erst eingestellt werden müsse? Warum konnte ich den Neurologen nicht heute sprechen?
Ich betrachtete die Musterpackung: ein bisschen wie die Pröbchen, die Verkäuferinnen in Kosmetikabteilungen zu den Einkäufen stecken. Bei einem Arzt hatte ich noch nie Pröbchen bekommen. Da ich mich grundsätzlich vor allem Verdorbenen fürchte, wanderte mein Blick zum Verfallsdatum, das – wie ich sofort erkannte – in wenigen Monaten ablaufen würde. Das konnte nur bedeuten: Die Tabletten mussten schon lange unbeachtet im Medikamentenschrank gelegen haben.
Auf dem Weg nach Hause fühlte ich, wie langsam Enttäuschung in mir aufstieg. Sie speiste sich aus verschiedenen Formen von Erschöpfung: Ich war körperlich erledigt, weil ich im Krankenhaus wieder unzählige Untersuchungen über mich hatte ergehen lassen und weil mir das neue Medikament überhaupt nicht bekam. Darüber und über die neue Diagnose hätte ich gern mit dem Neurologen geredet. Aber ich war müde, immer wieder nachzufragen und darum zu bitten, dass man mir helfen möge. Zuwendung ist ein altmodisches Wort, umschreibt jedoch genau das, was ich mir am meisten wünschte. Jemanden, der sich mir zuwendet, dem meine Erkrankung nicht lästig war.
Damals kannte ich eine Zahl noch nicht, die die wachsende Entfremdung zwischen mir und den Ärzten erklärt hätte: 85 Prozent der Ärzte fühlen sich unwohl, wenn sie Patienten mit Schmerzen behandeln. Röntgenaufnahmen oder die Positronen-Emissions-Tomographie, sogenannte PET-Scans, zeigen selten eine klare Ursache. Nur was der Patient erzählt, enthält vielleicht einen Anhaltspunkt. Also muss sich der Arzt durch den Nebel persönlicher Geschichten kämpfen. Wobei jeder mit Schmerzen eine Tragödie erzählt und eine Menge emotionalen Ballast mitbringt. Das galt auch für mich. Darüber hinaus war ich davon überzeugt, dass es sich in meinem Fall um eine sehr seltene, vielleicht etwas unglücklich verlaufene Erkrankung handelte. Weshalb ich die ungeteilte Aufmerksamkeit der Ärzte einforderte – und gleichzeitig total verunsichert war. Ich konnte nur hoffen, dass Doktor K. in seiner Praxis im Hochhaus mit dem Blick über die Stadt es nicht weiter schlimm fand, dass eine erwachsene Frau, nicht auf den Mund gefallen und äußerlich nicht weiter gehandicapt, sich nur mit ihrem Freund zum Termin traute.
Als wir aufgerufen wurden, ging es in ein Büro mit einem Schreibtisch und zwei Stühlen, an der Wand entdeckte ich eine Kinderzeichnung, wie sie stolze Eltern aufhängen. Aus den Zeichnungen schloss ich, dass es sich bei den Flecken auf Doktor K.s dunkelblauem Pullover um Kinderbrei handeln musste. Er hat ungefähr mein Alter, vielleicht etwas über 40, dachte ich, während ich ihm einen Packen mit Röntgenaufnahmen, Arztbriefen und Krankenhausberichten überreichte. Doktor K. überflog alles, legte die Papiere beiseite und ließ mich noch einmal von vorne erzählen.
Erzählen fiel mir damals schwer. Die vielen Informationen aus den letzten Monaten waren nur noch ein wirres Knäuel. Immer wieder verhedderte ich mich in Nebensträngen. C. hätte das wesentlich besser hinbekommen, schließlich hatte er alles miterlebt. Doch ihn hätte ich niemals erzählen lassen können, wäre ihm vermutlich ständig ins Wort gefallen, hätte seine Aussagen richtigzustellen versucht, weil sie mir nicht hundertprozentig treffend erschienen. Es waren ja meine Schmerzen. Nur ich fühlte sie.
Bei der Nachuntersuchung im Krankenhaus hatte sich eine Schar von Neurologen um mich gekümmert. Sie schickten mich zu allen möglichen Tests. Schwere Grunderkrankungen und psychosomatische Probleme schlossen sie aus. Die Diagnose trafen sie danach einhellig und ohne jeden Zweifel: chronische Kopfschmerzen. Auf keinem der Bilder oder dem EEG hatte sich etwas offenbart, was die Schmerzen erklären konnte. Ihre Arbeit war damit getan, Prognosen über den weiteren Verlauf stellten sie nicht an. Auch bei Doktor K. würde es keine Untersuchung geben, die meine Schmerzen nachwiesen, wie man es bei chemischen Experimenten kennt. Mir blieben nur meine Worte. Das war wenig, ich empfand sie nie als ausreichend. «Es tut weh, mal rechts, mal links, mal ganz heftig, dann wieder einfach nur wie ein leichtes Ziehen», sagte ich, aber ich wusste nicht, was es zu bedeuten hatte.
Inzwischen hatte ich angefangen, mich vor negativen Reaktionen...
| Erscheint lt. Verlag | 22.4.2016 |
|---|---|
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Gesundheit / Leben / Psychologie |
| Schlagworte | Angiographie • Chronische Schmerzen • durale AV-Fistel • einschließende Schmerzen vom neuropathischen Typ • Neurologie • Schmerzgedächtnis • Schmerzmedikamente • Schmerztherapie • Spannungskopfschmerz |
| ISBN-10 | 3-644-04361-2 / 3644043612 |
| ISBN-13 | 978-3-644-04361-9 / 9783644043619 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
E-Book Endkundennutzungsbedinungen des Verlages
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich