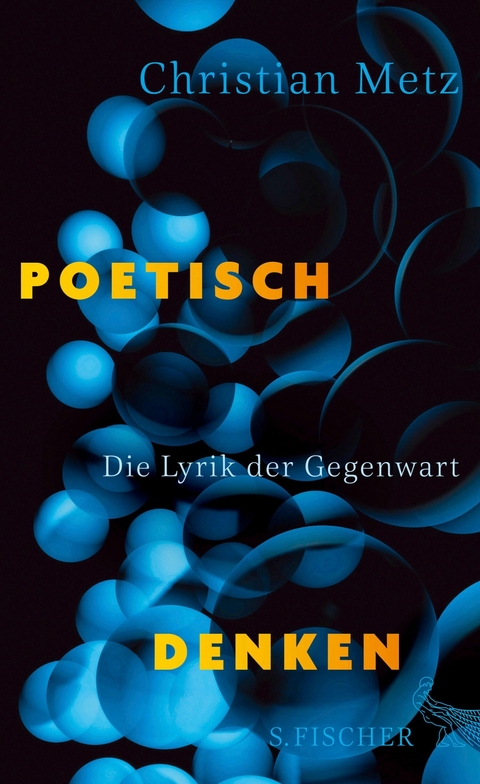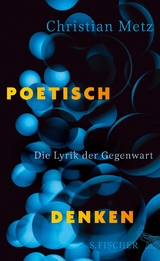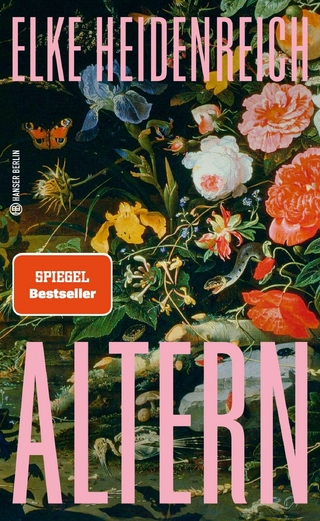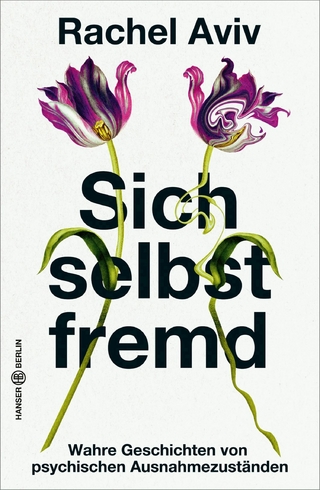Poetisch denken (eBook)
432 Seiten
S. Fischer Verlag GmbH
978-3-10-403562-8 (ISBN)
Christian Metz, geboren 1975, nach seiner Rückkehr von der Cornell University Stipendiat der Alexander von Humboldt-Stiftung an der LMU in München. Jahrelang wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für deutsche Literatur und ihre Didaktik an der Goethe-Universität Frankfurt und Literaturkritiker für die »Frankfurter Allgemeine Zeitung«. Promotion mit einer Arbeit zur »Narratologie der Liebe«. Habilitation zum Thema: »Kitzel. Studien zur Kultur einer menschlichen Empfindung«, deren Monographie bei S. Fischer Wissenschaft im Juni 2020 erscheint. Lehraufträge an der Humboldt-Universität zu Berlin und der Universität Tromsø (Norwegen). Schwerpunkte in Forschung und Lehre: Literatur vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Literaturtheorie, Anthropologie und Literatur. Gemeinsam mit Ina Hartwig und Oliver Vogel Herausgeber der »Neuen Rundschau. Gegenwartsliteratur!« (Heft 2015/1). 2020 wurde er mit dem Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik ausgezeichnet.
Christian Metz, geboren 1975, nach seiner Rückkehr von der Cornell University Stipendiat der Alexander von Humboldt-Stiftung an der LMU in München. Jahrelang wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für deutsche Literatur und ihre Didaktik an der Goethe-Universität Frankfurt und Literaturkritiker für die »Frankfurter Allgemeine Zeitung«. Promotion mit einer Arbeit zur »Narratologie der Liebe«. Habilitation zum Thema: »Kitzel. Studien zur Kultur einer menschlichen Empfindung«, deren Monographie bei S. Fischer Wissenschaft im Juni 2020 erscheint. Lehraufträge an der Humboldt-Universität zu Berlin und der Universität Tromsø (Norwegen). Schwerpunkte in Forschung und Lehre: Literatur vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Literaturtheorie, Anthropologie und Literatur. Gemeinsam mit Ina Hartwig und Oliver Vogel Herausgeber der »Neuen Rundschau. Gegenwartsliteratur!« (Heft 2015/1). 2020 wurde er mit dem Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik ausgezeichnet.
Er ist nicht nur ein guter Kenner der Romantik […] sondern auch zugleich ein guter Beobachter der Lyrik-Szene
[Eine] kolossale Leistung
›Poetisch denken‹ von Christian Metz [ist] wie ein Zoom in die Materie.
Wenn man über Gedichte des 21. Jahrhunderts literaturkritisch, analytisch, philologisch und materialbewusst sprechen und diskutieren will, kommt man an Christian Metz' brandaktueller Studie […] nicht vorbei.
Christian Metz leistet mit ›Poetisch denken‹ Pionierarbeit
eine bahnbrechende Studie zur Lyrik der Gegenwart
Lyrikkritik ist eine Kunst für sich, Christian Metz ist darin zu Hause.
Man wird an dem Buch nicht herumkommen, noch lange.
Stationen und Voraussetzungen des Erfolgs
Für einen ersten Überblick genügt es, sich drei wichtige Stationen der bisherigen Erfolgsgeschichte zu vergegenwärtigen:
2003: Die Anthologie Lyrik von JETZT bietet vierundsiebzig jungen, weitgehend unbekannten Autor*innen den Raum, jeweils vier Gedichte zu publizieren. Herausgegeben wird der Band von den beiden ebenfalls beteiligten Dichtern Björn Kuhligk und Jan Wagner. In seinem Vorwort spricht in der Rolle eines altgedienten Lyrikveterans Gerhard Falkner von den »neuen Leuten«, die auf einmal in der Lyrikszene aufgetaucht seien. Man kann sich gut vorstellen, was für ein eigenartiger Moment das für die etablierten Lyriker*innen gewesen sein muss. Die Tür geht auf, aber nicht vier oder fünf, sondern über siebzig neue Dichter*innen strömen in den poetischen Raum. Plötzlich sieht die Gegenwart anders aus, weil die Zukunft einem ins Gesicht blickt. Noch im selben Jahr gründet die Lyrikerin Daniela Seel aus dem Berliner Label KOOKread den Independent-Verlag kookbooks. Kook, ein Slangwort, bedeutet so viel wie Spinner oder Träumer. Der Name ist Programm. Hier gründen Künstler*innen einen Verlag für Künstler*innen, weil sie ihre Träume verwirklichen, ohne darauf zu warten, dass irgendein etablierter Verlag oder eine Agentur sie vielleicht entdecken könnte. Den Lyrikmarkt durchweht mit den ersten beiden Publikationen des Verlags, den Gedichtbänden von Daniel Falb und Steffen Popp, eine frische Brise. In der taz heißt es: »Die sicherlich spektakulärste Verlagsgründung der letzten Jahre.«
2007: Ann Cotten veröffentlicht im Suhrkamp Verlag ihren aufsehenerregenden Band Fremdwörterbuchsonette. Die damalige Literaturchefin der Frankfurter Rundschau, Ina Hartwig, die nicht gerade für unbegründeten Überschwang bekannt ist, führt plötzlich die Bezeichnung »Wunderkind« im Mund. Zudem begrüßt sie die Debütantin als den »Shootingstar des jungen deutschsprachigen Lyrik-Jetsets«. Langsam wird – nicht nur für Literaturkenner wie Ina Hartwig – zur Gewissheit, dass sich in der Lyrik etwas Großartiges tut. Eine Szene neuer Lyriker*innen hat sich etabliert, hochkarätig, exklusiv, offenbar eher elitär. Mit Mittelmäßigem kann man dort nicht mehr landen.
2015: Die neuen Lyriker*innen sind anerkannte, literarische Größen. Sie haben sich mit ihren Veröffentlichungen, Lesungen und Performances ein eigenes, überwiegend junges Publikum erschlossen. Zu den üblichen Klappentextweisheiten gehören jetzt Sätze wie: »Die Lyrik gilt derzeit als die Avantgarde der deutschen Literatur. So vital, so experimentierfreudig, so unterhaltsam, so klug wird derzeit nirgendwo sonst die Welt in Worte gefasst.« (Amazon-Werbetext zu: Thomas Geiger, Laute Verse) Schritt für Schritt entwächst die Gegenwartslyrik dem Status des Insidertipps. Daher gehen auch die großen Literaturpreise an Lyriker*innen: Jan Wagner erhält für seinen Band Regentonnenvariationen als erster Lyriker den Preis der Leipziger Buchmesse. Monika Rinck wird mit dem Kleist-Preis ausgezeichnet. Mit Nora Gomringer, die bereits 2001 ihren ersten Gedichtband publiziert und sich über Jahre hinweg in der umtriebigen Szene des Poetry-Slams einen Namen gemacht hat, räumt eine Lyrikerin sogar den typischen Prosapreis ab: Sie gewinnt im Sommer 2015 den Ingeborg-Bachmann-Preis.
Auftritt »neuer Leute«, großes Gedränge auf der Lyrikbühne, maßgebliche Verlagsgründung, literaturkritische Wunderkind- und Jetset-Phantasien, preisgewordene Anerkennung – so sah das Erblühen der Lyrik aus. Die Ereignisse markieren weder den Anfang der Lyrikblütezeit, noch nehmen sie deren Ende vorweg: 2017 wurde Monika Rinck der Ernst-Jandl-Preis zugesprochen. Jan Wagner erhielt mit dem Georg-Büchner-Preis die renommierteste Auszeichnung der deutschsprachigen Literatur.
Was aber waren die Voraussetzungen für diesen einzigartigen Erfolg? Zumindest drei Besonderheiten mussten dabei zusammenkommen.
Erstens war schon bei den 74 »neuen Leuten«, die in Lyrik von JETZT versammelt waren, klar: Da kam nicht ein interessanter, sondern gleich eine Gruppe hochgradig begabter Autor*innen zu Wort. Das ergab zugleich eine außergewöhnliche Begabtendichte, die für das jahrelange Zusammenarbeiten, die Zirkulation von Konzepten, Theorien, Versen und Gedanken sowie – die Lyrik ist kein Idyll – für den Wettbewerb von Ideen sicher kein Nachteil war.
Zweitens fiel das Auftreten dieser neuen Dichter*innen exakt mit einschneidenden Veränderungen außerhalb der Literatur zusammen, die das literarische Arbeiten grundlegend veränderten. Unter den Großthemen, die anstanden – von der Globalisierung, 9/11, Finanzkrise bis zum Klimawandel –, sind die Auswirkungen auf die Lyrik am direktesten von der Digitalisierung ausgegangen. Man sieht das sehr gut an der berühmtesten Lyrikform, die es gibt: Erlebnislyrik. Das heißt an der Vorstellung, ein Autor oder eine Autorin erlebe ein Ereignis und setze dieses Erlebnis dann in ein Gedicht um. Die Lyrik, so der Eindruck, der seit dem 18. Jahrhundert eingeübt worden ist, gilt dann als Ausdruck des Gefühls und der Gedanken. Wenn man heute aber mitten im Erleben mit Hilfe von Google in Sekundenschnelle auf ein kulturelles Archiv zurückgreifen kann, wenn plötzlich eine weltweite Kommunikation in Jetztzeit möglich wird, wenn mit Blogs und Facebook (seit 2004 in Deutschland) potentiell jeder zum (veröffentlichenden) Erlebnis-Dichter wird, wenn per Smartphones (2004 kamen die ersten mit Kamera auf den deutschen Markt, 2007 das erste iPhone) und Twitter (seit 2006) jeder zum Dokumentaristen persönlicher Ereignisse wird, dann verändern sich die Vorstellungen und Praktiken des lyrischen Schreibens, der Status von Lektüre, die Zirkulation von Geschriebenem, Ideen und Konzepten. Zum Glück hatten die »neuen Leute« sehr präsent, wie Rolf Dieter Brinkmann 1969 in Angriff aufs Monopol der Lyrik die Leviten gelesen und gefordert hatte, sie müsse sich den gravierenden technologischen Veränderungen ihrer Zeit stellen. Tatsächlich musste niemand den neuen Lyriker*innen lange erklären, was für eine reizvolle Aufgabe sich ihnen schon allein aus der Digitalisierung eröffnete. Nicht zu vergessen: die Möglichkeiten des Desktop-Publishing, das sich in den neunziger Jahren durchsetzte und kleinen Verlagen wie kookbooks die günstige Herstellung komplexer Bücher ermöglichte.
Drittens kam es zu einer Abkehr von der routinierten Abkehr. Oft wenden sich Lyrikdebütanten nach kurzer Zeit entweder gleich dem Roman oder zuerst noch Erzählungen zu. Andere widmen sich dem Drama. Wieder andere der Wissenschaft, dem Brotberuf oder der Familie. Anschließend arbeiten die vereinzelt Übriggebliebenen mehr oder weniger einsam vor sich hin, chronisch von der Öffentlichkeit übersehen. Daraus wird keine Lyrikblütezeit. In diesem Fall aber blieben die »neuen Leute« der Lyrik treu. Sicher, einige von ihnen schrieben zugleich auch Romane. Essays und Autorenpoetiken verfassen sie sowieso alle durch die Bank weg. Aber sie verstehen sich doch in erster Linie als Lyriker*innen. Sie alle veröffentlichten im Rhythmus von zwei, drei Jahren kontinuierlich weitere Gedichtbände. Dazwischen publizierten sie einzelne Gedichte, Zyklen oder Poetiken in Anthologien. Ihre einzelnen Arbeiten fügen sich inzwischen zu etwas, was man traditionell einen »Werkkomplex« nennt. Über die Jahre hinweg hat sich so eine Gruppe etwa gleichaltriger, untereinander sehr gut vernetzter Lyriker*innen herausgebildet, deren Schreibkarrieren beinah parallel verlaufen sind. Sie verbindet kein einheitliches, übergreifendes Programm, jedoch ein durchgehendes Gespräch über ihre unterschiedlichen Positionen. Ein Großteil dieser Autor*innen publiziert im Berliner Verlag kookbooks. Dort hat die Verlegerin Daniela Seel mit Daniel Falb, Ron Winkler, Steffen Popp, Hendrik Jackson, mit Uljana Wolf, Monika Rinck, Dagmara Kraus, Sabine Scho und Martina Hefter zahlreiche hochkarätige Lyriker*innen um sich versammelt. Oder wie es Detlef Kuhlbrodt zum Jubiläum des Verlags in der taz schrieb: »Die Liste der Autoren, die hier ihre Heimat und Zuflucht gefunden haben, liest sich wie ein Lexikoneintrag Deutsche Lyrik des 21. Jahrhunderts, verfasst im Jahre 2050.« Willkommen im Jetzt und in der Zukunft. Manche sprechen aufgrund dieser Autor*innendichte von einer kookbooks-Ästhetik, die sich etabliert habe. Da ist sicher etwas dran, aber längst nicht alle wichtigen Lyriker*innen publizieren dort.
Die Mehrzahl der Autor*innen lebt bis heute in Berlin. Manche sprechen daher von einer neuen Berliner Avantgarde (und kokettieren mit einer Verwandtschaft zur »Berliner Schule« um Filmemacher wie Schanelec, Petzold, Farocki, Arslan). Aber auch da muss man einschränken: Längst nicht alle großartigen Lyriker*innen leben in der deutschen Hauptstadt. Mit äußerlichen Gemeinsamkeiten dieser Art ist es also schwer. Es ist ratsam, auf solche Etiketten zu verzichten und zunächst nur festzuhalten: Wenn Allen Ginsberg einst in seinem Gedicht »Geheul« wehklagte: »Ich sah die besten Köpfe meiner Generation zerstört vom Wahnsinn, ausgemergelt hysterisch nackt«, wenn der ehemalige Presseleiter von Facebook jammerte, »die besten Gehirne meiner Generation denken nur darüber nach, wie man Leute dazu verleitet, auf Werbung zu klicken«, dann lässt sich vom heutigen Standpunkt aus mit Blick auf die...
| Erscheint lt. Verlag | 4.10.2018 |
|---|---|
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Essays / Feuilleton |
| Schlagworte | Essay • Gedichte • Gegenwartslyrik • Poetik |
| ISBN-10 | 3-10-403562-8 / 3104035628 |
| ISBN-13 | 978-3-10-403562-8 / 9783104035628 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 6,0 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich