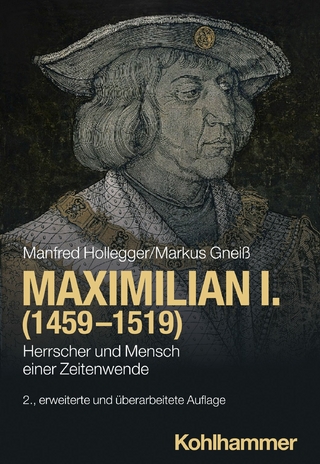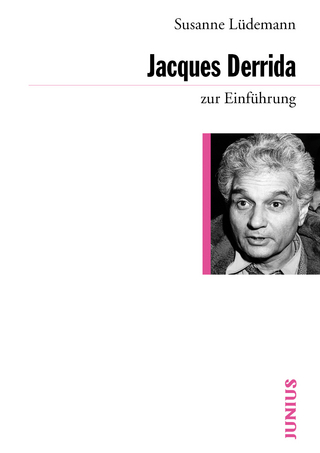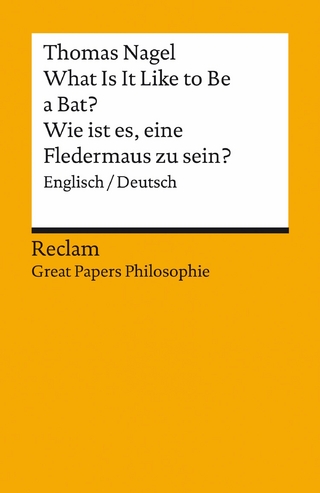Die Idee des Sozialismus (eBook)
199 Seiten
Suhrkamp (Verlag)
978-3-518-74238-9 (ISBN)
Die Idee des Sozialismus hat ihren Glanz verloren, so Axel Honneth in seinem luziden und kontrovers diskutierten politisch-philosophischen Essay, der nun als erweiterte Ausgabe im Taschenbuch erscheint. Der Grund dafür liege darin, dass in ihr theoretische Hintergrundannahmen am Werk sind, die aus der Zeit des Industrialismus stammen, im 21. Jahrhundert aber keinerlei Überzeugungskraft mehr besitzen. Sie müssen ersetzt werden, und zwar durch Bestimmungen von Geschichte und Gesellschaft, die unserem heutigen Erfahrungsstand angemessen sind. Nur wenn das gelingt, kann das Vertrauen in ein Projekt zurückgewonnen werden, das nach wie vor zeitgemäß ist.
Axel Honneth, geboren 1949, ist Jack C. Weinstein Professor of the Humanities an der Columbia University in New York. 2015 wurde er mit dem Ernst-Bloch-Preis, 2016 für <em>Die Idee des Sozialismus</em> mit dem Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch ausgezeichnet. 2021 hielt er in Berlin seine vielbeachteten Benjamin-Lectures zum Thema des Buches <em>Der arbeitende Souverän</em>.
Axel Honneth, geboren 1949, ist Jack C. Weinstein Professor of the Humanities an der Columbia University in New York, Senior Professor für Philosophie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main sowie geschäftsführender Direktor des dortigen Instituts für Sozialforschung.
Einleitung
Die Gesellschaften, in denen wir leben, sind durch einen höchst irritierenden, schwer zu erklärenden Zwiespalt geprägt. Einerseits ist das Unbehagen über den sozioökonomischen Zustand, über die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Arbeitsbedingungen, in den letzten Jahrzehnten enorm angewachsen; wahrscheinlich haben sich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs niemals so viele Menschen gleichzeitig über die sozialen und politischen Folgen empört, die mit der global entfesselten Marktökonomie des Kapitalismus einhergehen. Andererseits aber scheint dieser massenhaften Empörung jeder normative Richtungssinn, jedes geschichtliche Gespür für ein Ziel der vorgebrachten Kritik zu fehlen, so daß sie eigentümlich stumm und nach innen gekehrt bleibt; es ist, als mangele es dem grassierenden Unbehagen an dem Vermögen, über das Bestehende hinauszudenken und einen gesellschaftlichen Zustand jenseits des Kapitalismus zu imaginieren. Die Entkoppelung der Entrüstung von jeglicher Zukunftsorientierung, des Protests von allen Visionen eines Besseren, ist in der Geschichte moderner Gesellschaften tatsächlich etwas Neues; seit der Französischen Revolution waren die großen Bewegungen der Auflehnung gegen die kapitalistischen Verhältnisse stets von Utopien beflügelt, die Bilder davon entwarfen, wie die zukünftige Gesellschaft einmal verfaßt sein sollte – man denke nur an die Maschinenstürmer, an die Kooperativen Robert Owens, an die Rätebewegung oder an die kommunistischen Ideale einer klassenlosen Gesellschaft. Der Zufluß solcher Ströme des utopischen Denkens, wie Ernst Bloch gesagt hätte, scheint heute unterbrochen zu sein; man weiß zwar ziemlich genau, was man nicht will und was an den gegenwärtigen Sozialverhältnissen empörend ist, hat jedoch keine auch nur halbwegs klare Vorstellung davon, wohin eine gezielte Veränderung des Bestehenden sollte führen können.
Eine Erklärung für dieses plötzliche Versiegen utopischer Energien zu finden, ist schwerer, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Der Zusammenbruch der kommunistischen Regime im Jahr 1989, auf den intellektuelle Beobachter gerne verweisen, um daraus ein Zerrinnen aller Hoffnungen auf einen Zustand jenseits des Kapitalismus abzuleiten, kann wohl kaum als Ursache herangezogen werden; denn die empörten Massen, die heute zu Recht die wachsende Kluft zwischen öffentlicher Armut und privatem Reichtum beklagen, ohne indes über eine konkrete Vorstellung einer besseren Gesellschaft zu verfügen, mußten gewiß nicht erst durch den Fall der Mauer davon überzeugt werden, daß der Staatssozialismus sowjetischer Prägung soziale Wohltaten nur um den Preis der Unfreiheit spendete. Zudem hatte die Tatsache, daß bis zur Russischen Revolution eine reale Alternative zum Kapitalismus nicht existierte, die Menschen im 19. Jahrhundert keinesfalls daran gehindert, sich ein gewaltloses Zusammenleben in Solidarität und Gerechtigkeit auszumalen; warum also sollte der Bankrott des kommunistischen Machtblocks mit einem Mal dazu geführt haben, daß diese anscheinend tiefsitzende Fähigkeit zur utopischen Überschreitung des jeweils Bestehenden heute verkümmert ist? Eine andere Ursache, die häufig angeführt wird, um die eigentümliche Zukunfts- und Bilderlosigkeit der gegenwärtigen Empörung zu erklären, wird im jähen Wandel unseres kollektiven Zeitbewußtseins vermutet: Mit dem Eintritt in die »Postmoderne«, wie er sich zunächst in der Kunst und der Architektur, dann aber auch in der Kultur als Ganze vollzogen habe, seien die für die Moderne charakteristischen Vorstellungen eines gerichteten Fortschritts so nachhaltig entwertet worden, daß heute statt dessen kollektiv das Bewußtsein einer historischen Wiederkehr des Immergleichen vorherrsche. Auf dem Boden dieser neuen, postmodernen Geschichtsauffassung, so lautet die zweite Erklärung, könnten Visionen eines besseren Lebens schon deswegen nicht mehr gedeihen, weil jede Idee davon abhanden gekommen sei, daß die Gegenwart durch die ihr innewohnenden Potentiale stets schon über sich hinaustreibe und in eine offene Zukunft ständiger Vervollkommnungen weise; viel eher werde inzwischen die kommende Zeit nur noch als etwas vorgestellt, das nichts anderes mehr zu bieten habe als ein bloßes Durchspielen von aus der Vergangenheit bereits vertrauten Lebensformen oder Sozialmodellen. Allein jedoch schon der Umstand, daß wir in anderen Funktionszusammenhängen durchaus noch mit begrüßenswerten Fortschritten rechnen, nämlich zum Beispiel in der Medizin oder bei der Durchsetzung der Menschenrechte, läßt Zweifel aufkommen, ob eine derartige Erklärung wirklich überzeugend ist: Warum sollte nur in diesem einen Bereich, dem der Refomierbarkeit der Gesellschaft, ein Mangel an transzendierendem Vorstellungsvermögen vorliegen, wenn dieses doch auf anderen Feldern noch weitgehend intakt zu sein scheint? Die These von einem grundsätzlich gewandelten Geschichtsbewußtsein unterstellt, daß jegliche Antizipation eines gesellschaftlich Neuen heute verlorengegangen sei, ohne dabei zu berücksichtigen, welche starken, gewiß übertriebenen Hoffnungen sich gegenwärtig etwa an eine weltweite Implementierung der Menschenrechte heften.[1] Eine weitere, dritte Erklärung könnte sich daher auf den Unterschied beziehen, der zwischen den beiden genannten Feldern besteht, also zwischen einer strukturneutralen Überstülpung international sanktionierter Rechte und einem Umbau in den gesellschaftlichen Basisinstitutionen, um daraus den Schluß zu ziehen, daß nur mit Bezug auf den zweiten Bereich die utopischen Kräfte mittlerweile erlahmt sind. Nach meinem Eindruck kommt diese These der Wahrheit am nächsten, bedarf aber natürlich einer Ergänzung; denn es muß ja zusätzlich erläutert werden, warum es die gesellschaftspolitische Materie sein soll, die heute nicht mehr mit utopischen Erwartungen aufgeladen werden kann.
Es mag hier der Hinweis darauf weiterhelfen, daß sich die wirtschaftlich-sozialen Vorgänge dem öffentlichen Bewußtsein heute als viel zu komplex und daher undurchschaubar darstellen, um noch als gezielten Eingriffen zugänglich gelten zu können; vor allem durch die Prozesse der ökonomischen Globalisierung mit ihren in ihrer Schnelligkeit kaum mehr überblickbaren Transaktionen scheint sich eine Art von Pathologie zweiter Ordnung herausgebildet zu haben, die darin besteht, daß die Bevölkerung die institutionellen Bedingungen des Zusammenlebens nur noch als »dingliche« Verhältnisse, als jedem menschlichen Eingriff entzogene Gegebenheiten ansieht.[2] Erst heute käme dann die berühmte Fetischismusanalyse, die Marx im ersten Band von Das Kapital entwickelt hat, zu ihrem historischen Recht; nicht schon in der Vergangenheit des Kapitalismus, als die Arbeiterbewegung in ihren Träumen und Visionen die existierenden Zustände noch für veränderbar gehalten hat,[3] sondern erst in der Gegenwart hätte sich die allgemeine Überzeugung breitgemacht, daß die sozialen Beziehungen in eigentümlicher Weise »gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen« sind.[4] Wenn dem so wäre, wofür Alltagsbeobachtungen ebenso wie empirische Analysen sprechen,[5] würde sich unser Vermögen zur Vorwegnahme sozialer Verbesserungen an der Grundstruktur der gegenwärtigen Gesellschaften deswegen nicht mehr entfalten können, weil diese genauso wie Dinge in ihrer Substanz als kaum mehr veränderbar gilt; es wäre nicht der Wegfall einer real existierenden Alternative zum Kapitalismus, nicht eine grundlegende Wandlung in unserem Verständnis der Geschichte, sondern die Vorherrschaft einer fetischisierenden Auffassung gesellschaftlicher Verhältnisse, die dafür verantwortlich gemacht werden müßte, daß die massenhafte Empörung über die skandalöse Verteilung von Reichtum und Macht jeden Sinn für ein in Reichweite stehendes Ziel heute so offensichtlich verloren hat.
Allerdings bleibt auch diese dritte Erklärung noch unvollständig, weil sie keine Angaben darüber macht, warum denn die überkommenen Utopien nicht mehr die Kraft zur Auflösung oder zumindest Durchlöcherung des verdinglichenden Alltagsbewußtseins besitzen; über mehr als ein ganzes Jahrhundert lang kam doch den sozialistischen und kommunistischen Utopien die Fähigkeit zu, die Gemüter der Betroffenen immer wieder so stark mit Visionen eines besseren Zusammenlebens zu elektrisieren, daß sie vor den sicherlich auch schon damals bestehenden Tendenzen zur resignativen Hypostasierung sozialer Vorgänge gefeit waren. Der Umfang dessen, was die Menschen jeweils für »unvermeidlich« und damit für sachnotwendig an ihrer Gesellschaftsordnung halten, ist in hohem Maße von kulturellen Faktoren abhängig und hier vor allem vom Einfluß politischer Deutungsmuster, die das scheinbar Notwendige als kollektiv veränderbar darzustellen vermögen. In seiner historischen Studie Ungerechtigkeit hat Barrington Moore überzeugend gezeigt, inwiefern das Gefühl hoffnungsloser Unvermeidbarkeit unter deutschen Arbeitern stets in dem Augenblick zu schwinden begann, in dem ihnen kraftvolle Neuinterpretationen das bloß Arrangierte, den Aushandlungscharakter des institutionell Gegebenen aufzeigen konnten.[6] Um so stärker stellt sich im Lichte solcher Überlegungen dann aber die Frage, was die Ursachen dafür sind, daß heute alle klassischen, einst einflußreichen Ideale ihrer entschleiernden, die Verdinglichung zerstörenden Wirkung verlustig gegangen sein sollen; warum, so müßte noch konkreter gefragt werden, verfügen die Visionen des Sozialismus schon seit geraumer Zeit nicht mehr über die Kraft, die Betroffenen davon zu überzeugen, daß das scheinbar »Unvermeidbare« mit kollektiven Anstrengungen doch zugunsten eines...
| Erscheint lt. Verlag | 6.10.2015 |
|---|---|
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Philosophie ► Philosophie der Neuzeit |
| Schlagworte | Bruno-Kreisky-Preis 2015 • Ernst-Bloch-Preis 2015 • Essay • Philosophie • Sozialismus • STW 2224 • STW2224 • suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2224 |
| ISBN-10 | 3-518-74238-8 / 3518742388 |
| ISBN-13 | 978-3-518-74238-9 / 9783518742389 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 4,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich