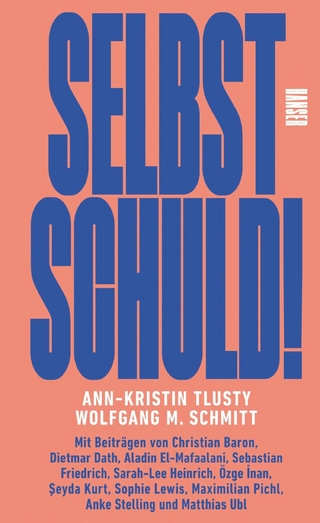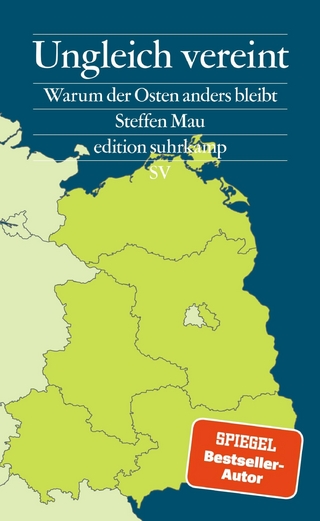Kriegssplitter (eBook)
400 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-644-12111-9 (ISBN)
Herfried Münkler, geboren 1951, ist emeritierter Professor fu?r Politikwissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität und eine unverzichtbare, prägende Stimme in den Debatten unserer Gegenwart. Viele seiner Bu?cher gelten als Standardwerke, etwa «Imperien», «Die Deutschen und ihre Mythen», «Der Große Krieg» oder «Die neuen Deutschen» (mit Marina Mu?nkler), allesamt Bestseller. Zuletzt erschien «Welt in Aufruhr», das ebenfalls lange auf der «Spiegel»-Bestsellerliste stand. Herfried Mu?nkler wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Wissenschaftspreis der Aby-Warburg-Stiftung, dem Carl Friedrich von Siemens Fellowship, dem Preis der Leipziger Buchmesse und dem Bruno-Kreisky-Preis fu?r das politische Buch.
Herfried Münkler, geboren 1951, ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität und eine unverzichtbare, prägende Stimme in den Debatten unserer Gegenwart. Viele seiner Bücher gelten als Standardwerke, etwa «Imperien», «Die Deutschen und ihre Mythen», «Der Große Krieg» oder «Die neuen Deutschen» (mit Marina Münkler), allesamt Bestseller. Zuletzt erschien «Welt in Aufruhr», das ebenfalls lange auf der «Spiegel»-Bestsellerliste stand. Herfried Münkler wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Wissenschaftspreis der Aby-Warburg-Stiftung, dem Carl Friedrich von Siemens Fellowship, dem Preis der Leipziger Buchmesse und dem Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch.
Teil I
Die großen Kriege des 20. Jahrhunderts
1. Der Sommer 1914 als weltgeschichtliche Zäsur
Wer sich an der Vergangenheit orientiert, um sich in seiner Gegenwart zurechtzufinden, kommt nicht ohne historische Interpunktionen aus: Man sucht nach Einschnitten in der Zeit, durch die sich Epochen voneinander trennen lassen, Neues gegen Altes abgegrenzt werden kann. Sicherlich gibt es fließende Übergänge, bei denen die Zeitgenossen gar nicht merken, dass sich etwas grundlegend verändert hat; wirklich sinnfällig sind nur die Zäsuren, die sich mit einem einschneidenden Ereignis oder einem Epochenjahr verbinden. 1945, das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Teilung Europas zwischen Ost und West, war ein solches Epochenjahr; 1989, der Fall der Mauer, der Zusammenbruch des Ostblocks und das Ende des Kalten Krieges, war ein weiteres. Aber war 1914, der Beginn des Ersten Weltkriegs, auch ein Epochenjahr?
Es gibt einige, die das bezweifeln und stattdessen die weltgeschichtliche Zäsur auf das Jahr 1917 datieren, das Jahr, in dem die USA in den großen europäischen Krieg eintraten, während gleichzeitig in Russland zwei Revolutionen stattfanden, deren zweite die weltpolitische Agenda für sieben Jahrzehnte grundlegend verändern sollte.[11] Der Kriegseintritt der Vereinigten Staaten, die der eigentliche Sieger im Ersten Weltkrieg waren – insofern es ihnen als einziger der am Krieg beteiligten Großmächte gelang, aus dem militärischen Sieg politische Macht und ökonomische Prosperität zu schlagen –, hat die Dominanz und Vorherrschaft Europas beendet. Und der Sieg der Bolschewiki in Moskau und Petrograd leitete eine Epoche der revolutionären Heilserwartung ein, in der sich die Politiker und die politischen Intellektuellen mehr denn je zuvor als Verfasser von Zukunftsentwürfen begriffen, als die alles entscheidenden Gestalter des individuellen wie gesellschaftlichen Lebens. Diese Epoche endete, als sich die zähe Macht der Verhältnisse dem gestalterischen Elan der politischen Avantgarden endgültig als überlegen erwies. Die Avantgarden hatten von der Schaffung einer neuen Welt und eines neuen Menschen geträumt.[12] Die Künstler, die Maler und Bildhauer, Lyriker und Schriftsteller, haben diesen Traum verwirklicht: Sie schufen ein neues Bild der Welt und des Menschen. Aber die sozialen und politischen Avantgarden sind gescheitert. Der Sowjetkommunismus und seine Filiationen in Ostasien, Lateinamerika und im subsaharischen Afrika haben gewaltige Energien mobilisiert – und zumeist nur ausgebrannte, erschöpfte Gesellschaften zurückgelassen.
Sollten wir darum nicht doch den Sommer 1914 als das Ende des alten Europa und das Jahr 1917 als Beginn einer neuen Epoche in der Weltgeschichte begreifen? Die Zäsur, die der Erste Weltkrieg in der Geschichte darstellt, wäre dann nicht ausschließlich auf seinen Beginn zu datieren, sondern würde sich über seinen gesamten Verlauf erstrecken, und dabei würde die Eskalation der Gewalt eine ausschlaggebende Rolle spielen. Das ist für große, einschneidende Kriege typisch: dass bei ihrem Beginn nicht abzusehen ist, wie lange sie dauern und welche langfristigen Folgen sie haben werden. Das war bei der Rebellion der böhmischen Stände gegen die kaiserlichen Statthalter in der Prager Burg im Jahre 1618 so, also bei Beginn des Dreißigjährigen Krieges, und das gilt auch für die Intervention der preußischen und österreichischen Heere gegen das revolutionäre Frankreich, der dann mehr als zwei Jahrzehnte lang immer neue Kriegszüge folgten – danach waren die politischen Verhältnisse in Europa fundamental andere.
Als der Historiker Eric Hobsbawm die Formel vom «langen 19. Jahrhundert» prägte, hat er dessen Beginn auf das Jahr 1789 und das Ende auf das Jahr 1914 datiert, also eine historische Einheit vom Beginn der Französischen Revolution bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs behauptet. Hobsbawms Epochenzäsuren sind vom Feuilleton wie von der Wissenschaft bereitwillig übernommen worden.[13] Warum eigentlich? Hätte es nicht nähergelegen, das Ende dieser mit einer bürgerlichen Revolution begonnenen Epoche auf 1917 zu datieren, als eine sozialistische Revolution erfolgreich war? Oder wenn man die Kriegsgeschichte zum Maßstab der Epochenbrüche machen wollte: Wäre dann nicht 1815 mit dem Wiener Kongress und der dort geschaffenen Friedensordnung Europas das angemessenere Datum für den Beginn einer Epoche gewesen, die 1914 mit der Zerstörung dieser Ordnung endete?
Zur Schaffung historischer Epochen gehört nicht nur die Sinnfälligkeit von Zäsuren, sondern auch die Plausibilität von Ligaturen, die Beschreibung von Zusammenhängen, die über Unterbrechungen hinweggreifen und Ereignisse, die manchem als Zäsur erscheinen mögen, in die Kontinuität einer Epoche bringen. Derlei Ligaturen lassen sich sozialgeschichtlich, kulturgeschichtlich, mentalitätsgeschichtlich, aber auch politikgeschichtlich herstellen. Letzteres ist sicherlich am anspruchsvollsten und kompliziertesten, weil hier nach der Kontinuität und Dauer von Strukturen und Ordnungsmustern Ausschau gehalten werden muss, die in ständigem Wandel begriffen sind. Die Politikgeschichte ist das genuine Feld der Veränderung. Wer in ihr nach Zäsuren sucht, wird schnell fündig; wem es um Ligaturen geht, der muss sehr genau hinschauen.
Die Festlegung von Zäsuren und die Behauptung von Ligaturen der Geschichte sind nicht zuletzt darum so heikel, weil sich in ihnen immer auch unser politisches Selbstverständnis mitsamt den darin eingelassenen Zukunftserwartungen niederschlägt. Wir ordnen die Geschichte nicht nur nach ihrem tatsächlichen Verlauf, sondern auch gemäß den uns je beschäftigenden Erwartungen und Befürchtungen. Die von uns in die Geschichte eingebrachten Interpunktionen sind nie bloß das Ergebnis objektivierender Beobachtung, sondern reflektieren immer auch unsere Enttäuschungen oder die aufrechterhaltene Hoffnung, dass sich die Dinge doch noch in unserem Sinne entwickeln könnten. Die zahllosen deutschen Intellektuellen, die den Kriegsausbruch von 1914, kaum dass er erfolgt war, als eine welthistorische Zäsur feierten, von dem Romancier und Essayisten Thomas Mann über den Philosophen Max Scheler bis zu dem Soziologen Georg Simmel,[14] taten dies nicht zuletzt deswegen, weil sie hofften, in der neuen Zeit würden die negativen Erscheinungen der zurückliegenden Jahrzehnte verschwinden: der vorherrschende Materialismus, die Dominanz des Geldes, das sich von einem Mittel zum Zweck des Lebens gewandelt hatte, und nicht zuletzt die sich immer stärker bemerkbar machende Erosion der sozialen Gemeinschaften. Die Intellektuellen sollten sich gründlich täuschen: Der Krieg hat all das, was sie zum Verschwinden gebracht wissen wollten, nur noch verstärkt – jedenfalls wenn man die Entwicklung über einen längeren Zeitraum betrachtet. Sie haben ihre politischen und kulturellen Hoffnungen auf den Kriegsausbruch projiziert und damit dem Krieg einen Sinn zugeschrieben, eine Sinnstiftung vorgenommen, die ihn rechtfertigte und «heiligte».
Im Unterschied dazu haben die französischen und englischen Intellektuellen das Jahr 1914 weniger als einen Bruch denn als Kontinuität der Geschichte dargestellt. Der Lebensphilosoph Henri Bergson hat in einem Vortrag in der Académie française gleich nach Kriegsausbruch diese Argumentationsrichtung vorgegeben: Es gehe in diesem Krieg darum, die Zivilisation gegen die Barbarei zu verteidigen.[15] Bergson stellte den Krieg damit in eine lange Kontinuitätslinie der Geschichte, die mit der Verteidigung des Römischen Reichs gegen die germanischen Völkerschaften ihren Anfang genommen habe. 1914 war für ihn keine Zäsur, sondern ein weiteres Kapitel im endlosen Kampf um die Selbstbehauptung der lateinischen Zivilisation gegen die aus dem Osten, den Steppen Asiens oder den Wäldern Germaniens, andringenden Horden der Barbaren. Man kann Thomas Manns vieldiskutierte Kontrastierung der «Tiefe» deutscher Kultur mit der «Oberflächlichkeit» französischer Zivilisation nicht verstehen, wenn man sie nicht als Reaktion auf Bergsons Deutung des Krieges im Sinne einer Verteidigung der Zivilisation gegen die Barbarei begreift. Bergson hatte eine Sinnstiftung vorgegeben: die Verteidigung der lateinischen Zivilisation gegen die periodisch aus dem Nordosten andrängenden Barbaren; Thomas Mann setzte eine konträre Sinnstiftung dagegen: die Verteidigung der deutschen Kultur gegen die französische Zivilisation. Der Krieg der Waffen wurde von Anfang an begleitet von einem Krieg der Worte.
Die Briten bezeichneten die Deutschen, ganz ähnlich wie Bergson, als «Hunnen», die man abwehren und zurückwerfen müsse. Zu dieser Benennung hatte freilich Kaiser Wilhelm II. das Seine beigetragen, als er im Jahre 1900 bei der Verabschiedung der zur Niederschlagung des chinesischen Boxeraufstands entsandten Marineinfanterie in Bremerhaven erklärte, die deutschen Soldaten sollten sich in China Respekt verschaffen wie weiland die Hunnen unter ihrem König Etzel.[16] Es war das unbedachte Gerede des Kaisers, das die Deutschen in der britischen Wahrnehmung zu Hunnen gemacht hatte. Zu dieser «Hunnifizierung» der Deutschen gehörte im Übrigen, dass es einem römisch geführten Abwehrbündnis Mitte des 5. Jahrhunderts auf den Katalaunischen Feldern gelungen war, den hunnischen Vorstoß zu stoppen und zurückzuschlagen. Auch das eine Kontinuitätslinie, die als sinnstiftend herausgestellt wurde.
Man kann die Zuschreibung des Barbarischen auf den...
| Erscheint lt. Verlag | 25.9.2015 |
|---|---|
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Atomwaffen • Bürgertum • Clausewitz • Cyberkrieg • Erster Weltkrieg • Europa • Geopolitik • gescheiterter Staat • Geschichte • Helden • Kalter Krieg • Kriegstechnik • Naher Osten • Russland • USA • Zeitgeschichte • Zweiter Weltkrieg |
| ISBN-10 | 3-644-12111-7 / 3644121117 |
| ISBN-13 | 978-3-644-12111-9 / 9783644121119 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,1 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich