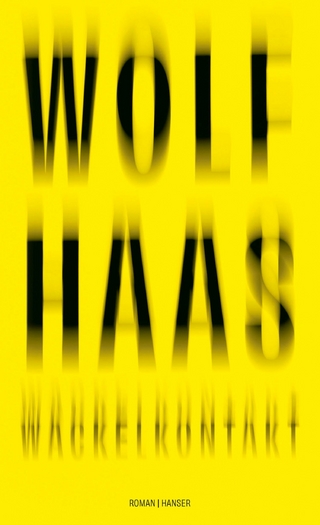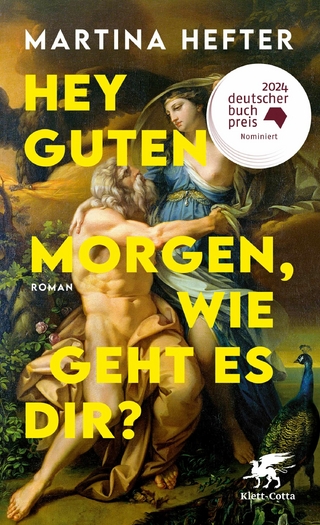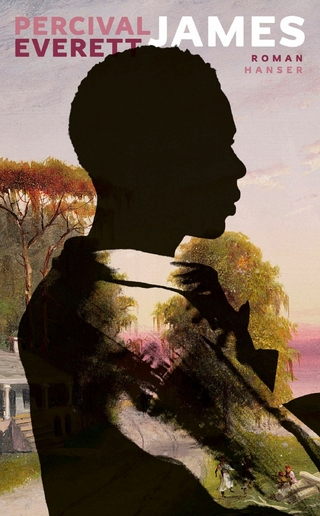Die Mutter meiner Mutter (eBook)
246 Seiten
Luchterhand (Verlag)
978-3-641-16871-1 (ISBN)
Als der Krieg zu Ende war, fing für die vierzehnjährige Anna der Kampf erst an. Ihre Mutter war lange tot, ihr Vater von den Russen verhaftet worden, ihre Heimat verloren. Als Flüchtling machte sie sich mit ihren kleinen Brüdern allein auf den Weg nach Westen und fand in Kosakenberg, einem Dorf in der sowjetischen Besatzungszone, Unterschlupf. Am Hof der Familie Wendler kann sie als Magd härteste körperliche Arbeit leisten. 1949 kehrt Friedrich Stein aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft nach Kosakenberg zurück. Das Deutschland, das er verlassen hat, gibt es nicht mehr: seine Familie ist tot, sein Anwesen von Flüchtlingen besetzt, das Dorf voller Sowjet-Propaganda. Ein gebrochener Mann, zwanzig Jahre älter als Anna. Anna macht die Traurigkeit in seinen Augen vom ersten Tag an Angst.
Eines Abends überfällt Friedrich Stein Anna auf dem Dachboden des Hauses. Neun Monate später bekommt sie ein Kind. Für Anna scheint die Welt zu enden. Sie versteinert. Und schweigt. Die Kosakenberger zwingen Friedrich, Anna zu heiraten. Anna, damals 18, hat keine Wahl. Zwar weiß das ganze Dorf von dem Verbrechen, mit dem die Ehe begann, die Töchter und Enkel aber sollen nie davon erfahren. Auch nach Friedrich Steins Tod und dem Ende der DDR hält Anna ihr Schweigen aufrecht. Warum? Und was macht die Wahrheit mit den Töchtern und Enkelinnen der Steins, als sie sie zwanzig Jahre nach dem Tod des Großvaters völlig unerwartet erfahren?
Sabine Rennefanz erzählt Anna Steins bewegende Geschichte aus der Perspektive der Enkelgeneration. Brutalität und Gewalt gab es nach dem Krieg in vielen Familien, sie wirkt in den Kindern und Enkeln immer noch nach. Und wie in Annas Fall wurde fast immer weggesehen und geschwiegen.
Sabine Rennefanz, 1974 in Beeskow geboren, arbeitet als Redakteurin für die 'Berliner Zeitung' und wurde für ihre Arbeit u.a. mit dem Theodor-Wolff-Preis und dem Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet. Ihr erstes Buch, 'Eisenkinder', stand mehrere Wochen auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.
1
Ich habe etwas über deinen Großvater herausgefunden, flüstert meine Mutter. Ihre Stimme klingt anders als sonst, heiser, als habe sie geweint oder vielleicht eine Erkältung. Vielleicht liegt es auch an der Leitung. Meine Mutter klingt weit weg.
Sie wohnt in einem abgelegenen Dorf. Kosakenberg heißt das Dorf, obwohl es weder einen Berg noch Kosaken dort gab, nur eine kleine Erhebung. Meine Mutter wohnt in Kosakenberg, ich wohne in der Stadt. Die Stadt hat einen Namen, aber für meine Mutter und die anderen dreihundert Kosakenberger ist es nur die Stadt. Als könne es nur diese eine geben, und das ist nicht als Kompliment gemeint. Die Stadt ist groß, schmutzig und verdirbt die Kinder.
Die Kosakenberger sind überzeugt davon, dass die Städter auf sie herabschauen, ihre Traditionen, ihre Sprache und Essgewohnheiten belächeln; deshalb können die Kosakenberger besonders abweisend zu den Städtern sein. Da kommt die Städterin, pflegt meine Mutter in spöttischem Ton zu sagen, wenn ich sie besuche.
Ich habe etwas über deinen Großvater herausgefunden, sagt sie am Telefon.
Mein Großvater.
Ich könnte viel von meinem Großvater erzählen. Als Kind habe ich ihn verehrt und bewundert. Ich war überzeugt davon, dass er kommen würde, um mich zu retten, sollte mir etwas Schlimmes zustoßen.
Mein Großvater war mittelgroß, hatte ein ovales, glattes Gesicht, eine kräftige Nase, breite Schultern, starke Arme und einen kleinen Bauch über dem Hosenbund. In dem Land meiner Kindheit standen überall Skulpturen aus Bronze herum, die kräftige, stolze Arbeiter zeigten, mit geballter Faust und stolzem Blick. Mein Großvater hätte für eine dieser Skulpturen Modell stehen können. Er gehörte zur Genossenschaft »Felsenfest«, Zweig Pflanzenproduktion. Er arbeitete mit seiner Brigade viel draußen, so dass sein Gesicht und Nacken schon im Frühsommer braungebrannt waren. Wenn er lachte, legte sich die Haut um seine Augen in viele kleine Fältchen, die ich sehen konnte, wenn er mich hochhob. Zur Erntezeit, wenn er auch an heißen Tagen zwölf, vierzehn Stunden am Tag arbeitete, sammelte sich in den Lachfältchen der Staub vom Feld.
Zu Hause trug er eine Schiebermütze, eine dunkle, abgewetzte Joppe, und seine Hände waren von der Plackerei mit Schwielen bedeckt. Ich hielt das für ein Zeichen dafür, wie stark er sein musste.
Die meisten Männer damals achteten nicht auf ihr Äußeres, und sie waren stolz darauf. Den Körper zu pflegen, auf sich zu achten, sich gut anzuziehen, das hatte etwas Ungehöriges, Schwaches, Weibisches. Wenn mein Großvater in die Stadt zum Einkaufen fuhr, machte er sich fein, mit Anzug, Krawatte und einer Weste über dem weißen Hemd. An der linken Hand trug er dann einen goldenen Ring mit einem tiefroten Stein. Der Ring war protzig, fast vulgär, kein anderer Mann im Dorf hätte so etwas getragen, aus Angst, sich lächerlich zu machen. Mein Großvater liebte seinen Ring.
Ich erinnere mich nicht genau an ihn, nur an Details, Fragmente. Sein linkes Augenlid hing ein wenig schief, was seinem Gesicht einen leicht melancholischen Ausdruck gab. Er ließ mich auf seinem Schoß reiten und pfiff dazu auf vier Fingern ein Lied. Ich habe nie gelernt, auf vier Fingern zu pfeifen. Ich erinnere mich an den Geruch seiner Hemden, er trug karierte Flanellhemden, wie man sie heute an jungen Männern aus New York wieder sieht. Sie rochen würzig, nach Holz und Nelken.
Kaum dass ich laufen konnte, nahm er mich mit zu den Pferden, die der Genossenschaft gehörten. Im Stall zeigte er mir, wie man Pferde anfasst, wie man sie füttert, wie man ihr Fell mit einer Bürste striegelt. Als ich in die Schule kam, setzte er mich auf den Rücken einer gutmütigen Stute namens Grete, und wir ritten gemeinsam zur Schule. Ich war das einzige Kind, das auf dem Pferd zur Schule kam.
Unser Haus stand am Ende einer langen Straße, in dem Teil des Dorfes, für den die Laternen nicht mehr gereicht hatten. Hinter dem Haus verwandelte sich die Straße in einen sandigen Feldweg, er führte durch ein kleines Waldstück zum Fluss, der an dieser Stelle besonders schmal war und im Sommer oft austrocknete. Es gab eine schmale Holzbrücke über den Fluss, die für Autos gesperrt war. Weil der kürzeste Weg in die Kreisstadt über die kleine Holzbrücke führte, fuhren trotzdem alle darüber. Reparaturen dauerten damals ewig, weil man auf Ersatzteile lange warten musste, aber die Planken für die kleine Holzbrücke wurden immer schnell ersetzt. Im Frühling und im Herbst blieben die Autos oft auf dem Feldweg im Schlamm stecken, dann musste jemand mit dem Traktor kommen und sie herausziehen.
Wenn man von dem Ende der Straße, an dem unser Haus stand, zum anderen Ende des Dorfes lief, kam man am Gasthaus, am Friseursalon und an der Kirche mit dem quadratischen Dachturm vorbei. In der Mitte des Dorfes stand ein mit Efeu umranktes Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, es war so schmutzig, dass man die eingravierten Namen nur schwer lesen konnte. Niemand machte es sauber. Es sollte abgerissen werden, weil es an eine böse Zeit erinnerte, an die niemand erinnert werden wollte, aber es wurde nie abgerissen.
Das Lauteste im Dorf waren die Kolonnen sowjetischer Lastwagen, die jeden Tag in einer Schnelle vorbeidonnerten, als müssten sie gefährliches Material abgeben. Russenkolonnen nannten wir sie. Oft sah man auf der Pritsche die Soldaten nebeneinanderhocken, blutjung, mit kahlen weißen Köpfen. Wenn man zu nah an der Straße stehen blieb, hing der Gestank der Autoabgase noch Stunden später in den Kleidern.
Am Ende des Dorfes gabelte sich die Straße irgendwann, die rechte Abzweigung führte zum Bahnhof, die linke führte über die Felder auf eine Straße, die abrupt an einem Schild und einem Stacheldraht endete. Achtung, verboten! Wnimanije, saproschjonnij! Hinter der Absperrung, mitten im Wald, geschützt vor den Blicken der Dorfbewohner, lag eine sowjetische Kaserne. In gewisser Weise gab es in Kosakenberg also doch Kosaken.
Wenn die Erwachsenen über die Kaserne redeten, sprachen sie von der »Muna«, das klang wie eine geheime Abkürzung. Erst später erfuhr ich, dass die »Muna«, die Abkürzung für Munitionslager, viel älter war als die sowjetische Kaserne. Im Zweiten Weltkrieg kamen die Waffen für die Ostfront von der »Muna«. Nur wenige Menschen hatten die »Muna« jemals von innen gesehen. Es gab das Gerücht, dass dort Atomwaffen gelagert wurden. Der Dritte Weltkrieg hätte also in Kosakenberg beginnen können. Das wurde aber erst nach dem Ende des Kalten Krieges erzählt und war wahrscheinlich erfunden.
Die Rote Armee hatte in der »Muna« für mehrere hundert Soldaten ihre eigene Stadt errichtet, die größer war als Kosakenberg selbst, mit Geschäften, einem Krankenhaus, einer Schule, einem Friseur und einem eigenen Zugang zur Autobahn. Kontakt zu den Einheimischen war den Soldaten verboten, trotzdem kamen sie jedes Wochenende, um sich in der Kneipe zu betrinken. Manchmal trank mein Großvater mit ihnen und probierte die russischen Redewendungen aus, die aus der Kriegsgefangenschaft hängengeblieben waren. Er war 1949 zurückgekommen, als der neue Staat gegründet wurde, der keinen Namen hatte, nur drei Buchstaben. Sein zweites Leben, nannte er es.
Es gibt ein Porträt von ihm, das ihn als Soldaten zeigt. Er steht vor einer weißen Wand, er blickt direkt in die Kamera. Mich haben am meisten die Augen erschreckt, wie hart sie sind, wie dunkel und undurchschaubar.
Mein Großvater hatte grüne Augen, aber auf diesem Schwarz-Weiß-Foto sehen sie schwarz aus. Es ist nicht klar, wann das Foto aufgenommen wurde, wahrscheinlich im Wehrkreisbüro im Dezember 1941. Er hat noch dieselbe Frisur wie als Zehnjähriger, nur weniger Haare. Die Unterlippe wirkt etwas breiter als die Oberlippe, sein Mund ist geschlossen. Er trägt eine schlichte graue Feldbluse, auf der rechten Brust prangt ein Hakenkreuz.
In meiner Erinnerung hat mein Großvater viel über den Krieg und seine Gefangenschaft geredet, doch wenn ich genauer darüber nachdenke, waren es die gleichen Themen, die gleichen Wendungen, die er immer wiederholte. Am eindrücklichsten sind mir die Namen der Orte in Erinnerung, von denen er sprach: Omsk, Tomsk, Irkutsk, Nowosibirsk, Tschita. Ich mochte den Klang der Namen, sie hörten sich an wie Musik, sie hallten länger in meinem Kopf nach als die Geschichten. Es waren Namen, die sich exotisch anhörten, die in einem zehnjährigen Mädchen, das in einem kleinen halben Land festsaß, das Fernweh wecken konnten.
Über die Sowjets redete er nie schlecht. Er lobte die sowjetischen Ärzte und Schwestern, die ihm im Lazarett das Leben gerettet hätten. Er erzählte von eisigen Nächten. Im Dunkeln kamen die Wölfe und schauten durch die Fenster in die Baracke, in der mein verwundeter Großvater auf einer Pritsche lag. In seinen Geschichten kamen die Sowjetmenschen als verschrobene, aber liebenswerte Figuren vor, die den ganzen Tag Wodka tranken, abends in ihren Hütten auf den Öfen tanzten und ihr letztes Brot mit den Deutschen teilten. Es klang, als sei die Gefangenschaft die beste Zeit seines Lebens gewesen.
Ich erinnere mich, dass ich seinen Geschichten gern zugehört habe, dass sie mich an die russischen Märchen erinnerten, die im Fernsehen liefen.
Ich habe etwas über deinen Großvater herausgefunden.
Ich sitze auf dem Sofa in meinem Wohnzimmer und höre die entfernte Stimme meiner Mutter. Wie immer hatte sie zu Beginn des Telefonats erschrocken gefragt: Hab ich dich etwa geweckt?
Ich arbeite von zu Hause aus, was für meine Mutter ein feineres Wort für Arbeitslosigkeit ist. Unsere Gespräche...
| Erscheint lt. Verlag | 14.9.2015 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | Biografie • Biographien • DDR • eBooks • Familiengeheimnis • Familiensaga • Frauenrolle • Mutter-Tochter-Beziehung • Nachkriegszeit • Vergewaltigung |
| ISBN-10 | 3-641-16871-6 / 3641168716 |
| ISBN-13 | 978-3-641-16871-1 / 9783641168711 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,6 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich