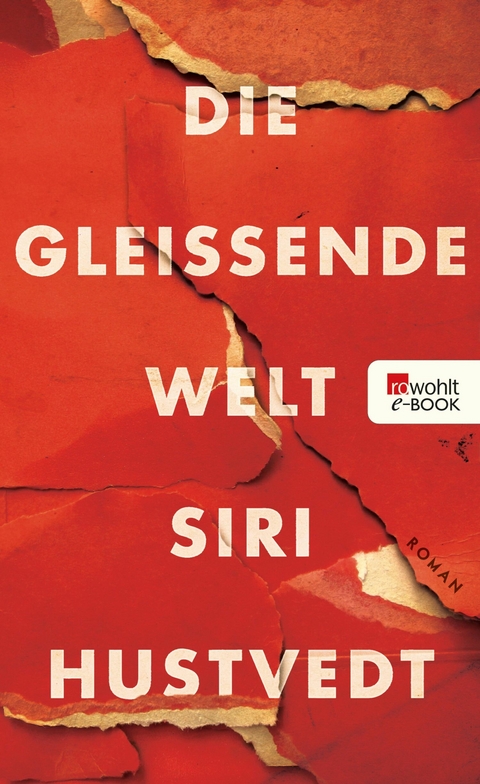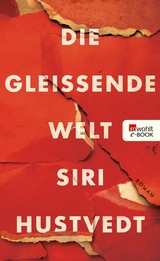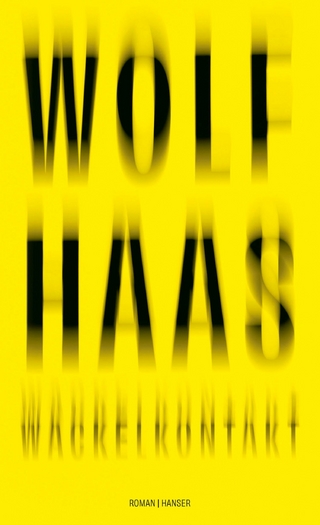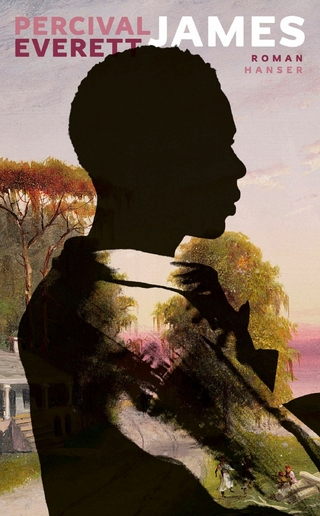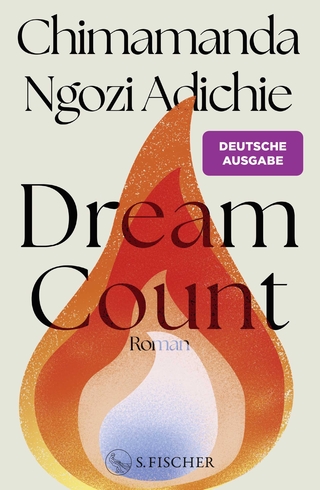Die gleißende Welt (eBook)
496 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-644-51901-5 (ISBN)
Siri Hustvedt wurde 1955 in Northfield, Minnesota, geboren. Sie studierte Literatur an der Columbia University und promovierte mit einer Arbeit über Charles Dickens. Bislang hat sie sieben Romane publiziert. Mit «Was ich liebte» hatte sie ihren internationalen Durchbruch. Zuletzt erschienen «Die gleißende Welt» und «Damals». Zugleich ist sie eine profilierte Essayistin. Bei Rowohlt liegen von ihr die Essaybände «Nicht hier, nicht dort», «Leben, Denken, Schauen», «Being a Man», «Die Illusion der Gewissheit» und «Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen» vor.
Siri Hustvedt wurde 1955 in Northfield, Minnesota, geboren. Sie studierte Literatur an der Columbia University und promovierte mit einer Arbeit über Charles Dickens. Bislang hat sie sieben Romane publiziert. Mit «Was ich liebte» hatte sie ihren internationalen Durchbruch. Zuletzt erschienen «Die gleißende Welt» und «Damals». Zugleich ist sie eine profilierte Essayistin. Bei Rowohlt liegen von ihr die Essaybände «Nicht hier, nicht dort», «Leben, Denken, Schauen», «Being a Man», «Die Illusion der Gewissheit» und «Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen» vor. Uli Aumüller übersetzt u. a. Siri Hustvedt, Jeffrey Eugenides, Jean Paul Sartre, Albert Camus und Milan Kundera. Für ihre Übersetzungen erhielt sie den Paul-Celan-Preis und den Jane-Scatcherd-Preis.
Einführung
«Alle intellektuellen und künstlerischen Unterfangen, sogar Witze, ironische Bemerkungen und Parodien, schneiden in der Meinung der Menge besser ab, wenn die Menge weiß, dass sie hinter dem großen Werk oder dem großen Schwindel einen Schwanz und ein Paar Eier ausmachen kann.» Auf diesen provozierenden Satz stieß ich 2003 in einem Leserbrief an den Herausgeber von The Open Eye, einer interdisziplinären Zeitschrift, die ich seit einigen Jahren regelmäßig las. Der Satz stammte nicht vom Verfasser des Briefes, Richard Brickman. Er zitierte eine Künstlerin, deren Namen ich noch nie irgendwo gedruckt gesehen hatte: Harriet Burden. Brickman behauptete, Burden habe ihm einen langen Brief über ein Projekt geschrieben, den er veröffentlichen sollte. Obwohl Burden in den siebziger und achtziger Jahren in New York ausgestellt hatte, war sie von der Rezeption enttäuscht gewesen und hatte sich ganz aus der Kunstwelt zurückgezogen. Irgendwann in den späten neunziger Jahren begann sie ein Experiment, für dessen Beendigung sie fünf Jahre brauchte. Brinkman zufolge beauftragte sie drei Männer, als Strohmann für ihre eigene schöpferische Arbeit aufzutreten. Drei Einzelausstellungen in verschiedenen New Yorker Galerien, die Anton Tish (1999), Phineas Q. Eldridge (2002) und dem nur als Rune bekannten Künstler (2003) zugeschrieben wurden, waren eigentlich von Burden. Sie gab dem Gesamtprojekt den Titel Maskierungen und erklärte, es solle nicht nur die frauenfeindliche Tendenz der Kunstwelt entlarven, sondern das komplexe Funktionieren der menschlichen Wahrnehmung sichtbar machen und zeigen, wie unbewusste Vorstellungen von Gender, Rasse und Berühmtheit Einfluss auf das Verständnis derer haben, die ein bestimmtes Kunstwerk betrachten.
Aber Brickman ging noch weiter. Er behauptete, Burden habe darauf bestanden, das von ihr angenommene Pseudonym verändere den Charakter ihrer Kunst. Anders gesagt, der Mann, den sie als Maske benutzte, spiele eine Rolle in der Art von Kunst, die sie schuf: «Jede Künstlermaske wurde für Burden zu einer ‹poetisierten Persönlichkeit›, einer visuellen Ausgestaltung eines ‹hermaphroditischen Selbst›, von dem man nicht sagen konnte, dass es zu ihr oder der Maske gehörte, sondern zu ‹einer zwischen ihnen entstandenen gemischten Realität›.» Schon aufgrund meiner Professur für Ästhetik war ich sofort fasziniert von dem Projekt, wegen seiner Ambition, aber auch wegen seiner philosophischen Komplexität und Differenziertheit.
Gleichzeitig fand ich Brickmans Brief verwirrend. Warum hatte Burden ihre Erklärung nicht selbst veröffentlicht? Warum sollte sie es Brickman überlassen, für sie zu sprechen? Brickman behauptete, der «Botschaft aus dem Reich des fiktionalen Seins» genannte sechzigseitige Brief sei unangemeldet in seinem Briefkasten eingegangen, und er habe vorher nichts von der Künstlerin gewusst. Auch der Ton von Brickmans Brief ist seltsam: Er wechselt zwischen Herablassung und Bewunderung. Brickman kritisiert Burdens Brief als übertreibend und für eine Veröffentlichung in einer wissenschaftlichen Zeitschrift ungeeignet, doch andererseits zitiert er weitere Passagen, die er ihr zuschreibt, sichtlich mit Beifall. Ich behielt einen verworrenen Eindruck von dem Brief und eine gewisse Verärgerung über Brickman zurück, dessen Kommentar Burdens Originaltext im Grunde unterdrückt. Gleich machte ich mich über die drei Ausstellungen kundig, Die Geschichte der Kunst des Westens von Tish, Die Erstickungsräume von Eldridge und Darunter von Rune, die sich jeweils stark voneinander unterschieden. Dennoch machte ich zwischen den dreien etwas ausfindig, was ich als «Familienähnlichkeit» bezeichnen würde. Die Ausstellungen von Tish, Eldridge und Rune, die Burden sich angeblich ausgedacht hatte, waren als Kunst allesamt bezwingend, aber besonders fasziniert war ich von Burdens Experiment, weil es meine eigenen intellektuellen Interessen berührte.
In jenem Jahr beanspruchten mich meine Lehrverpflichtungen stark. Mit der zeitweiligen Leitung des Instituts waren viele Aufgaben verbunden, und so konnte ich meiner Neugier über die Maskierungen erst drei Jahre später nachgehen, als ich ein Forschungssemester nahm, um an meinem Buch Plurale Stimmen und multiple Visionen zu arbeiten, worin ich das Werk Sören Kierkegaards, Michail Michailowitsch Bachtins und des Kunsthistorikers Aby Warburg diskutiere. Brickmans Beschreibung von Burdens Projekt und ihren poetisierten Persönlichkeiten (der Ausdruck stammt von Kierkegaard) passte perfekt zu meinen eigenen Gedanken, daher beschloss ich, Brickman über The Open Eye ausfindig zu machen und mir anzuhören, was er selbst zu sagen hatte.
Peter Wentworth, der Herausgeber der Zeitschrift, rief E-Mails von Brickman an ihn auf – einige trockene, geschäftsmäßige Mitteilungen. Als ich jedoch versuchte, Kontakt mit Brickman aufzunehmen, stellte ich fest, dass die Adresse nicht mehr bestand. Wentworth holte einen Essay hervor, den Brickman zwei Jahre vor seinem Brief an The Open Eye in der Zeitschrift veröffentlicht hatte und den ich, wie ich mich nachträglich erinnerte, gelesen hatte: ein abstruser Beitrag, der die anhaltenden Auseinandersetzungen in der Analytischen Philosophie über Konzepte kritisierte, ein Thema, das meinen eigenen Interessen fernstand. Wentworth zufolge hatte Brickman an der Emory University in Philosophie promoviert und war Dozent am St. Olaf College in Northfield, Minnesota. Als ich jedoch bei St. Olaf nachfragte, stellte sich heraus, dass niemand namens Richard Brickman an diesem Fachbereich lehrte oder je gelehrt hatte. Natürlich gab es auch an der Emory University keine Unterlagen zu einem Doktoranden dieses Namens. Ich beschloss, mich direkt an Harriet Burden zu wenden, aber bis ich sie über ihre Tochter Maisie Lord in New York ausfindig gemacht hatte, war sie schon zwei Jahre tot.
Die Idee zu dieser Anthologie entstand während meines ersten Telefongesprächs mit Maisie Lord. Obwohl sie von Brickmans Brief wusste, war sie überrascht, als sie erfuhr, dass dessen Verfasser nicht der Mensch war, der er zu sein vorgab, wenn überhaupt eine reale Person. Sie vermutete, ihre Mutter habe Kontakt mit ihm gehabt, wusste aber nichts Genaues über ihre Beziehung. Harriet Burdens Kunstwerke waren zu der Zeit, als ich mit Maisie sprach, alle katalogisiert und eingelagert, und sie arbeitete seit Jahren an einem Dokumentarfilm über ihre Mutter. In dem Film kommen unter anderem im Off gesprochene Auszüge aus den vierundzwanzig persönlichen Tagebüchern vor – jedes mit einem Buchstaben des Alphabets benannt –, die ihre Mutter nach dem Tod ihres Mannes Felix Lord 1995 zu führen begonnen hatte. Soweit Maisie wusste, wurde Richard Brickman in keinem dieser Tagebücher erwähnt. (Ich selbst fand zwei Erwähnungen von R.B., vermutlich Richard Brickman, aber nichts Aufschlussreicheres.) Maisie war allerdings sicher, dass ihre Mutter in den Tagebüchern allerlei «Schlüssel» hinterlassen hatte, nicht nur zu ihrem pseudonymen Projekt, sondern auch zu dem, was sie «die Geheimnisse der Persönlichkeit meiner Mutter» nannte.
Zwei Wochen nach unserem Telefonat flog ich nach New York, wo ich Maisie, ihren Bruder Ethan Lord und Burdens Lebensgefährten Bruno Kleinfeld traf, die alle sehr ausführlich mit mir sprachen. Ich sichtete Hunderte von Arbeiten, die Burden nie irgendwo gezeigt hatte, und ihre Kinder teilten mir mit, dass ihr Werk gerade von der renommierten Grace Gallery in New York übernommen worden war. Die 2008 organisierte Burden-Retrospektive sollte die Beachtung und Anerkennung finden, nach denen sich die Künstlerin so verzweifelt gesehnt hatte, und lancierte im Grunde posthum ihre Karriere. Maisie zeigte mir Muster ihres unvollendeten Films und, was noch wichtiger war, machte mir die Notizbücher zugänglich.
Während ich die Hunderte von Seiten las, die Burden geschrieben hatte, war ich abwechselnd fasziniert, aufgebracht und frustriert. Sie hatte viele Tagebücher gleichzeitig geführt. Manche Einträge datierte sie, andere wieder nicht. Sie hatte ein System, die Notizbücher mit Querverweisen zu versehen, das mal einfach war und mal in seiner Komplexität hochgradig schwierig oder unsinnig erschien. Schließlich gab ich auf, es zu entschlüsseln. Ihre Schrift wird auf manchen Seiten unlesbar klein, auf anderen wiederum so groß, dass einige wenige Sätze eine ganze Seite einnehmen. Manche ihrer Texte werden durch Zeichnungen verundeutlicht, die ins Geschriebene hineinragen. Einige Notizbücher waren randvoll, andere enthielten nur ein paar Absätze. Notizbuch A und Notizbuch U waren größtenteils, aber nicht gänzlich autobiographisch. Sie fertigte ausführliche Aufzeichnungen über Künstler an, die sie liebte, manche über viele Seiten eines Notizbuchs. Vermeer und Velazquez zum Beispiel teilen sich V. Louise Bourgeois hat ihr eigenes Notizbuch unter L, nicht B, aber L enthält auch Exkurse über Kindheit und Psychoanalyse. William Wechsler, Notizbuch W, enthält Notizen zu Wechslers Werk, aber auch ellenlange Nebenbemerkungen über Lawrence Sternes Tristram Shandy und Eliza Haywoods Fantomina sowie einen Kommentar zu Horaz.
Viele Tagebücher sind im Wesentlichen Notizen zu ihrer Lektüre, die umfangreich war und viele Bereiche umfasste: Literatur, Philosophie, Linguistik, Geschichte, Psychologie und Neurowissenschaften. Aus unbekannten Gründen teilten John Milton und Emily Dickinson sich ein Notizbuch mit dem Etikett G. Kierkegaard ist in K, aber Burden schreibt darin auch über Kafka sowie einige Passagen über...
| Erscheint lt. Verlag | 24.4.2015 |
|---|---|
| Übersetzer | Uli Aumüller |
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | Bildende Kunst • Brooklyn • Feminismus • Frauen • Malerei • New York • Psychoanalyse • Psychologie • Red Hook • Rollenspiel • USA |
| ISBN-10 | 3-644-51901-3 / 3644519013 |
| ISBN-13 | 978-3-644-51901-5 / 9783644519015 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,1 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich