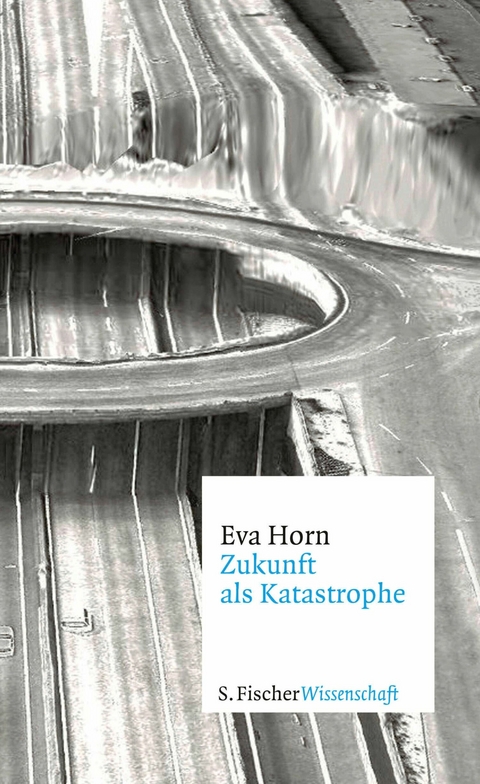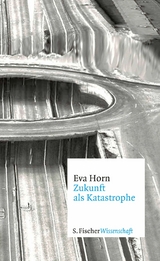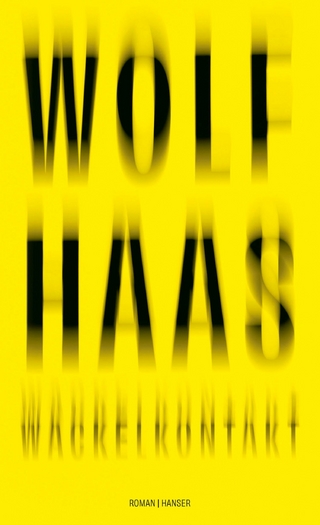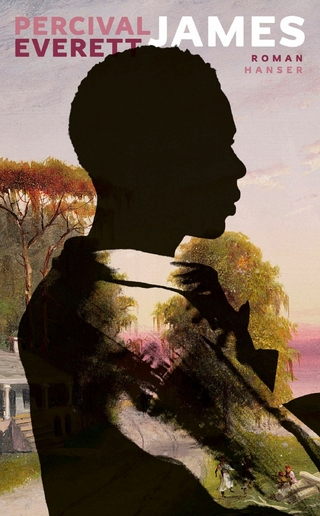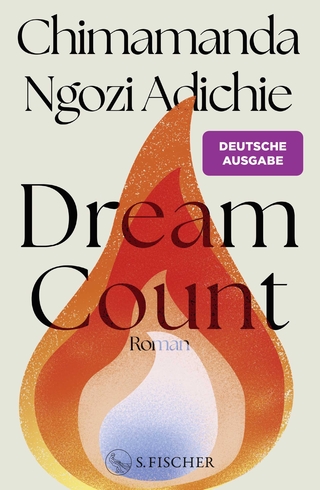Zukunft als Katastrophe (eBook)
480 Seiten
S. Fischer Verlag GmbH
978-3-10-401376-3 (ISBN)
Eva Horn ist Professorin für Literaturwissenschaft und Kulturgeschichte am Institut für Germanistik der Universität Wien. Seit Jahren beschäftigt sie sich mit Fragen einer Kultur- und Literaturgeschichte der Natur und mit dem Konzept des Anthropozäns. Sie ist Gründerin und Leiterin des Vienna Anthropocene Network und hat in den USA, Deutschland, der Schweiz und Österreich unterrichtet. Für ihre Bücher und Essays hat sie 2020 den Heinrich-Mann-Preis erhalten. Bei S. FISCHER ist zuletzt erschienen »Zukunft als Katastrophe« (2014).
Eva Horn ist Professorin für Literaturwissenschaft und Kulturgeschichte am Institut für Germanistik der Universität Wien. Seit Jahren beschäftigt sie sich mit Fragen einer Kultur- und Literaturgeschichte der Natur und mit dem Konzept des Anthropozäns. Sie ist Gründerin und Leiterin des Vienna Anthropocene Network und hat in den USA, Deutschland, der Schweiz und Österreich unterrichtet. Für ihre Bücher und Essays hat sie 2020 den Heinrich-Mann-Preis erhalten. Bei S. FISCHER ist zuletzt erschienen »Zukunft als Katastrophe« (2014).
virtuose Durcharbeitung der apokalyptischen Motivgeschichte der Moderne
›Zukunft als Katastrophe‹ ist eine weit ausholende und gelehrte, zugleich methodisch tiefschürfende Untersuchung der heutigen Apokalypsendarstellungen.
Eva Horns Studie besticht durch die Souveränität, mit der die Autorin die ungeheure Fülle an Material, die sie da zusammengetragen hat, ordnet und interpretiert.
Fans gepflegter Desaster-Unterhaltung sei die Lektüre von ›Zukunft als Katastrophe‹ ans Herz gelegt. […] ein leidenschaftliches Plädoyer dafür, moderne Untergangs-Fiktion ernst zu nehmen.
über weite Strecken […] eine packende Geschichte über den Zustand unserer Gesellschaft
Eva Horns brillantes Buch lehrt uns, einfachen politischen Antworten zu misstrauen, und umgekehrt scheinbar simple fiktionale Werke politisch zu lesen
Horn navigiert leichthändig durch die Unheilsfluten ohne an Tiefgang zu verlieren.
Die Katastrophe als Offenbarung
Angesichts der Kakophonie von wissenschaftlichen, politischen und fiktionalen Katastrophenentwürfen stellt sich die Frage nach ihren unausgesprochenen Spieleinsätzen und ihrer Funktion. Warum träumen wir uns als letzte Menschen? Welche unausgesprochenen Konflikte, welche uneingestehbaren Wünsche, welche diffusen Ängste werden in ihnen bearbeitet oder auch befriedigt? Wie verhalten sich die Imaginationen künftiger Desaster und möglicher Weltuntergänge, denen wir uns in unserer Freizeit hingeben, zu der merkwürdigen Handlungs- und Wahrnehmungshemmung, die die Teilnehmer von ergebnislosen Klimagipfeln, Ökonomen, Politiker und normale Bürger gleichermaßen lähmt? Warum das aktuelle »Vergnügen an tragischen Gegenständen«? Wie stehen die imaginierten Desaster neben den öffentlichen und privaten Praktiken der Vorsorge, der Absicherung und Prävention? Im sonnenbeschienenen Gras am Times Square, den ums Überleben kämpfenden Protagonisten in The Road, in Roland Emmerichs erhabenen Bildern von Hurricanes und Erdbeben, aber auch in Weismans Visionen einer Erde ohne Menschen erscheint nicht nur die Angst vor einer Zukunft, in der nichts mehr so sein wird, wie wir es kennen. Was in ihnen sichtbar wird, ist auch ein uneingestehbares »Begehren nach der Katastrophe«.[28] Fiktionale und imaginierte Desaster scheinen etwas zu bebildern, das wir für möglich und vielleicht sogar für unmittelbar bevorstehend halten, aber zugleich auch nicht vorstellen, nicht greifen können. Etwas, das die Kompliziertheiten unserer Welt klären, die Dinge durchschaubar machen, auf das Wesentliche hin durchschlagen würde. Das »Vergnügen an tragischen Gegenständen« (Schiller) hat so eine unheimliche Unterseite, die entziffert werden muss. Ihr ist weder mit dem lässigen Vorwurf des unnötigen »Alarmismus« noch mit einem mahnenden »es ist tatsächlich fünf vor zwölf« beizukommen. Die Frage ist vielmehr: Warum schauen Leute fünf vor zwölf so gerne Katastrophenfilme? Warum geht ein intensiv und öffentlich vorgetragenes Krisenbewusstsein mit einer bemerkenswerten politischen und individuellen Handlungslähmung einher? Warum lesen wir mit Interesse und Schauder Bücher über den Untergang der Menschheit, während wir politisch zugleich einigermaßen passiv bleiben, also weder auf die Straße gehen, noch unsere Autos abschaffen oder einen privaten Überlebensbunker mit Lebensmitteln bestücken? Oder wenigstens die Hausratsversicherung erhöhen. Wir sind einerseits, wie Kathrin Röggla bemerkt hat, ständig »alarmbereit«, andererseits aber auch untätig und unschlüssig, geschlagen von einem »betriebsalzheimer«, der die Gefahren und Desaster, die uns ständig vor Augen gestellt werden, sogleich wieder vergessen lässt.[29]
Diesem Buch geht es darum, die seltsam zwiespältige, aber um so intensivere Beschäftigung mit kommenden Katastrophen als Symptom eines modernen Verhältnisses zur Zukunft zu entziffern. Dabei geht es weniger um die sozialpsychologische Verfasstheit dieses Verhältnisses, dessen Erwartungshorizonte, Wünsche und Ängste, Risikowahrnehmung, kognitive Dissonanzen oder Mechanismen der self-fulfilling oder self-defeating prophecies zu analysieren wären.[30] Es geht vielmehr um Imaginationsformen der Katastrophe, einen Raum der fiktiven Bilder, Narrative, Szenarien und Phantasien, die in besonders prägnanter Weise nicht nur Ausdruck dieses Zukunftsverhältnisses sind, sondern es bestimmen und formatieren. Sie sind damit Teil einer Dimension des Sozialen, die als das kollektive Imaginäre gefasst worden ist. Bilder, Mythen, Geschichten, Symbole usw. sind nicht einfach kultureller Überbau, sondern prägen, so Charles Taylor, die Art und Weise, »wie sich Menschen ihre soziale Existenz vorstellen, wie sie ihr Zusammensein mit anderen regeln, […] was normalerweise erwartet werden kann und welche tiefer liegenden normativen Begriffe und Bilder diesen Erwartungen zu Grunde liegen«.[31] Geteilte Vorstellungen, Zuschreibungen, Narrative, Bilder, Metaphern sind Modi, in der moderne Gesellschaften sich nicht nur über sich selbst, ihre unterliegenden Codes und moralischen Normen verständigen, sondern, grundsätzlicher noch, das fassen, was sie als »Wirklichkeit« anerkennen: ein fundamentales Element, das die Spezifik eines historischen Lebens- und Existenzstils ebenso prägt wie das System der Bedeutungen, das Sagbare und Unsagbare, das Verhältnis zwischen unterschiedlichen Teilsystemen der Gesellschaft. Das soziale Imaginäre ist das Fundament, der Ursprung all dessen, dem individuell oder kollektiv »Wert« zugesprochen wird, so Cornelius Castoriadis.[32]
Die Zukunft und das kollektive und individuelle Verhältnis zu ihr sind Teil dieses kollektiven Imaginären. Ein Wissen von der Zukunft, ebenso wie eine Verständigung über sie, ist nicht möglich ohne Rückgriff auf Erzählungen, die von der Zukunft aus auf die Gegenwart ›zurückblicken‹ oder die aus der Kenntnis bisheriger Verläufe eine Voraussage über das Kommende extrapolieren. Solche Narrative strukturieren die Art und Weise, wie wir Künftiges antizipieren, planen, aber vor allem auch zu verhindern suchen. Das Verhältnis zur Zukunft ist daher nicht denkbar ohne Metaphern, Bilder, Visionen oder hypothetische Szenarien möglicher künftiger Welten. Beck verweist in seinem Buch Weltrisikogesellschaft auf die entscheidende Rolle der »Inszenierungen« von Risiken und Gefahren: »… nur durch die Vergegenwärtigung, die Inszenierung des Weltrisikos wird die Zukunft der Katastrophe Gegenwart – oft mit dem Ziel, diese abzuwenden, indem auf gegenwärtige Entscheidungen Einfluß genommen wird«.[33] Die Zukunftsfiktionen, die uns Literatur, Kino, Populärkultur und Sachbücher anbieten, sind ebensolche Inszenierungen wie politische Metaphern (wie etwa die vom »Rettungsboot« oder »Raumschiff Erde«),[34] Symbole (vom Atompilz bis zur »Hockeyschlägerkurve« des Klimawandels) oder auch sich durch die Jahrhunderte ziehende poetische Figuren wie die des »Letzten Menschen«. Es sind Inszenierungen, in denen nicht nur ausgemalt, sondern auch ausgehandelt wird, wie man sich zu diesen möglichen Zukünften in der Gegenwart zu verhalten hat: optimistisch oder alarmistisch, »auf alles vorbereitet«, risikofreudig, skeptisch, vorsorgend und neuerdings »resilient«. Fiktionen spielen unter diesen »Inszenierungen« aber eine besondere Rolle – nicht nur als Symptome, sondern als Agenten einer Formatierung von Zukunftserwartung. Gerade in der Schrillheit ihrer Bilder und der Exzeptionalität ihrer Plots und Figuren sind sie nicht nur prägnanter als soziologische Durchschnittswerte oder die überraschungsfreien Zukunftsentwürfe von Politikern oder Futurologen. Sie drücken nicht nur etwas aus, sondern greifen unmittelbar strukturierend in das Imaginäre einer Kultur ein. Dabei sind sie weder einfach Abbildungen allgemeiner psychischer Verfassungen noch platterdings Medien ideologischer Indoktrination. Sie müssen vielmehr als Interventionen in dieses kollektive Imaginäre verstanden werden, Interventionen, in denen dieses überhaupt erst hergestellt, strukturiert und vor allem auch verhandelt wird. Zukunftsfiktionen dienen dazu, der Ungewissheit einer offenen, plan- und gestaltbaren Zukunft in der Moderne »einen Ort im gesellschaftlichen Imaginationshaushalt zu geben, sie gleichsam in die Gegenwart einzupreisen und umgekehrt die jeweilige Gegenwart auf das, was kommen wird, hin zu öffnen«.[35] Zukunftsfiktionen machen nicht nur die Zukunft, sondern vor allem auch die Gegenwart, die Wirklichkeit, in der wir leben.
Es ist daher nicht damit getan, die unterliegenden Ideologien, die kollektiven Ängste oder Hysterien auszuweisen oder auch nach den »Sinngebungen« zu suchen, die sich in solchen Zukunftsfiktionen ausdrücken. Es gilt vielmehr, wie Isak Winkel Holm vorgeschlagen hat, zu fragen, wie Zukunftsfiktionen in die Wirklichkeit eingreifen und welche Formen sie anbieten (und historisch angeboten haben), um Wirklichkeit wahrzunehmen und zu strukturieren. Das heißt, die »kognitiven Schemata« zu analysieren, die es uns ermöglichen, anomische Ereignisse überhaupt erst als einen bestimmten Ereignis- und Erfahrungstyp wahrzunehmen oder zu imaginieren.[36] Bemerkenswert ist dabei, dass Katastrophen nicht nur als Bruch einer gegebenen Wirklichkeit, sondern stets auch als Sichtbarwerden einer unterliegenden grundlegenden Struktur, eines verborgenen »Realen« wahrgenommen werden. Slavoj Žižek hat darauf hingewiesen, dass diese Vorstellungen vom »Realen« – also einer Wirklichkeit unterhalb dessen, was wir als alltägliche soziale Oberfläche wahrnehmen – selbst von Phantasmen strukturiert sind, die uns im Kino, in der Literatur, aber auch aus der Rhetorik von Politikern oder den Popularisierungsformen von Wissenschaft entgegenschallen.[37] Diese populären Phantasmen, so Žižek, strukturieren, was wir für wahrscheinlich, für möglich, für erwartbar, für authentisch halten; sie prägen die imaginären Schemata, nach denen Wirklichkeit wahrgenommen und interpretiert wird. Das »Reale«, das wir insbesondere in Ausnahmesituationen, in unerwarteten Wendungen, in Momenten der sozialen Unordnung und des Zusammenbruchs zivilisatorischer Strukturen hervortreten sehen, ist so selbst eine imaginäre Konstruktion – und als solche auf ihre fiktionalen Quellen und Schauplätze hin zu analysieren. Ein solches Phantasma ist etwa die Rede vom »Ernstfall«, in dem um des lieben Überlebens willen andere Regeln des Sozialen gelten...
| Erscheint lt. Verlag | 26.6.2014 |
|---|---|
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Geisteswissenschaften ► Religion / Theologie | |
| Schlagworte | Apokalypse • Biopolitik • Cormac McCarthy • Crash • Dystopie • Franz Kafka • Grainville • Günther Anders • Herman Kahn • Hermann Kahn • James Cole • Jean Paul • Kalter Krieg • Katastrophe • Leo Szilard • Lord Byron • Malthus • Robert Malthus • Sachbuch • Samuel Beckett • Unfall • Wetter • Zukunftswissen |
| ISBN-10 | 3-10-401376-4 / 3104013764 |
| ISBN-13 | 978-3-10-401376-3 / 9783104013763 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,8 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich