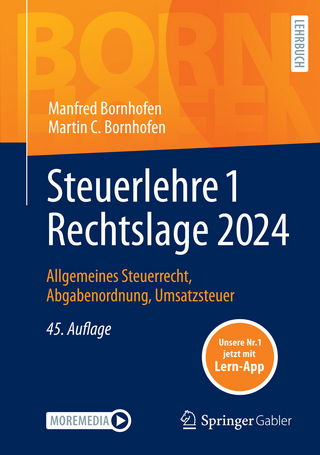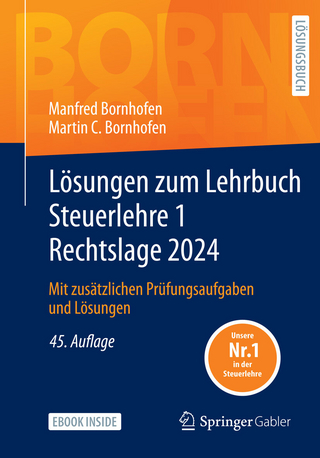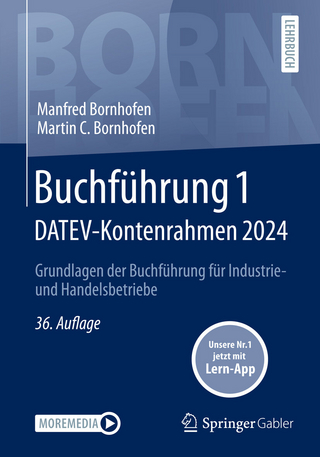Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse (eBook)
XXXVI, 1438 Seiten
Schäffer-Poeschel Lehrbuch Verlag
978-3-7992-6765-6 (ISBN)
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Adolf G. Coenenberg, Emeritus Universität Augsburg; Prof. Dr. Axel Haller, Lehrstuhl für Financial Accounting und Auditing, Universität Regensburg; Prof. Dr. Wolfgang Schultze, Lehrstuhl für Wirtschaftsprüfung und Controlling, Universität Augsburg
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Adolf G. Coenenberg, Emeritus Universität Augsburg; Prof. Dr. Axel Haller, Lehrstuhl für Financial Accounting und Auditing, Universität Regensburg; Prof. Dr. Wolfgang Schultze, Lehrstuhl für Wirtschaftsprüfung und Controlling, Universität Augsburg
Vorwort 6
Inhaltsübersicht 10
Inhaltsverzeichnis 12
Erster Teil: Erstellung des Jahresabschlusses 12
Zweiter Teil: Analyse des Jahresabschlusses 26
Dritter Teil: Theorien des Jahresabschlusses 28
Abkürzungsverzeichnis 30
Erster Teil Erstellung des Jahresabschlusses 38
1. Kapitel: Wesen und Grundlagen des Jahresabschlusses 40
A. Bilanz als zentrales Instrument der Unternehmensrechnung 40
B. Geschichtliche Entwicklung der Jahresabschlusserstellung und internationale Einflüsse 46
C. Funktionen des Jahresabschlusses 53
I. Handelsrechtliche Funktionen 54
II. Steuerrechtliche Funktionen 58
III. Funktionen nach IFRS 61
D. Normative Grundlagen des Jahresabschlusses 62
I. Nationale Rechtsnormen des Jahresabschlusses 62
1. Bestimmungen im Handelsrecht 62
2. Bestimmungen im Steuerrecht 73
3. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 74
a) Charakterisierung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 74
(1) Richtigkeit und Willkürfreiheit 76
(2) Klarheit 77
(3) Vollständigkeit 77
(4) Grundsatz der Stetigkeit 78
(5) Grundsatz der Vorsicht 78
(6) Abgrenzungsgrundsätze 79
b) Kodifizierung von Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung imHandelsrecht 82
4. Bestimmungen nach DRS 84
a) Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC) 84
b) Deutsche Rechnungslegungsstandards (DRS) 86
II. Internationale Rechnungslegungsnormen 88
1. Bestimmungen nach IFRS 89
a) Institutioneller Rahmen der IFRS 89
b) Anwendung der IFRS in der EU und weltweit 92
c) International Financial Reporting Standards (IFRS) 97
d) Rechnungslegungsgrundsätze nach IFRS 102
e) Erstanwendung der IFRS 106
2. Bestimmungen nach US-GAAP 108
a) Normsetzende Institutionen 108
b) Struktur der US-GAAP 110
2. Kapitel: Basiselemente der Bilanzierung 114
A. Bilanzansatz (»Bilanzierung dem Grunde nach«) 114
I. Bilanzansatz nach nationalen Normen 114
1. Bilanzierungsfähigkeit 114
2. Abgrenzung des Vermögens und der Schulden nach Unternehmens-zugehörigkeit 117
3. Abgrenzung der Mehrungen des Vermögensbestandes von bloßen Erhaltungsmaßnahmen 120
4. Bilanzierungsverbote 121
5. Bilanzierungswahlrechte 122
II. Bilanzansatz nach IFRS 123
1. Bilanzierungsfähigkeit 123
2. Abgrenzung des Vermögens und der Schulden nach Unternehmenszugehörigkeit 126
3. Abgrenzung der Mehrungen des Vermögensbestandes von bloßen Erhaltungsmaßnahmen 127
4. Bilanzierungsverbote und Bilanzierungswahlrechte 127
III. Bilanzansatz nach US-GAAP 128
B. Bilanzbewertung (»Bilanzierung der Höhe nach«) 130
I. Grundlegende bilanzielle Wertbegriffe der Zugangsbewertung 130
1. Zugangsbewertung nach nationalen Normen 130
a) Anschaffungskosten 132
b) Herstellungskosten 135
c) Erfüllungsbetrag und Barwert 139
d) Beizulegender Zeitwert 141
e) Teilwert nach EStG 143
2. Zugangsbewertung nach IFRS 145
a) Anschaffungskosten 146
b) Herstellungskosten 148
c) Erfüllungsbetrag und Barwert 149
d) Fair value 150
3. Zugangsbewertung nach US-GAAP 152
II. Folgebewertung 154
1. Außerplanmäßige Wertkorrekturen nach nationalen Normen 155
2. Wertkorrekturen nach IFRS 160
a) Korrekturwerte 160
b) Außerplanmäßige Abschreibungen 161
c) Weitere Wertkorrekturen 167
d) Wertaufholung 167
3. Wertkorrekturen nach US-GAAP 169
a) Korrekturwerte 169
b) Außerplanmäßige Abschreibungen 169
c) Wertaufholung 172
C. Bilanzausweis 172
I. Bilanzausweis nach nationalen Normen 173
II. Bilanzausweis nach IFRS 178
III. Bilanzausweis nach US-GAAP 182
3. Kapitel: Bilanzierung von Sachanlagen und immateriellem Vermögen 188
A. Bilanzierung des Sachanlagevermögens nach nationalen Normen 188
I. Ansatz und Ausweis 188
II. Bewertung 190
1. Allgemeine Grundsätze 190
a) Klassifizierung von Abschreibungen 190
b) Planmäßige Abschreibung 193
(1) Schätzung der Nutzungsdauer 194
(2) Wahl des Abschreibungsverfahrens 194
(3) Abschreibung nach Maßgabe der Inanspruchnahme 195
(4) Lineare Abschreibung 196
(5) Degressive Abschreibung 197
(6) Progressive Abschreibung 199
c) Außerplanmäßige Abschreibung 199
2. Einzelfragen der Bewertung 203
III. Anlagespiegel 204
B. Bilanzierung des Sachanlagevermögens nach IFRS 207
I. Ansatz und Ausweis 207
II. Bewertung 208
III. Einzelfragen 212
IV. Anhangangaben 214
C. Bilanzierung des Sachanlagevermögens nach US-GAAP 214
D. Bilanzierung von immateriellem Vermögen nach nationalen Normen 215
I. Ansatz 215
1. Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände 216
2. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände 218
3. Immaterielle Vermögensgegenstände bei Unternehmens-zusammenschlüssen 219
II. Bewertung 220
III. Ausweis 221
E. Bilanzierung von immateriellem Vermögen nach IFRS 221
I. Ansatz und Ausweis 221
1. Selbst geschaffene und entgeltlich erworbene immaterielle Vermögenswerte 222
2. Immaterielle Vermögenswerte bei Unternehmenszusammen-schlüssen 225
II. Bewertung 226
III. Anhangangaben 228
F. Bilanzierung von immateriellem Vermögen nach US-GAAP 229
I. Ansatz und Ausweis 229
II. Bewertung 230
G. Sonderprobleme der Bilanzierung von Leasingverträgen 231
I. Leasingverträge nach nationalen Normen 232
II. Leasingverträge nach IFRS 235
III. Leasingverträge nach US-GAAP 239
IV. Exposure Draft 2013 zur Bilanzierung von Leasingverhältnissen 242
4. Kapitel: Bilanzierung des Vorratsvermögens 248
A. Bilanzierung des Vorratsvermögens nach nationalen Normen 248
I. Ansatz und Ausweis der Vorräte nach nationalen Normen 248
II. Bewertung der Vorräte nach nationalen Normen 250
III. Bewertungsvereinfachungen 253
1. Festbewertung 254
2. Gruppenbewertung 255
3. Sammelbewertung 257
a) Fifo-Verfahren (first in – first out) 257
b) Lifo-Verfahren (last in – first out) 258
c) Unzulässige Sammelbewertungsverfahren 259
4. Retrograde Wertermittlung 260
B. Bilanzierung des Vorratsvermögens nach IFRS 260
I. Ansatz und Ausweis der Vorräte nach IFRS 260
II. Bewertung der Vorräte nach IFRS 261
C. Bilanzierung des Vorratsvermögens nach US-GAAP 263
I. Ansatz und Ausweis der Vorräte nach US-GAAP 263
II. Bewertung der Vorräte nach US-GAAP 264
D. Bilanzierung langfristiger Fertigungsaufträge 266
I. Langfristige Fertigungsaufträge nach nationalen Normen 271
II. Fertigungsaufträge nach IFRS 272
III. Langfristige Fertigungsaufträge nach US-GAAP 276
5. Kapitel: Bilanzierung von Finanzinstrumenten 280
A. Begriff und Arten von Finanzinstrumenten 280
B. Originäre Finanzinstrumente 283
I. Bilanzierung von originären Finanzinstrumenten nach nationalen Normen 283
1. Ansatz und Ausweis 283
a) Anlagevermögen 283
b) Umlaufvermögen 286
2. Bewertung 289
a) Bewertungsgrundlagen 289
(1) Anlagevermögen 290
(2) Umlaufvermögen 290
b) Einzelfragen der Bewertung 291
(1) Anlagevermögen 291
(2) Umlaufvermögen 293
3. Erläuterungspflichten 297
II. Bilanzierung von originären Finanzinstrumenten nach IFRS 297
1. Kategorien von Finanzinstrumenten nach IAS 39 299
2. Ansatz und Ausweis 304
3. Bewertung 305
a) Bewertung nach IAS 39 305
(1) At fair value through profit or loss 308
(2) Loans and receivables 308
(3) Held-to-maturity 309
(4) Available-for-sale 310
(5) Other financial liabilities 310
b) Einzelfragen der Bewertung 310
(1) Beteiligungsverhältnisse 310
(2) Liquide Mittel 311
(3) Finanzgarantien 311
(4) Auf Fremdwährung lautende Finanzanlagen 312
(5) Umwidmung von Finanzinstrumenten 312
4. Erläuterungspflichten 313
5. Neue Vorschriften nach IFRS 9 314
6. Wesentliche Abweichungen des IFRS for SMEs 318
III. Bilanzierung von originären Finanzinstrumenten nach US-GAAP 318
1. Ansatz und Ausweis 319
2. Bewertung 320
a) Bewertung nach ASC 320 321
b) Einzelfragen der Bewertung 322
3. Erläuterungspflichten 323
4. Vorschlag für die zukünftige Bilanzierung 323
C. Derivative Finanzinstrumente 323
I. Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten nach nationalen Normen 325
1. Ansatz 326
2. Bewertung 327
3. Spezialfall: Strukturierte Finanzinstrumente 328
4. Erläuterungspflichten 329
II. Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten nach IFRS 330
1. Ansatz 330
2. Bewertung 331
3. Spezialfall: Strukturierte Finanzinstrumente 331
4. Erläuterungspflichten 333
5. Neue Vorschriften nach IFRS 9 333
6. Wesentliche Abweichungen des IFRS for SMEs 334
III. Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten nach US-GAAP 334
1. Ansatz und Bewertung 334
2. Spezialfall: Strukturierte Finanzinstrumente 335
3. Erläuterungspflichten 335
4. Vorschlag für die zukünftige Bilanzierung 336
D. Sicherungsgeschäfte 336
I. Bilanzierung von Sicherungsgeschäften nach nationalen Normen 338
1. Voraussetzungen für die Bildung von Bewertungseinheiten 339
2. Bilanzielle Abbildung von Bewertungseinheiten 341
a) Einfrierungsmethode 342
b) Durchbuchungsmethode 343
3. Erläuterungspflichten 344
II. Bilanzierung von Sicherungsgeschäften nach IFRS 345
1. Voraussetzungen für die Anwendung des hedge accounting 346
2. Bilanzielle Abbildung nach den Regeln des hedge accounting 348
a) Fair value hedge 349
b) Cash flow hedge 350
c) Hedge of a net investment in a foreign operation 352
3. Erläuterungspflichten 353
4. Vorschläge im Rahmen der Überarbeitung von IAS 39 354
5. Wesentliche Abweichungen des IFRS for SMEs 355
III. Bilanzierung von Sicherungsgeschäften nach US-GAAP 355
1. Voraussetzungen für die Anwendung des hedge accounting 356
2. Bilanzielle Abbildung nach den Regeln des hedge accounting 356
3. Erläuterungspflichten 357
4. Vorschlag für die zukünftige Bilanzierung 358
6. Kapitel: Bilanzierung des Eigenkapitals 362
A. Bilanzierung des Eigenkapitals nach nationalen Normen 362
I. Darstellungsform des Eigenkapitals in der Bilanz 362
II. Gezeichnetes Kapital 365
1. Begriff und Bilanzierung des gezeichneten Kapitals 366
2. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 369
3. Erhöhung des gezeichneten Kapitals 370
4. Herabsetzung des gezeichneten Kapitals 373
III. Rücklagen 377
1. Offene Rücklagen 378
a) Kapitalrücklage 378
b) Gewinnrücklagen 380
(1) Gesetzliche Rücklage 380
(2) Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 382
(3) Satzungsmäßige Rücklagen 383
(4) Andere Gewinnrücklagen 384
2. Sonderposten mit Rücklageanteil 387
3. Stille Rücklagen 388
IV. Bilanzierung eigener Anteile 390
V. Bilanzergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag, Gewinn-/ Verlustvortrag, Bilanzgewinn/-verlust) 393
VI. Besonderheiten der Eigenkapitalbilanzierung bei Nicht- Kapitalgesellschaften 396
B. Bilanzierung des Eigenkapitals nach IFRS 399
I. Abgrenzung von Eigen- und Fremdkapital 399
II. Darstellungsform des Eigenkapitals in der Bilanz 401
III. Gezeichnetes Kapital 403
IV. Rücklagen 403
1. Offene Rücklagen 404
a) Kapitalrücklage 404
b) Gewinnrücklagen 405
2. Stille Rücklagen 407
V. Bilanzierung eigener Anteile 408
VI. Bilanzergebnis 411
VII. Besonderheiten der Eigenkapitalbilanzierung bei Nicht- Kapitalgesellschaften 411
C. Bilanzierung des Eigenkapitals nach US-GAAP 417
D. Bilanzierung von vergütungshalber gewährten Aktienoptionen und ähnlichen Entgeltformen 420
I. Aktienbasierte Vergütung nach nationalen Normen 423
1. Bilanzielle Behandlung von realen Aktienoptionsplänen 423
2. Bilanzielle Behandlung virtueller Aktienoptionen 427
3. Anhangangaben zu Aktienoptionsplänen 428
II. Aktienbasierte Vergütung nach IFRS 428
1. Bilanzielle Behandlung von equity-settled share-based payment transactions 430
2. Bilanzielle Behandlung von cash-settled share-based payment transactions 438
3. Bilanzielle Behandlung von share-based payment transactions with cash alternatives 439
4. Anteilsbasierte Vergütungen im Konzernverbund 441
5. Anhangangaben zu Aktienoptionsplänen 442
III. Aktienbasierte Vergütung nach US-GAAP 443
7. Kapitel: Bilanzierung des Fremdkapitals 448
A. Bilanzierung von Verbindlichkeiten nach nationalen Normen 448
I. Ansatz und Ausweis von Verbindlichkeiten 449
1. Anleihen 452
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 453
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 453
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 454
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 454
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 455
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 455
8. Sonstige Verbindlichkeiten 456
II. Bewertung von Verbindlichkeiten 457
B. Bilanzierung von Rückstellungen nach nationalen Normen 460
I. Ansatz und Ausweis von Rückstellungen 460
II. Bildung und Auflösung von Rückstellungen 465
III. Bewertung von Rückstellungen 465
IV. Einzelne Rückstellungsarten 468
1. Rückstellungen aufgrund einer Verpflichtung gegenüber Dritten 468
a) Pensionsrückstellungen 469
b) Rückstellung für andere Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern 475
c) Steuerrückstellungen 476
d) Rückstellungen für Garantieverpflichtungen 477
e) Rückstellungen für Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtung 478
f) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 478
g) Rückstellungen für Umweltschutzmaßnahmen 480
h) Weitere Rückstellungen aufgrund einer Verpflichtung gegenüber Dritten 481
2. Rückstellungen ohne Verpflichtung gegenüber Dritten 482
a) Rückstellung für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung 482
b) Rückstellung für unterlassene Abraumbeseitigung 483
C. Bilanzierung von Schulden nach IFRS 484
I. Ansatz und Ausweis von Schulden 484
II. Bilanzierung von Verbindlichkeiten 486
1. Ansatz und Ausweis von Verbindlichkeiten 487
2. Bewertung von Verbindlichkeiten 488
III. Bilanzierung von Rückstellungen 490
1. Ansatz und Ausweis von Rückstellungen 491
2. Bewertung von Rückstellungen 492
3. Einzelne Rückstellungsarten 492
a) Rückstellungen aufgrund einer Verpflichtung gegenüber Dritten 492
(1) Pensionsrückstellungen 492
(2) Rückstellungen für andere Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern 496
(3) Rückstellungen für Garantieverpflichtungen 497
(4) Rückstellungen für Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtung 497
(5) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 497
(6) Rückstellungen für Restrukturierungsmaßnahmen 498
(7) Rückstellungen für Umweltschutzmaßnahmen 499
(8) Rückstellungen für staatlich erhobene Abgaben 500
b) Rückstellungen ohne Verpflichtung gegenüber Dritten 500
IV. Aktuelle Entwicklungen 501
D. Bilanzierung von Schulden nach US-GAAP 502
8. Kapitel: Übrige Bilanzposten 508
A. Rechnungsabgrenzungsposten 508
I. Rechnungsabgrenzungsposten nach nationalen Normen 508
II. Rechnungsabgrenzungsposten nach internationalen Normen 510
B. Latente Steuern 511
I. Konzeption der Verrechnung latenter Steuern 512
1. Ermittlung latenter Steuern 512
a) Abgrenzung latenter Steuern nach dem Timing-Konzept 513
b) Abgrenzung latenter Steuern nach dem Temporary-Konzept 517
2. Methoden der Abgrenzung latenter Steuern 519
a) Liability-Methode 519
b) Deferred-Methode 519
c) Net-of-Tax-Methode 519
d) Kritik und Kompatibilität der Steuerabgrenzungsmethoden 522
3. Bewertung latenter Steuern 524
a) Wahl des Steuersatzes 524
b) Einzel- und Gruppenbewertung 524
(1) Brutto-Methode (gross-change-method) 525
(2) Netto-Methode (net-change-method) 525
II. Latente Steuern nach nationalen Normen 526
1. Temporary-Konzept als Grundlage 526
2. Fälle für den Ansatz passiver und aktiver latenter Steuer-abgrenzungen in der Handelsbilanz 527
3. Ermittlung, Bewertung und Ausweis latenter Steuern 528
a) Einzel- und Gesamtdifferenzenbetrachtung 529
b) Steuersatz zur Bewertung latenter Steuern 531
c) Ausweis latenter Steuern nach HGB 533
d) Latente Steuern bei Verlustvorträgen, Verlustrückträgen und Zinsvorträgen 534
III. Latente Steuern nach internationalen Normen 535
1. Temporary-Konzept als Grundlage 535
2. Fälle passiver und aktiver latenter Steuern 536
a) Passive latente Steuern (taxable temporary differences) 536
b) Aktive latente Steuern (deductible temporary differences) 537
3. Ermittlung, Bewertung und Ausweis latenter Steuern 540
a) GuV-wirksame und GuV-neutrale Ermittlung latenter Steuern 540
b) Bewertung latenter Steuern 541
c) Ausweis latenter Steuern 541
IV. Latente Steuern nach US-GAAP 542
9. Kapitel: Gesamtergebnisrechnung 544
A. Abgrenzung der Erfolgskonzeptionen und Erfolgsbegriffe 545
B. Gestaltungsmöglichkeiten für die Erfolgsrechnung 553
C. Gewinn- und Verlustrechnung 557
I. Grundsätzliche Gestaltungsformen der Gewinn- und Verlustrechnung 557
II. GuV nach nationalen Normen 559
1. Gliederung nach HGB 560
2. Ergebnisspaltung nach nationalen Normen 565
3. Inhalt der GuV nach HGB 568
a) Ergebnisrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren 568
b) Ergebnisrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren 584
c) Sonderprobleme der Ergebnisermittlung 591
III. GuV nach IFRS 593
1. Gliederung nach IFRS 594
2. Ergebnisspaltung nach IFRS 596
3. Inhalt der GuV nach IFRS 599
a) Ergebnisrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren 599
b) Ergebnisrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren 612
IV. GuV nach US-GAAP 615
1. Gliederung nach US-GAAP 616
2. Ergebnisspaltung nach US-GAAP 617
3. Inhalt der GuV nach US-GAAP 619
V. Gesamtergebnisrechnung 622
1. Gesamtergebnisrechnung nach IFRS 622
a) Two-statement approach 622
b) Single statement approach 626
2. Gesamtergebnisrechnung nach US-GAAP 628
D. Ergebnisverwendungsrechnung 629
E. Eigenkapitalveränderungsrechnung 631
I. Eigenkapitalveränderungsrechnung nach nationalen Normen 631
II. Eigenkapitalveränderungsrechnung nach IFRS 633
III. Eigenkapitalveränderungsrechnung nach US-GAAP 634
F. Weitere Informationspflicht: Ergebnis je Aktie 635
I. Ergebnis je Aktie nach IFRS 636
II. Ergebnis je Aktie nach US-GAAP 641
10. Kapitel: Grundlagen des Konzernabschlusses 646
A. Grundlagen und Grundsätze des Konzernabschlusses 647
I. Aufgaben des Konzernabschlusses 647
II. Theorien des Konzernabschlusses 649
III. Grundsätze der Konzernrechnungslegung 651
B. Verpflichtung zur Aufstellung des Konzernabschlusses 652
I. Generelle Verpflichtung zur Konzernrechnungslegung 652
II. Ausnahmen von der Verpflichtung zur Konzernrechnungslegung 659
1. Befreiende Abschlüsse 659
2. Größenabhängige Befreiungen 661
C. Konsolidierungskreis 662
I. Grundsätzliche Einbeziehungspflicht 662
II. Einbeziehungswahlrechte 664
1. Beschränkung bestimmter Rechte des Mutterunternehmens 664
2. Unverhältnismäßig hohe Kosten oder Verzögerungen 665
3. Anteile zur Weiterveräußerung 666
4. Wesentlichkeit des Tochterunternehmens 667
5. Behandlung nicht einbezogener Tochterunternehmen 667
D. Vorbereitung der Einzelabschlüsse für den Einbezug in den Konzernabschluss 669
I. Gemeinsame Vorschriften für Einzel- und Konzernabschluss 670
II. Abstimmung des Stichtags für den Konzernabschluss mit den Stichtagen der einbezogenen Konzernunternehmen 671
III. Vereinheitlichung der Bilanzinhalte der einbezogenen Konzernunternehmen 672
1. Konzerneinheitliche Bilanzansatzregeln nach HGB 674
2. Konzerneinheitliche Bewertungsregeln nach HGB 675
3. Konzerneinheitliche Bilanzierung und Bewertung nach internationalen Vorschriften 676
IV. Währungsumrechnung 677
1. Alternative Umrechnungskurse 678
2. Kriterien für die Wahl einer Umrechnungsmethode 679
3. Umrechnungsmethoden 680
a) Stichtagskursmethode 680
b) Währungsumrechnung nach dem Zeitbezug 683
c) Kursdifferenzierung nach der Fristigkeit der Posten 685
d) Kursdifferenzierung nach dem Geldcharakter der Posten 686
e) Umrechnung mit Kaufkraftparitäts- und Ertragskraftparitätskursen 686
f) Umrechnung nach dem Konzept der funktionalen Währung 687
4. Zulässigkeit von Umrechnungsmethoden 688
a) Umrechnungsmethoden nach US-GAAP 688
b) Umrechnungsmethoden nach IFRS 690
c) Umrechnungsmethoden nach HGB 694
5. Verrechnung von Währungsumrechnungsdifferenzen 694
a) Ursache von Währungsumrechnungsdifferenzen 694
b) GuV-wirksame oder GuV-neutrale Verrechnung vonWährungsumrechnungsdifferenzen 697
6. Umrechnung von Abschlüssen aus Hochinflationsländern 700
11. Kapitel: Konsolidierungs-maßnahmen im Rahmen des Konzernabschlusses 704
A. Kapitalkonsolidierung 704
I. Bilanzierung von Unternehmenserwerben 705
II. Differenzierung nach Beteiligungsverhältnissen 706
III. Vollkonsolidierung 709
1. Vollkonsolidierung nach HGB 709
a) Erstkonsolidierung von Tochterunternehmen nach der Erwerbsmethode 709
(1) Erstkonsolidierung nach der Neubewertungsmethode 712
(2) Behandlung nicht verteilbarer Unterschiedsbeträge aus derKapitalkonsolidierung (Goodwill/Badwill) 716
b) Folgekonsolidierung 719
c) Sukzessiver Anteilserwerb 721
d) Entkonsolidierung 721
2. Vollkonsolidierung nach IFRS und US-GAAP 724
a) Historische Entwicklung 724
b) Erstkonsolidierung von Tochterunternehmen nach der Erwerbsmethode 725
c) Folgekonsolidierung 732
d) Full Goodwill Method 739
e) Sukzessiver Anteilserwerb 745
f) Entkonsolidierung 747
IV. Konsolidierung gemeinschaftlich geführter oder assoziierter Unternehmen 749
1. Konsolidierung von Gemeinschaftsunternehmen 749
2. Konsolidierung mit der Equity-Methode 752
a) Equity-Methode nach HGB 752
(1) Anwendungsvoraussetzungen 752
(2) Bewertung nach der Equity-Methode 753
(3) Buchwertmethode 755
(4) Equity-Bewertung im Anlagespiegel 758
b) Equity-Methode nach IFRS und US-GAAP 758
B. Konsolidierung von Forderungen und Verbindlichkeiten 761
I. Vorschriften zur Schuldenkonsolidierung 761
1. Regelung nach HGB 762
2. Regelungen nach IFRS und US-GAAP 763
II. Durchführung der Schuldenkonsolidierung 764
C. Eliminierung von Zwischenerfolgen 767
I. Grundlagen 767
1. Komponenten des Zwischenerfolges 769
2. Ermittlung konzernintern gelieferter Vermögensgegenstände 774
II. Verrechnung von Zwischenerfolgen 776
III. Regelungen zur Zwischenerfolgseliminierung bei vollkonsolidierten Unternehmen 785
IV. Regelungen zur Zwischenerfolgseliminierung bei nicht vollkonsolidierten Unternehmen 787
D. Konsolidierungsmaßnahmen in der Konzern-Gewinn-und Verlustrechnung 789
I. Konsolidierung der Innenumsatzerlöse 792
1. Lieferungen von Konzernerzeugnissen in das Anlagevermögen 793
2. Lieferungen von Konzernerzeugnissen in das Umlaufvermögen 793
3. Lieferungen von Fremderzeugnissen in das Anlagevermögen 795
4. Lieferungen von Fremderzeugnissen in das Vorratsvermögen 796
II. Konsolidierung anderer Erträge und Aufwendungen 797
III. Konsolidierung innerkonzernlicher Ergebnisübernahmen 798
IV. Ergebnismäßige Auswirkungen von Konsolidierungsmaßnahmen 799
E. Latente Steuerabgrenzung aus Konsolidierungsvorgängen 800
I. Latente Steuern im Konzernabschluss nach HGB 800
1. Definition latenter Steuern im Konzernabschluss 801
2. Vorschriften zur latenten Steuerabgrenzung im Konzernabschluss 802
3. Einzelfragen latenter Steuern im Konzernabschluss 804
4. Abgrenzung latenter Steuern im Konzernabschluss von Kapitalgesellschaften nach DRS 805
II. Latente Steuern im Konzernabschluss nach IFRS 808
III. Latente Steuern im Konzernabschluss nach US-GAAP 814
12. Kapitel: Kapitalflussrechnung 818
A. Funktion der Kapitalflussrechnung 818
B. Betriebswirtschaftliche Grundlagen 819
I. Begriff, Aufgaben und Anforderungen 819
1. Finanzierungsrechnung als Oberbegriff 819
2. Finanzierungsrechnung als Informationsinstrument 821
3. Anforderungen 822
II. Ableitungszusammenhang zwischen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Kapitalflussrechnung 824
III. Grundsätzliche Ausgestaltungsalternativen 827
1. Fondskonzeptionen 828
2. Formen der Gliederung und Darstellung 832
a) Konto- oder Staffelform 832
b) Gliederungsformate 832
c) Direkte oder indirekte Methode der Darstellung 835
IV. Ermittlungsmethoden 837
1. Originäre Ermittlung 837
2. Derivative Ermittlung 838
a) Beständedifferenzenbilanz 838
b) Veränderungsbilanz 841
c) Bewegungsbilanz 843
d) Einbeziehung der Erfolgsrechnung 844
e) Abgrenzung eines Fonds 847
f) Aufstellung der Kapitalflussrechnung 848
C. Regelungen zur Kapitalflussrechnung als Bestandteil des Jahresabschlusses 848
I. Nationale und internationale Entwicklung der Rechnungslegungsnormen zur Kapitalflussrechnung 848
II. KFR nach nationalen Normen 849
1. Zwecke und Aufgaben 849
2. Anwendungsbereich 850
3. Ausgestaltungsregeln 851
a) Fondsabgrenzung und Fondsausweis 851
b) Zuordnung und Darstellung der Ein- und Auszahlungen in den Aktivitätsbereichen 854
(1) Aufstellungsgrundsätze für Zuordnung und Ausweis 854
(2) Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 856
(3) Cashflow aus der Investitionstätigkeit 860
(4) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 862
4. Mindestgliederungen nach DRS 2 863
III. KFR nach IFRS 864
1. Zwecke und Aufgaben 864
2. Anwendungsbereich 865
3. Ausgestaltungsregeln 865
a) Fondsabgrenzung und Fondsausweis 865
b) Zuordnung und Darstellung der Ein- und Auszahlungen in den Aktivitätsbereichen 866
1) Aufstellungsgrundsätze für Zuordnung und Ausweis 866
(2) Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 868
(3) Cashflow aus der Investitionstätigkeit 872
(4) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 873
IV. Besonderheiten der KFR nach US-GAAP 874
1. Besonderheiten im Anwendungsbereich 874
2. Besonderheiten in den Ausgestaltungsregelungen 874
V. Besonderheiten im Konzernverbund 876
1. Allgemeine Grundsätze für Konzernkapitalflussrechnungen 876
2. Ermittlungsmethoden der Konzernkapitalflussrechnung 877
3. Änderungen des Konsolidierungskreises 879
4. Währungsumrechnung 880
13. Kapitel: Berichtsinstrumente: Anhang, Segmentbericht, Lagebericht 884
A. Anhang 884
I. Anhang nach nationalen Normen 885
1. Aufstellungspflicht 885
2. Funktionen des Anhangs 886
3. Gliederung des Anhangs 888
4. Inhalt des Anhangs 889
a) Ausgewählte Anhangangaben zur Veranschaulichung der Interpretationsfunktion 890
b) Ausgewählte Anhangangaben zur Veranschaulichung der Korrekturfunktion 892
c) Ausgewählte Anhangangaben zur Veranschaulichung der Entlastungsfunktion 893
d) Ausgewählte Anhangangaben zur Veranschaulichung der Ergänzungsfunktion 894
5. Erweiterungen und Einschränkungen des Inhalts 897
II. Anhang nach IFRS 898
1. Aufstellungspflicht 899
2. Funktionen des Anhangs 899
3. Gliederung des Anhangs 900
4. Inhalt des Anhangs 901
5. Erweiterungen und Einschränkungen des Inhalts 902
III. Anhang nach US-GAAP 903
IV. Tabellarische Übersicht der Pflichtangaben im Anhang 905
1. Anhangangaben für alle Kapitalgesellschaften, Genossenschaften und vom PublG erfassten Gesellschaften 905
2. Zusätzliche rechtsformspezifische Anhangangaben 910
3. Anhangangaben im Konzernabschluss 911
4. Anhangangaben nach DRS 915
V. Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen (Related Party Disclosures) 917
1. Angaben zu nahe stehenden Unternehmen und Personen nach nationalen Normen 917
a) Angaben zu Geschäften mit nahe stehenden Unternehmen und Personen 918
b) Angaben zu verbundenen Unternehmen 919
c) Angaben zu Beteiligungsunternehmen 920
d) Angaben zu Mitgliedern der Geschäftsführungs- und Kontrollorgane 921
2. Angaben zu nahe stehenden Personen nach DRS 921
3. Angaben zu nahe stehende Unternehmen und Personen nach IFRS 922
4. Angaben zu nahe stehenden Unternehmen und Personen nach US-GAAP 930
B. Segmentbericht 931
I. Notwendigkeit und Zielsetzung der Segmentberichterstattung 931
II. Grundsätzliche Merkmale und Konzeptionen der Segmentberichterstattung 932
III. Segmentberichterstattung nach nationalen Normen 937
1. Aufstellungspflicht 937
2. Berichtspflichtige Segmente 938
3. Segmentinformationen 940
4. Darstellung des Segmentberichts 944
IV. Segmentberichterstattung nach IFRS 944
1. Anwendungsvoraussetzungen 945
2. Berichtspflichtige Segmente 946
3. Segmentinformationen 948
a) Allgemeine Informationen 949
b) Informationen zu Periodenergebnis, Vermögenswerten und Schulden proSegment 949
c) Überleitungsrechnung 952
d) Zusatzinformationen 952
4. Darstellung des Segmentberichts 953
V. Segmentberichterstattung nach US-GAAP 955
C. Lagebericht 956
I. Lagebericht nach nationalen Normen 958
1. Aufstellungs- und Offenlegungspflicht 958
2. Funktionen des Lageberichts 959
3. Formale Anforderungen an den Lagebericht 960
4. Inhalt des Lageberichts 962
a) Komponenten des Lageberichts bzw. Konzernlageberichts nach nationalenNormen 962
b) Konkretisierung der Angaben im Konzernlagebericht durch DRS 970
c) Erklärung zur Unternehmensführung 975
II. Regelungen zum Lagebericht nach IFRS 977
1. Aufstellungspflicht 977
2. Financial review by management 978
3. Management Commentary 978
III. Regelungen zum Lagebericht nach US-GAAP 980
IV. Wertorientierte Berichterstattung und Integrated Reporting 982
14. Kapitel: Kapitalmarktorientierte Berichterstattung: Zwischenbericht-erstattung, Ad hoc-Publizität 992
A. Zwischenberichterstattung 994
I. Konzepte der unterjährigen Erfolgsermittlung 994
1. Integrativer Ansatz 995
2. Eigenständiger Ansatz 996
3. Kombinierter Ansatz 997
II. Zwischenberichterstattung in Deutschland 999
1. Vorschriften zur Zwischenberichterstattung nach WpHG 999
a) Verpflichtung zur Zwischenberichterstattung 999
b) Halbjahresfinanzbericht 999
c) Zwischenmitteilung der Geschäftsführung 1002
d) Umsetzung der Konzepte zur unterjährigen Erfolgsabgrenzung 1004
2. Vorschriften im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 1004
3. Vorschriften zur Zwischenberichterstattung nach DRS 1004
a) Anwendung und Zielsetzung des DRS 16 1004
b) Halbjahresfinanzbericht 1005
c) Zwischenmitteilung der Geschäftsführung 1006
d) Umsetzung der Konzepte zur unterjährigen Erfolgsabgrenzung 1007
4. Vorschriften zur Zwischenberichterstattung nach IFRS 1007
a) Inhaltliche Anforderungen 1007
b) Umsetzung der Konzepte zur unterjährigen Erfolgsabgrenzung 1010
III. Zwischenberichterstattung nach US-GAAP 1010
B. Ad hoc-Publizität 1011
15. Kapitel: Prüfung, Offenlegung und Enforcement 1014
A. Externe Prüfung von Abschlüssen 1015
I. Prüfungspflicht und Prüfungsberechtigte 1015
II. Funktionen und Ziele der Abschlussprüfung 1018
III. Gegenstand und Umfang der Abschlussprüfung 1021
IV. Ergebnisse der Abschlussprüfung 1023
V. Berufsinstitutionen der Wirtschaftsprüfer 1024
B. Offenlegung 1025
C. Enforcement 1031
16. Kapitel: Bilanzpolitik 1038
A. Motive und Ziele der Bilanzpolitik 1038
B. Dimensionen der Bilanzpolitik 1040
C. Zielgrößen und Einzelmaßnahmen der Bilanzpolitik 1043
I. Bilanzpolitische Maßnahmen nach dem Bilanzstichtag im Rahmen der nationalen Normen 1044
II. Bilanzpolitische Maßnahmen nach dem Bilanzstichtag im Rahmen der IFRS 1047
D. Grenzen der Bilanzpolitik 1048
Zweiter Teil Analyse des Jahresabschlusses 1052
17. Kapitel: Grundlagen der Bilanzanalyse 1054
A. Erkenntnisziele und Grenzen der Bilanzanalyse 1054
I. Unternehmensziele, Unternehmens- und Bilanzanalyse 1054
II. Bilanzierungszwecke, Erkenntnisziele und Adressaten der Bilanzanalyse 1057
III. Auswertungsmethoden der Bilanzanalyse 1060
1. Vergleichsmaßstäbe 1060
2. Kennzahlen 1060
IV. Grenzen der Bilanzanalyse 1062
B. Aufbereitung des Jahresabschlusses 1064
I. Analyse der Bilanzpolitik und Anpassungen zum Zwecke der Vergleichbarkeit 1064
1. Analyse der Wirkungsrichtung der Bilanzpolitik 1064
2. Anpassungen zur Kompensation von Bilanzpolitik 1066
II. Anpassungen zur Verbesserung der Aussagekraft der Bilanzinformationen 1068
III. Aufbereitung ausgewählter Basisgrößen 1076
1. Aktivposten 1077
2. Passivposten 1079
a) Eigenkapital 1080
b) Fremdkapital 1082
c) Gesamtkapitalgrößen 1084
3. Gewinngrößen 1085
4. Sonstige relevante Posten 1086
C. Verdichtung von Kennzahlen 1089
1. Theoretische Ansätze 1089
a) Diskriminanzanalyse 1090
(1) Univariate Diskriminanzanalyse 1090
(2) Multivariate Diskriminanzanalyse 1091
(3) Empirische Untersuchungen 1092
b) Neuronale Netze 1094
c) Beurteilung der theoretischen Ansätze 1095
2. Praktische Ansätze 1095
a) Kreditvergaberichtlinien 1095
b) Rating-Verfahren 1096
18. Kapitel: Finanzwirtschaftliche Bilanzanalyse 1100
A. Investitionsanalyse: Die Vermögensstruktur 1101
I. Das Verhältnis von Anlage- zu Umlaufvermögen 1101
II. Umsatzrelationen 1103
III. Umschlagskoeffizienten 1104
IV. Kennzahlen zur Untersuchung der Investitions- und Abschreibungspolitik 1106
B. Finanzierungsanalyse: Die Kapitalstruktur 1107
I. Verschuldungsgrad 1107
II. Weitere Kennzahlen zur Kapitalstruktur 1113
C. Liquiditätsanalyse: Der Zusammenhang zwischen Investition und Finanzierung 1115
I. Liquiditätsanalyse auf Basis von Bestandsgrößen 1116
1. Grundsatz der Fristenkongruenz 1116
2. Kennzahlen zur bestandsorientierten Liquiditätsanalyse 1118
a) Lang- und mittelfristige Kennzahlen 1118
b) Kurzfristige Liquiditätskennzahlen 1119
II. Liquiditätsanalyse auf Basis von Stromgrößen 1121
1. Liquiditätsanalyse unter Einbezug der Erfolgsrechnung 1122
2. Cashflow-Analyse 1123
a) Ermittlung des Cashflow 1125
b) Cashflow als Indikator der Innenfinanzierungskraft 1127
c) Cashflow als Indikator der Verschuldungsfähigkeit 1129
d) Bedeutung und Grenzen des Cashflow als Indikator der Finanzkraft 1130
3. Analyse der Kapitalflussrechnung 1130
a) Analyse der Bereichs-Cashflows 1131
b) Zahlungsorientierte Kennzahlen der Kapitalflussrechnung 1132
c) Analyse des Free Cashflow 1134
19. Kapitel: Erfolgswirtschaftliche Bilanzanalyse 1140
A. Ergebnisanalyse 1142
I. Betragsmäßige Ergebnisanalyse 1143
1. Auswertung von Informationen des Anhangs bzw. der Notes 1144
a) Auswertung von Informationen des Anhangs gemäß HGB 1145
b) Auswertung von Informationen des Anhangs gemäß IFRS/US-GAAP 1146
2. Other Comprehensive Income als Indikator der Ertragskraft 1148
3. Vergleich von Börsen- und Bilanzwert 1150
4. Cashflow als Indikator der Ertragskraft 1151
a) Cashflow als retrospektiver Erfolgsmaßstab 1152
b) Cashflow als prospektiver Erfolgsmaßstab 1154
5. Ergebnis nach DVFA/SG als Indikator der Ertragskraft 1155
II. Strukturelle Ergebnisanalyse 1157
1. Ergebnisquellenanalyse 1158
a) Ergebnisspaltung 1158
(1) Ergebnisspaltung im HGB-Abschluss 1160
(2) Ergebnisspaltung im IFRS-Abschluss 1167
(3) Ergebnisspaltung im US-GAAP-Abschluss 1177
b) Ergebnissegmentierung 1178
2. Ergebnisstrukturanalyse 1181
a) Analyse der Gesamtergebnisstruktur 1181
b) Analyse der Aufwands- und Ertragsstruktur 1183
(1) Aufwandsstrukturanalyse bei Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnungnach dem Gesamtkostenverfahren 1183
(2) Aufwandsstrukturanalyse bei Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnungnach dem Umsatzkostenverfahren 1186
(3) Ergebnisstrukturanalyse und Entsprechungsprinzip 1187
B. Rentabilitätsanalyse 1188
I. Eigenkapitalrentabilität 1189
II. Aktienrentabilität 1191
1. Gewinn je Aktie/earnings per share 1192
2. Kurs-Gewinn-Verhältnis/Price Earnings Ratio 1194
3. Dividende je Aktie und Dividenden-Deckungsgrad 1196
III. Marktwertmultiples 1197
IV. Gesamtkapital- und Umsatzrentabilität 1200
1. Grundversion der Gesamtkapital- und Umsatzrentabilität 1200
2. Varianten der Gesamtkapital- und Umsatzrentabilität 1203
3. Wertorientierte Rentabilitätskennzahlen 1205
V. Rentabilitätsanalyse mit Kennzahlensystemen 1209
1. Kennzahlensystem zur Analyse der Eigenkapitalrentabilität 1209
2. Kennzahlensystem zur Analyse der Gesamtkapitalrentabilität 1210
C. Wertschöpfungsanalyse 1212
I. Bedeutung der Wertschöpfungsanalyse 1212
II. Definition und Ermittlung der Wertschöpfung 1213
1. Entstehungs- und Verteilungsrechnung 1213
2. Ermittlung der Wertschöpfung im HGB-Abschluss 1214
a) Entstehungsrechnung 1215
b) Verteilungsrechnung 1216
3. Ermittlung der Wertschöpfung im IFRS- und US-GAAP-Abschluss 1218
III. Wertschöpfungskennzahlen 1220
D. Break-even-Analyse 1223
20. Kapitel: Strategische Bilanzanalyse 1232
A. Notwendigkeit und Konzeption der strategischen Bilanzanalyse 1232
B. Ressourcenorientierte Analyse 1236
C. Marktwertorientierte Analyse 1243
I. Aktienrentabilität 1243
II. Marktwertorientierte Positionierungs- und Wachstumserwartungen 1246
1. Analyse der strategischen Positionierungserwartungen 1246
2. Analyse der Wachstumserwartungen 1247
D. Zukunftserfolgswertorientierte Analyse 1249
I. SWOT-Analyse zur Analyse des Geschäftsportfolios 1250
II. Kennzahlengestützte Analyse des Geschäftsportfolios 1251
1. Portfolioanalyse von Investitionspolitik und Innenfinanzierungskraft 1252
2. Analyse der Rentabiltät des Geschäftsportfolios 1255
3. Kombinierte Rentabilitäts- und Liquiditätsanalyse des Geschäfts-portfolios 1257
21. Kapitel: Prognose auf Grundlage der Bilanzanalyse 1262
A. Zusammenhänge von Prognose und Bewertung 1262
B. Vereinfachte Prognose 1269
C. Umfassende Prognose 1277
Dritter TeilTheorien des Jahresabschlusses 1284
Dritter Teil Theorien des Jahresabschlusses 1284
22. Kapitel: Theorien des Formalinhalts der Bilanz 1286
A. Entwicklung und Aufgaben betriebswirtschaftlicher Bilanztheorien 1286
B. Statische Interpretation des Bilanzinhalts 1288
C. Dynamische Interpretation des Bilanzinhalts 1290
D. Zukunftsorientierte Interpretation des Bilanzinhalts 1292
23. Kapitel: Theorien der zieloptimalen Bilanzgestaltung 1294
A. Grundlagen für die Ableitung von Jahresabschlusszielen 1294
B. Zielträger des Jahresabschlusses und Jahresabschlussziele 1298
I. Traditionelle Auffassungen über den Zielträger des Jahresabschlusses 1299
II. Stockholder-Theorie und Jahresabschlussziele 1302
III. Stakeholder-Theorie und Jahresabschlussziele 1304
C. Theorien der Gewinnermittlung 1309
I. Gewinnermittlung auf Basis des Anschaffungswertprinzips 1310
1. Nominale Kapitalerhaltung und Bilanztheorien 1311
2. Verfahren zur Kontrolle der realen Kapitalerhaltung 1320
II. Gewinnermittlung auf der Basis des Tageswertprinzips 1323
1. Tageswertprinzip und Sachkapitalerhaltung 1324
a) Konzeption der Substanzerhaltung: Grundzüge der organischenTageswertbilanz 1325
b) Berücksichtigung der Finanzierungsstruktur (Nettosubstanzerhaltung) 1328
c) Nebenrechnung zur Korrektur des Erfolgsausweises 1333
d) Praktische Probleme der Substanzerhaltungsrechnung 1334
2. Tageswertprinzip und Erfolgsprognose 1336
III. Gewinnermittlung auf der Basis des Gesamtwertprinzips 1341
D. Theorien der öffentlichen (externen) Rechnungslegung 1346
I. Normative und positivistische Ansätze 1346
II. Methoden positivistischer Rechnungslegungsforschung 1348
1. Formal-analytische Studien 1349
2. Experimentelle Studien 1349
3. Archivdatenbasierte Studien 1350
III. Nutzen der Rechnungslegungsinformationen für die Rechnungslegungsadressaten 1351
1. Die Prognoseeignung von Rechnungslegungsinformationen 1351
a) Prognose von Unternehmensentwicklungen 1352
b) Prognose von Ergebnisentwicklungen 1353
2. Die Entscheidungsrelevanz von Rechnungslegungsinformationen 1354
a) Theoretische Grundlagen 1355
b) Methodische Grundlagen 1357
(1) Short-window-Ansatz 1357
(2) Long-window-Ansatz 1361
c) Bisherige Erkenntnisse zur Entscheidungsrelevanz vonRechnungslegungsinformationen 1363
(1) Entscheidungswirkungen von Jahres- und Konzernabschlüssen 1363
(2) Entscheidungswirkungen der Publizitätspolitik 1365
(3) Entscheidungswirkungen von Bilanzpolitik 1366
(4) Entscheidungswirkungen von Zwischenberichten 1369
(5) Bewertungsrelevanz von Rechnungslegungsinformationen 1370
IV. Bestimmungsfaktoren für die Ausgestaltung von Rechnungslegungsinformationen 1371
V. Rückwirkungen von Rechnungslegungsinformationen auf unternehmerische Entscheidungen 1376
VI. Zusammenfassung: Theoretische und praktische Bedeutung der empirischen Forschung 1377
Literaturverzeichnis 1382
Stichwortverzeichnis 1422
17. Kapitel: Grundlagen der Bilanzanalyse (S. 1017-1018)
Mit Jahresabschluss- oder auch Bilanzanalyse werden Verfahren der Informationsgewinnung und -auswertung bezeichnet, mit deren Hilfe aus den Angaben des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Anhang) und des Lageberichtes Erkenntnisse über die Vermögens-, Finanzund Ertragslage der Unternehmung gewonnen werden. Durch die unternehmensexterne Stellung des Analytikers unterscheidet sich die Bilanzanalyse von der Betriebs- oder Unternehmensanalyse, bei der dem Betrachter auch unternehmensinterne Daten (interner Abschluss, Kostenrechnung, Finanzplanung, Auftragsbestand, Kreditlinien u. Ä.) zur Verfügung stehen. Die interne Analyse ist deshalb umfassender und zuverlässiger als die externe. Externe und interne Unternehmensanalyse gleichen sich in dem Maße einander an, wie die Unternehmen an einer umfassenden Information der externen Kapitalgeber Interesse gewinnen.
Im Folgenden werden zunächst die Erkenntnisziele und Grenzen der externen Bilanzanalyse behandelt. Sodann wird auf die wichtigsten Aufbereitungsmaßnahmen für Posten von Bilanz und GuV als Vorbereitung der Bilanzanalyse eingegangen. Abschließend werden Auswertungsmethoden besprochen, die für alle Teile der Bilanzanalyse gelten. Dabei werden die in den folgenden Schritten der erfolgs- und finanzwirtschaftlichen sowie strategischen Analyse (Kapitel 18 bis 20) gewonnenen Erkenntnisse zu einem Gesamturteil verdichtet.
A. Erkenntnisziele und Grenzen der Bilanzanalyse
Aus den allgemeinen unternehmerischen Zielen können die Erkenntnisziele der Bilanzanalyse abgeleitet werden. Ebenfalls erfolgt hier die Abgrenzung der verschiedenen Bereiche der Bilanzanalyse. Außerdem wird auf Einschränkungen, die bei der Analyse von Daten eines Jahresabschlusses zu beachten sind, eingegangen. I. Unternehmensziele, Unternehmens- und Bilanzanalyse
Die Bilanzanalyse gehört in den größeren Zusammenhang der Unternehmensanalyse (vgl. Abbildung 17.1). Im Rahmen der Unternehmensanalyse wird gefragt, inwieweit das Unternehmen in der Lage war (retrospektiv) bzw. in der Lage sein wird (prospektiv), die gesetzten ökonomischen Ziele zu erreichen. Man unterscheidet drei betriebswirtschaftliche Ziele, nämlich Liquidität, Erfolg und Erfolgspotenzial (vgl. Coenenberg, A. G./Günther, T. W. [2011] sowie die dort angegebene Literatur).
Als grundlegendes unternehmerisches Ziel ist die Liquidität zu betrachten, da Liquidität, Erfolg ohne die Aufrechterhaltung der Zahlungsbereitschaft der Unternehmung trotz ansonsten guter Leistungseigenschaften (z. B. Personal, Technologie, Management) ein Fortbestand nicht möglich ist. Allerdings reicht i. d. R. eine Unternehmenssteuerung nur über die Überwachung der Liquidität nicht aus, da dies abgrenzbare Geschäfte mit kurzen Durchlaufzeiten voraussetzen würde. Neben die Liquidität tritt deshalb als weitere ökonomische Zielgröße der Unternehmenserfolg, der als periodisierte Größe für das gesamte Unternehmen eine Vorsteuerungsfunktion für die Liquidität einnimmt, ohne jedoch die Aufgaben der Liquiditätssteuerung selbst lösen zu können. Neben die reine Geldsteuerung (Liquidität) tritt damit die güter- bzw. leistungswirtschaftliche Steuerung (Erfolg).
Erfolgspotenzial In ähnlicher Weise wirkt das Erfolgspotenzial als Vorsteuerungsgröße für den Periodenerfolg, indem es als wesentliche Zielgröße der strategischen Führung des Unternehmens Einflüsse auf die nachgelagerten Ziele als eine Art Indikator anzeigt und so die Möglichkeit des adäquaten Ergreifens von Maßnahmen ermöglicht. Das Erfolgspotenzial eines Unternehmens lässt sich als ein Bündel nachhaltig wirksamer Wettbewerbsvorteile beschreiben, die im Zusammenhang mit Chancen und Risiken im Unternehmensumfeld sowie unternehmerischen Stärken und Schwächen rechtzeitig aufgebaut werden müssen, um in nachfolgenden Perioden Erfolge erzielen zu können.
Erfolgspotenzial, Erfolg und Liquidität stehen einerseits – wie aufgeführt – in einem Vorsteuerungsverhältnis: Erfolgspotenzial ist notwendige Voraussetzung für Erfolg, der seinerseits notwendige Voraussetzung für die Liquiditätsrealisierung ist. Andererseits bestehen natürlich auch rückläufige Wirkungen: Ohne Liquidität ist die zukünftige Erfolgsrealisation und der Aufbau von Erfolgspotenzialen in Frage gestellt und die Realisation gegenwärtiger Erfolge kann zu Lasten des Aufbaus von Erfolgspotenzialen gehen.
Die Unternehmensanalyse beschäftigt sich mit der Lage und Entwicklung des Unternehmens unter allen drei Zielen. Sie umfasst dementsprechend eine strategische, erfolgswirtschaftliche und finanzwirtschaftliche Analyse. Wegen der internen Stellung des Analytikers, z. B. bei einer Due-Diligence zur Vorbereitung...
| Erscheint lt. Verlag | 10.3.2014 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management |
| ISBN-10 | 3-7992-6765-4 / 3799267654 |
| ISBN-13 | 978-3-7992-6765-6 / 9783799267656 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 10,7 MB
Kopierschutz: Adobe-DRM
Adobe-DRM ist ein Kopierschutz, der das eBook vor Mißbrauch schützen soll. Dabei wird das eBook bereits beim Download auf Ihre persönliche Adobe-ID autorisiert. Lesen können Sie das eBook dann nur auf den Geräten, welche ebenfalls auf Ihre Adobe-ID registriert sind.
Details zum Adobe-DRM
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen eine
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen eine
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich