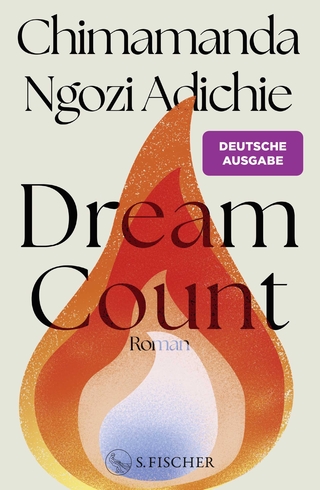Im Wald (eBook)
512 Seiten
Luchterhand Literaturverlag
978-3-641-12507-3 (ISBN)
Im Wald, in einem großen alten Haus auf einem Hügel, hat der Schriftsteller Marcus Kolpa vor langer Zeit Zuflucht vor der Welt gesucht. Doch als er die Nachricht vom Tod seiner Mutter erhält, holen ihn all die Fragen wieder ein, denen er mit seinem Einsiedlerdasein zu entkommen versucht hat. Und er muss sich eingestehen, dass er zu lange keine Gefühle an sich herangelassen hat und vergeblich die Vergangenheit verdrängen wollte ...
Die Welt als heilloser Ort - niemals will und kann Marcus Kolpa das akzeptieren. Dagegen schreibt er an, darüber diskutiert er mit seinen Freunden, und deswegen wird er im Laufe der Zeit zum brillanten Zyniker. Als er Anfang der Achtziger mit seiner Frau Chaja zusammen eine Tochter bekommt, ist er für kurze Zeit glücklich. Dann verschwindet Chaja spurlos, und Marcus schreibt, während er Rebecca allein großzieht, ein Buch, das er nie vorhatte zu schreiben und mit dem er über Nacht berühmt und reich wird.
Als ihm der Trubel der Welt zu viel wird, zieht er sich mit Rebecca in ein altes Haus auf einem Hügel im Wald zurück. Marcus scheint sich eingerichtet zu haben in seinem Leben, kultiviert seine Rolle als Eremit, auch als Rebecca erwachsen wird und fortgeht. Doch dann erreicht ihn die Nachricht, dass seine Mutter in Israel gestorben ist. Und mit einem Mal besteht sein bis dahin scheinbar so fest gefügtes Leben nur noch aus schmerzlichen Fragen: Warum ging seine Mutter fort? Wie war ihre Beziehung zu einem geheimnisvollen Amerikaner, von dem er bis dahin nie etwas gehört hat? Wer ist sein Vater? Warum ist seine Frau Chaja damals verschwunden? Lebt sie noch? Warum hat er sich all die Jahre in der Einsamkeit vergraben? Mit Hilfe seiner Tochter beginnt er, nach Antworten zu suchen und sich der Vergangenheit und den Rissen in seinem Leben zu stellen. Marcel Mörings neuer Roman ist ein beeindruckendes Gesellschaftspanorama und zugleich die packende Geschichte eines Mannes auf der Suche nach den Gefühlen, die er sich selbst nie zugestehen wollte.
Marcel Möring, geboren 1957 in Enschede, gilt als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Literaten der Niederlande. Für seinen ersten Roman »Mendel« erhielt er 1991 den wichtigsten Debütpreis des Landes, den Geertjan-Lubberhuizen-Preis, und weitere Romane wurden mit dem AKO-Literaturpreis, der Goldenen Eule und dem Flämischen Literaturpreis ausgezeichnet. Sein Roman »Der nächtige Ort« wurde 2007 mit dem Ferdinand-Bordewijk-Preis zum besten niederländischen Roman des Jahres gekürt. Marcel Möring lebt in Rotterdam.
ALS FRAU SANDERS mich zum Mittagessen rief, sagte ich ihr, ich führe für ein paar Tage weg. Sie sah mich ausdruckslos an.
»Der Anwalt oder Notar meiner Mutter hat angerufen. Meine Mutter ist gestorben«, sagte ich. »Ich fliege morgen nach Israel.«
Sie trat einen halben Schritt vor, und für einen Moment dachte ich, sie wolle mir die Hand auf den Arm legen, vielleicht sogar auf die Wange. Dann aber zuckte sie zurück, murmelte ein paar Worte des Beileids und fragte, ob sie etwas tun könne. Ich schüttelte den Kopf.
»Ich werfe ein paar Klamotten in eine Tasche und fahre morgen nach Schiphol. Ich bin nicht lange weg, vielleicht nur zwei Tage.«
»Möchten Sie …«
»Wie Sie wollen, Frau Sanders. Sie können zu Hause bleiben, Sie können kommen. Ich lasse das Vaterland in Ihrer Obhut.«
Sie sah mich mit einem skeptischen und zugleich mitleidigen Blick an.
Am nächsten Tag klingelte ich nach einem langen Flug und einer einstündigen Taxifahrt an der Wohnung meiner Mutter. Ein alter Niederländer öffnete mir, der offensichtlich die religiöse Pflicht der Trauerwache erfüllte. Auf Kinn und Wangen lag der graue Stoppelhauch eines Mehrtagebarts. Er hatte die Brusttasche seines zerknitterten Jacketts eingerissen, und drinnen, in der Diele, war der Spiegel verhüllt.
»Sie müssen der Sohn sein«, sagte der Mann müde. »Levi.«
Wir schüttelten einander die Hand. Ich fragte mich, ob, falls ich eine Schwester gehabt hätte, sie als »die Tochter« begrüßt worden wäre.
Wir saßen im kühl-eleganten Wohnzimmer. Während der alte Mann erzählte, dass meine Mutter schon in der vergangenen Woche gestorben und gemäß dem jüdischen Gesetz nach sechsunddreißig Stunden beerdigt worden war und dass es einen Tag gedauert hatte, bis man mich ausfindig machen konnte, gingen Nachbarinnen ein und aus, die Kaffee kochten und etwas zu essen brachten. Eine von ihnen kam aus der Küche, ging quer durchs Wohnzimmer, stellte sich, ohne etwas zu sagen, vor mich und strich mir über das Haar.
Arme Waise.
Wenn ich tief in mein Innerstes schaute, musste ich gestehen, dass ich mich trotz meines Alters und trotz der Tatsache, dass ich meine Mutter in den letzten fünfzehn Jahren nur ein paarmal gesehen hatte, tatsächlich so fühlte: als Waise.
Fünfundachtzig war sie geworden, bevor sie morgens von Frau Goldwasser, einer der Nachbarinnen, gefunden worden war. Sie war während der Nacht an einer Gehirnblutung gestorben, ein Ereignis, von dem sie offenbar so wenig bemerkt hatte, dass die Nachbarin lange geglaubt hatte, sie schliefe – so friedlich lag sie da. Der alte Mann saß in einem niedrigen Stahlrohrsessel mir gegenüber und nickte nachdenklich, während Frau Goldwasser mir das erzählte. Sie hätte die Schwester meiner Mutter sein können. Wie sie sei sie erst in späten Jahren nach Israel gegangen, und wie sie habe sie weder Kind noch Kegel.
Ich sah auf, als sie ihre Situation so beschrieb.
»Obwohl Ihre Mutter Sie natürlich noch hatte …«, beeilte sie sich zu sagen.
Der alte Mann in dem Metallsessel bewegte sich.
Der Wind, der von der Bucht her kam, ließ die Fensterscheiben klappern. Ich trank Kaffee und sah mich um, betrachtete, was die Wohnung meiner Mutter war und was ich nicht wiedererkannte. Aus der Küche waren gedämpfte Frauenstimmen zu hören.
»Dem Wunsch Ihrer Mutter entsprechend«, sagte der alte Mann, »sitzen wir keine richtige Schiwa. Ich hoffe, Sie nehmen uns das nicht übel.«
Ich nickte. Der Wunsch meiner Mutter. War das ihr Wunsch gewesen? Allein zu sterben in Haifa? Keine Trauer?
Hinter den großen Fenstern der Wohnung schien die Sonne auf das blaue Wasser der Bucht.
»Ich konnte es nicht lassen, den Spiegel zu verhängen«, sagte der Mann in einem Ton, als wolle er erklären, dass manche Dinge einfach zu weit gehen. »Wollen Sie Ihre Mutter besuchen?«
Mir stockte der Atem. Dann ging mir auf, dass er den Friedhof meinte.
»Ja«, sagte ich rau. »Ja, ich fürchte schon.«
Der alte Mann nickte. Ihn konnte nichts überraschen, keine alte Frau, die Einwände gegen Trauerrituale hatte, kein Sohn, der »fürchtete«, er wolle seiner Mutter Grab sehen.
Die Mittagshitze war schwer und feucht, als wir in dem auf Eiseskälte heruntergekühlten Subaru des alten Mannes zum Friedhof fuhren. Draußen war es so klar und strahlend, dass die Blättchen an den Bäumen funkelten und die Umrisse von Häusern und Bäumen vor dem wolkenlosen Himmel fast schmerzhaft scharf waren. Es war ein Mittag wie eine Ansichtskarte.
Er war 1950 nach Israel gegangen. Nicht aus zionistischen oder religiösen Überzeugungen heraus (»Ich habe den Glauben nie mit meinem Wissen von den Naturgesetzen in Einklang bringen können«, hatte er auf dem Weg zum Parkplatz gesagt), sondern weil seine Frau nicht länger in dem Vakuum leben konnte, das die Niederlande für sie waren. Beide hatten den Krieg im Versteck überlebt, keinen Kilometer voneinander entfernt, aber ohne voneinander zu wissen. Sie waren nicht die Einzigen. Im Dorf Nieuwlande, tief im Moor gelegen und durch die vielen Haupt- und Seitenkanäle von der Außenwelt abgeschnitten, hatten Dutzende von Juden Unterschlupf gefunden. Sie waren dort von Johannes Post versteckt worden, einem orthodox-calvinistischen Bauern, der Beigeordneter im benachbarten Oosterhesselen war und nicht nur eine Widerstandsgruppe gründete, sondern sich auch um Verstecke für eine beträchtliche Zahl von Juden kümmerte.
Nach dem Krieg begegneten Levi und seine damals noch zukünftige Frau einander. Sie kamen ins Gespräch, entdeckten Gemeinsamkeiten, verliebten sich und heirateten. Nach den Flitterwochen merkte Philip Levi, dass seine Frau nachts, von Schlaflosigkeit gequält, durchs Haus irrte, und als das eine Weile so gegangen war, folgte das Gespräch, in dessen Verlauf sie sagte, sie habe das Gefühl, in einem Loch zu leben. Ihre gesamte Familie war in den Lagern ermordet worden. Die Niederlande bedeuteten Leere für sie. Sie konnte sich nicht vorstellen, sich jemals wieder an diese Umgebung zu gewöhnen.
Und so gingen sie nach Israel.
»Alija heißt das auf Hebräisch«, sagte Levi. »Das bedeutet: hochgehen, aufsteigen, hinaufziehen. Und vielleicht war es das wirklich für meine Frau, denn sie stieg aus dieser dunklen, leeren Grube. Ich fand es auch nicht unangenehm, aber ich muss gestehen, dass ich nie so überschwänglich begeistert von dieser Alle-Juden-zurück-Idee war. Ein Land ist ein Land, und meiner Meinung nach macht es keinen Unterschied, an welchem Ort man wohnt und wo man geboren ist. Wir sind alle Teil der Welt, und die Welt ist Teil von uns. Das hat mein Vater immer gesagt, aber der war Sozialist, vielleicht bin ich ja infiziert.«
Levi, von der Ausbildung her Maschinenbauer, ging mit seiner Frau in einen Kibbuz, in dem er den Maschinenpark wartete. Es waren die Anfangsjahre des Staates, und viel Land war noch nicht urbar gemacht. Die Kibbuzniks legten die Sümpfe rund um ihr Dorf trocken, sie gruben mit den Händen Steine und Baumstümpfe aus und litten kollektiv an Malaria. Auf höher gelegenen Grasflächen wurde Vieh gehalten, und Philip Levi dachte sich ein System aus, wie man die Kühe mit Hilfe einer Art Karussell zu den Melkern lenken konnte, so dass man sie sozusagen am laufenden Band melken konnte. Und dann kam eine alte schwedische Melkmaschine, die Levi wartete und umbaute, und als das Ding den Geist aufzugeben drohte und kein Geld für etwas Neues da war, baute er die Maschine aus den noch brauchbaren Teilen und sonst noch vorhandenen Dingen nach, dem Block eines alten Motorrads und Teilen eines kaputten Tankwagens. Das war der Beginn dessen, was eine ganze Industrie werden sollte.
»Alles von den Schweden abgekupfert«, sagte Levi, während er seinen Subaru äußerst umsichtig durch die bergauf und bergab führenden Straßen steuerte. »Und als die Schweden dahinterkamen, was ich da machte, schickten sie einen Ingenieur. Der sah sich alles an, nickte ein paarmal und legte dann den Finger auf die Lippen. Sch … Später schickte er uns noch ein paar Messglas-Sets.«
Seine Frau starb Anfang der achtziger Jahre an Krebs, und nicht lange danach, allein und leicht desorientiert, akzeptierte Levi das Angebot, in Frührente zu gehen.
»Das machten sie wegen der ersten schweren Jahre und der Malaria und weil ich diese Maschine gebaut habe, von der sie später ziemlich viele verkauft haben. Mir wäre es egal gewesen, Herr Kolpa. Ich war allein und … aus dem Gleis geworfen, so sagt man doch, nicht? Das war ich: aus dem Gleis.«
Er ging nach Haifa, wo er die Wohnung neben jener kaufte, in die meine Mutter ein Jahr später einzog.
»Sie hat mir das Licht in meinen Augen geschenkt«, sagte Philip Levi, der mit der Präzision eines Schneiders eine Kurve ausfuhr.
Ich schaute ihn an, mir bewusst, dass mein Mund leicht offen stand.
Der Wagen glitt eine Straße hinunter, in Schattenflecken von Baumkronen hinein und wieder heraus.
»Ich wusste nicht, dass meine Mutter hier noch Arbeit als Optikerin gefunden hatte«, sagte ich steif.
Philip Levi, über das Lenkrad gebeugt und kurzsichtig in die Ferne starrend, blickte nur kurz zu mir. Dann wandte er seine Aufmerksamkeit wieder der Straße zu und lenkte den Wagen kurz danach auf einen Parkplatz. Dort stiegen wir aus, hinein in die drückende Nachmittagshitze. Mir klebte sofort das Hemd am Rücken. Warum, dachte ich, sollte ein Land, in dem merkwürdige Pflanzen aus der Erde kommen und es so heiß ist, dass man keinen Anzug tragen kann, und...
| Erscheint lt. Verlag | 29.4.2014 |
|---|---|
| Übersetzer | Helga van Beuningen |
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | Louteringsberg |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | eBooks • Epos • Gesellschaftskritik • Niederlande • Niederlande, Gesellschaftskritik, Epos • Roman • Romane |
| ISBN-10 | 3-641-12507-3 / 3641125073 |
| ISBN-13 | 978-3-641-12507-3 / 9783641125073 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich