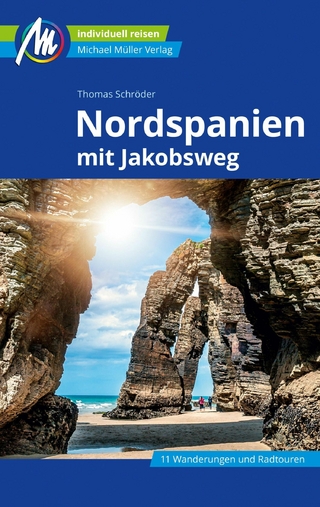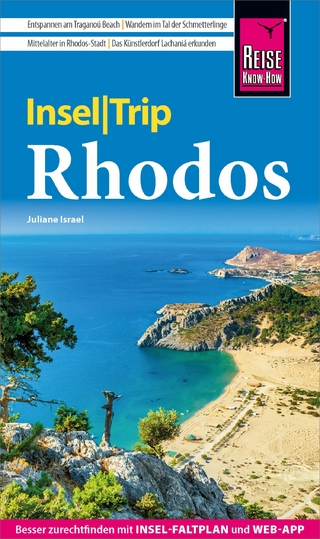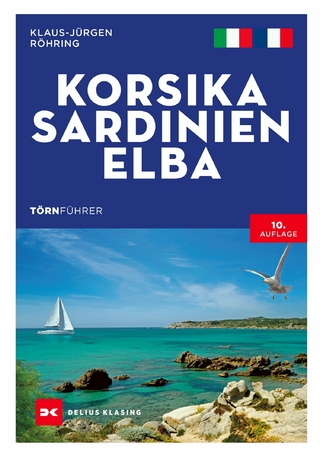Grüezi und Willkommen (eBook)
224 Seiten
Ch. Links Verlag
978-3-86284-232-2 (ISBN)
Susann Sitzlers Buch zeigt, woher die schweizerischen Vorurteile den Deutschen gegenüber kommen. Viele Verhaltens- und Umgangsweisen der Schweizer begreifen die Nachbarn nicht oder ignorieren sie einfach. Das steht mancher Freundschaft im Wege.
»Grüezi und Willkommen« bietet eine fundierte Betrachtung der gegenwärtigen Schweiz und gibt Aufschluss über Wesen und Gefühlslage der Eidgenossen. Der Leser lernt die Parallelwelten des Landes kennen, die Konventionen am Arbeitsplatz und im Privatleben, aber er erfährt auch, wie es die Schweizer mit der Liebe halten und wozu ihr hochtrainiertes Namensgedächtnis gut ist. Und wer das Land lieben gelernt hat, findet heraus, was er tun muss, um für immer zu bleiben.
Jahrgang 1970; Studium der Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte in Basel; journalistische Arbeit seit 1993; lebt seit 1996 als freie Printjournalistin und Radioautorin in Berlin; Reportagen und Porträts für Printmedien, publizistische Beiträge in Anthologien, Features und Reportagen für DeutschlandRadio Berlin, Schweizer Radio DRS u.a.
Grüezi und Willkommen in der Schweiz,
du Sauschwoob! – Von einem Abgrund,
den man nicht sehen kann
»Sie mögen uns. Aber wir mögen sie nicht.«
Unbekannte Schweizerin
Sie sehen gleich aus, aber sie verhalten sich anders. Das ist in etwa der Grundkonflikt des Alltags zwischen den Schweizern und den Deutschen. Die einen nehmen sich das Recht, etwas lauter, etwas selbstbewusster, etwas weniger unauffällig zu sein. Es sind nicht die Schweizer. Da beginnt das Problem. Für die Deutschen ist die Schweiz meistens wunderschön. Kaum über der Grenze, setzen Wiedererkennungseffekte ein, die sonst nur New York bietet: Alles sieht genau so aus, wie man es schon hundertmal auf Bildern oder im Film gesehen hat. An besonders guten Tagen scheinen die Farben hinter der Grenze sogar plötzlich stärker, leuchtet der Himmel blauer und die Wiesen satter. Selbst die Menschen wirken auf einen Schlag besser angezogen. Und die Einheimischen sagen tatsächlich »Grüezi« in dieser niedlichen Sprache: putzige Kehllaute und ein netter, bedächtiger Tonfall. Alles suggeriert diese Grundharmlosigkeit, für die man die Eidgenossen so mag. Willkommen in der Schweiz! Lassen Sie sich nicht täuschen. Ein Schweizer ist nicht harmlos. Und eigentlich ist er auch nicht freundlich gesonnen. Vor allem nicht, wenn ein Deutscher auf ihn zukommt.
In der Schweiz ein Deutscher zu sein bedeutet ein Manko. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird ein Einheimischer ihn zunächst in die Schublade »Sauschwoob« einsortieren, was soviel wie »Sauschwabe« heißt. Es spielt dabei keine Rolle, ob der Besucher aus dem Bayerischen Wald oder aus Ostfriesland kommt. Das kann ein Schweizer ohnehin nicht unterscheiden. Bemerken wird der Deutsche davon zunächst nichts. Denn in seiner Gegenwart wird der Schweizer sich noch zuvorkommender als sonst verhalten. Und er wird sofort in die Hochsprache wechseln. Nicht weil er dem Gast das Verständnis erleichtern möchte. Sondern weil er davon ausgeht, dass der Sauschwoob a) sowieso keine Fremdsprachen kann oder wenn, dann nur mit katastrophalem Akzent. Und b) will er sich auf keinen Fall anschließend ärgern müssen, dass der Deutsche ihn automatisch in Schriftdeutsch anspricht, weil er voraussetzt, dass man bereit ist, auf ihn einzugehen. Jüngere, städtische Schweizer werden das von sich weisen. Und gleich darauf relativieren, »dass es in letzter Zeit schon ziemlich viele geworden sind«. Seit 2005 machen die Deutschen die größte Zuwanderungsgruppe der Schweiz aus. Ungefähr eintausend Deutsche ziehen jeden Monat allein nach Zürich. Im Februar 2007 lancierte die Schweizer Boulevardzeitung »Blick« eine Kampagne mit dem Titel »Wie viele Deutsche erträgt die Schweiz?« Es lässt sich nicht leugnen, dass die Schweizer schon immer ziemlich schwere Vorurteile gegen die Deutschen hatten. Und dass neue dazugekommen sind.
Mit dem Zug fahre ich von Basel nach Zürich. An jedem Fenster klebt ein großes Schild. Mit Worten und Bild macht es deutlich, dass hier drin I-pod und Natel (Handy) unerwünscht sind. Ich habe ein »Ruheabteil« erwischt, das es in vielen Schweizer Zügen gibt. Man hört nur das Blättern der anderen Reisenden in ihren Zeitschriften. Nach zehn Minuten kommt ein gut angezogener Mann mit einem ledernen Aktenköfferchen herein. Er hängt seinen Mantel auf, kramt im Köfferchen und beginnt laut zu telefonieren. Ein Deutscher. Ich lebe schon lange in Deutschland und die Deutschen sind mir vertraut. Das fällt in diesem Moment von mir ab. »Du verdammter Sauschwoob«, denke ich, »meinst wieder einmal, für dich gelten andere Regeln?« Ich starre ihn böse an. Er ignoriert mich. Die anderen Reisenden drehen auch schon die Köpfe und schauen demonstrativ zu ihm hin. Er wendet sich dem Fenster zu, wo das Schild klebt, und redet weiter. In Deutschland habe ich gelernt, jetzt aufzustehen und ihm zu sagen, er möchte bitte draußen telefonieren, weil er stört. Er redet weiter in sein Handy, während er aus dem Abteil geht. Hinterher setzt er sich wieder auf seinen Platz als sei nichts gewesen. Ich bin mir sicher, dass mir das Ganze viel peinlicher war als ihm.
Die Vorurteile der Schweizer über die Deutschen werden von konkreten Beobachtungen genährt. Am Kiosk verlangen Deutsche ohne Hemmungen die Bild-Zeitung, obwohl man hier den »Blick« liest. Wenn ihnen etwas gefällt, sagen sie es so, dass alle es hören können. Wenn ihnen etwas nicht gefällt, meckern sie sofort. Alles in allem scheinen sie sich überhaupt keine Gedanken darüber zu machen, was andere – insbesondere die Schweizer – von ihnen denken. Damit unterscheiden sie sich deutlich von den Einheimischen. Natürlich wissen die Eidgenossen, dass man den Deutschen daraus keinen Strick drehen kann. Aber es gibt eben doch sehr starke Gründe für ihren Widerwillen. Wie alle Tourismusnationen haben die Schweizer prinzipiell ein schwieriges Verhältnis zu fremden Gästen. Sie sind es leid, nur als Dienstleister in einer schönen Umgebung wahrgenommen zu werden. Und neuerdings auch noch als bevorzugte Arbeitgeber. Aber es wäre auch schlecht, wenn die Fremden wegblieben. Deshalb behelfen sie sich mit abfälligen Gedanken: Es muss halt auch Japaner, Amerikaner und sonstige Touristen geben. Bei den Deutschen gelingt den Schweizern diese Distanzierung nicht so gut. Erst recht nicht, seit diese häufig Arbeitskollegen sind. Weil ihnen die Deutschen zu ähnlich sind. Sie sind ihnen derart ähnlich, dass sie sich mit ihnen vergleichen müssen. Natürlich würden sie das weit von sich weisen. Denn es kämen unangenehme Dinge dabei heraus. Zum Beispiel, dass sich ein Schweizer vielleicht deshalb so vom selbstverständlichen Auftreten der Deutschen im Ausland provozieren lässt, weil er selber sich in den Ferien lange Zeit am liebsten in Zeichensprache mit seinen Reisegefährten verständigt hat, um nirgendwo aufzufallen. Und dass ein Schweizer genauso viel zu nörgeln hat, sich das aber nur im Hotelzimmer traut. Jüngere Schweizer passen manchmal nicht mehr in dieses Bild. Davon wird später die Rede sein.
Anders als in Deutschland, wo Dialekte mehr oder weniger dem privaten Sprachgebrauch vorbehalten sind, und auch der überzeugteste Niederbayer noch über eine hochdeutsche Gebrauchssprache verfügt, ist »Schriftdeutsch« für die Schweizer eine wirkliche Fremdsprache. Eine Fremdsprache, die sie zwar von Kindheit an verstehen lernen, die sie aber unter ihresgleichen niemals üben.
Deutsch spricht man in der Schweiz ausschließlich im Schulunterricht und – mit Deutschen. Einige Schulen haben zwar 2006 Hochdeutsch als Pausenhof-Sprache eingeführt. Aber das sind Ausnahmen. Der durchschnittliche Schweizer wird in seinem Leben kaum genügend Gelegenheit finden, die mundfüllenden »Ch«-Laute und den behäbigen Tonfall so in Richtung Hochdeutsch abzuschleifen, dass er damit selbstbewusst umgehen kann. Er wird diese Gelegenheiten in der Regel auch nicht suchen. Die Sprache seiner Seele ist Dialekt. Die hochdeutschen Wörter lagern irgendwo im Keller, und wenn sie gebraucht werden, muss er sie mühsam heraufschaffen. Daran hat er einfach kein Vergnügen. Und die Deutschen anerkennen diese Mühe nicht einmal, für sie ist es selbstverständlich, dass ein Schweizer Deutsch spricht. Und dann belächeln sie noch seinen putzigen Akzent. Im direkten Kontakt fühlt sich ein Schweizer einem Deutschen allein schon deshalb unterlegen, weil er nicht so gut Hochdeutsch spricht, dass er ihm einmal die Meinung über dessen Großkotzigkeit sagen kann.
Es ist nicht so, dass die Schweizer ein geringes Selbstbewusstsein haben. Im Gegenteil. Sie wissen, dass sie praktisch allen anderen überlegen sind: Oder wo sonst auf der Welt sind die Leute noch so reich und gleichzeitig so gut gebildet, wo ist es noch so schön und gleichzeitig so sicher? Wo ist die Lebensqualität so hoch und gleichzeitig auch das Bruttosozialprodukt? Und wer hat das Ricola erfunden? Eben. Und weil die Schweizer von Kindsbeinen an wissen, dass das so ist, müssen sie damit nicht angeben. Wie reiche Kinder wurden sie lange Zeit zur Bescheidenheit erzogen. Damit die anderen sich nicht unwohl fühlen oder neidisch werden. Deshalb sind die Schweizer gar nicht in der Lage, mit ihren Qualitäten souverän anzugeben. In einer Gesellschaft wie der schweizerischen, die deshalb so gut funktioniert, weil keiner versucht, den anderen zu übertrumpfen, ist ein gut sichtbares Selbstbewusstsein keine Tugend. Das Angeben oder die Lust am Konkurrieren wird gar nicht gelehrt. Während die Deutschen, die es ja – das müssen die Schweizer anerkennen – auch relativ weit gebracht haben, ein recht unverkrampftes Verhältnis zum Angeben haben. Sie tun es halt einfach, wenn sich eine Gelegenheit ergibt. Anstand und Geschichte haben ihnen zwar beigebracht, sich im Zweifelsfall zurückzunehmen. Aber doch nicht bei den Schweizern. Dort nutzen sie die Ähnlichkeiten ungezwungen zu einem konkurrierenden Vergleich. So kommt es den Schweizern vor. Und wenn dann das entspannt polternde Auftreten eines Klischeedeutschen auf die soziale Grundverlegenheit eines Klischeeschweizers trifft – wobei die ja eigentlich die anerzogene Verschleierung seines Überlegenheitsgefühls ist – muss es zu Missverständnissen kommen.
Im Grunde weckt der Deutsche im Schweizer vor allem einen Wunsch. Er will ihm ein für alle Mal beweisen: »Mit dir Sauschwoob werde ich noch einhändig und vor dem Frühstück fertig.« Aber die Evolution hat ihm diesen Trieb seit Jahrhunderten abgewetzt. Wenn ein Deutscher auftaucht, kommt ein Eidgenosse deshalb in die paradoxe Situation, sich gleichzeitig überlegen und unterlegen zu...
| Erscheint lt. Verlag | 9.9.2013 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Länderporträts |
| Länderporträts | |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber |
| Reisen ► Reiseführer ► Europa | |
| Schlagworte | Alpen • Anpassung • Arbeit • Basel • Deutsche • Franken • Freizeit • Geld • Gewohnheiten • Helvetica • Kultur • Länderporträt • Leben • Liebesbeziehungen • Luzern • Politik • Ratgeber • Rheinfall • Schokolade • Schweiz • Soziale Beziehungen • Sozialpolitik • Suisse • Tourismus • Umgang • Unterhaltung • Vierwaldstättersee • Vorurteile • Wohnen • Zürich |
| ISBN-10 | 3-86284-232-0 / 3862842320 |
| ISBN-13 | 978-3-86284-232-2 / 9783862842322 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich