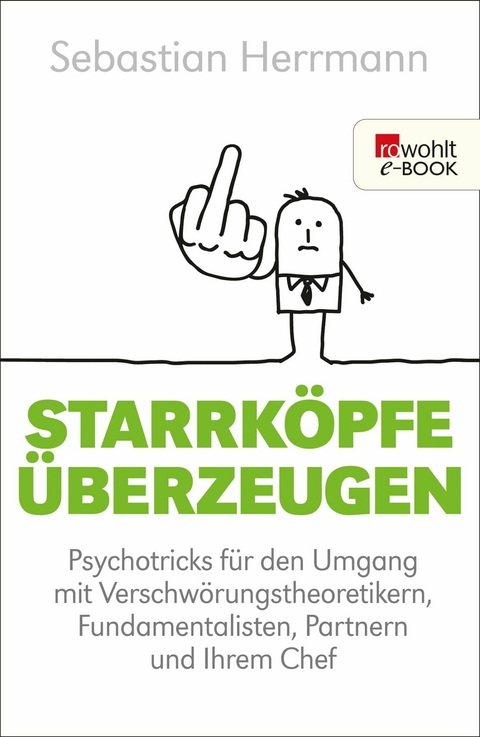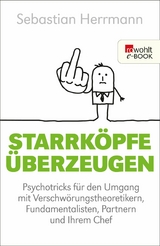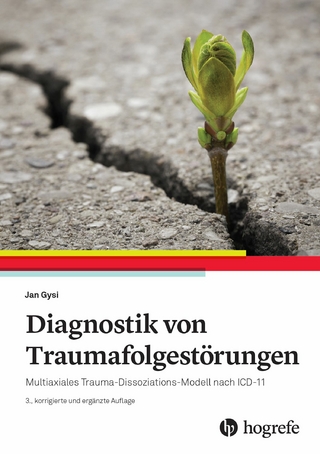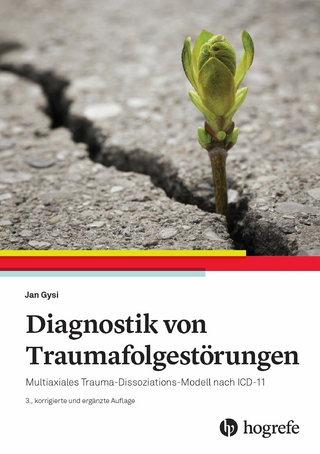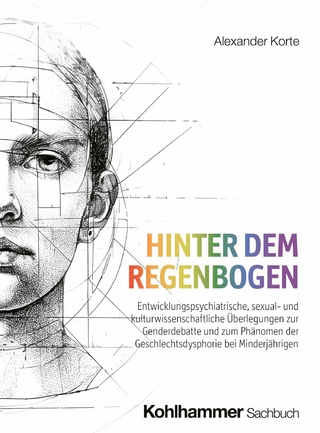Starrköpfe überzeugen (eBook)
224 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-644-49041-3 (ISBN)
Sebastian Herrmann, Jahrgang 1974, ist Wissenschaftsredakteur der Süddeutschen Zeitung. Er hat Politikwissenschaft, Geschichte und Psychologie in München, Edinburgh und Kuala Lumpur studiert. Bei der SZ berichtet er regelmäßig über Sozialpsychologie und irrationale Glaubenssysteme.
Sebastian Herrmann, Jahrgang 1974, ist Wissenschaftsredakteur der Süddeutschen Zeitung. Er hat Politikwissenschaft, Geschichte und Psychologie in München, Edinburgh und Kuala Lumpur studiert. Bei der SZ berichtet er regelmäßig über Sozialpsychologie und irrationale Glaubenssysteme.
Wie Starrköpfe ticken
Nebelkerzen im Kopf: Vergiss die Vernunft
Warum wechselt die Tennisspielerin Serena Williams ihre Socken nicht, solange sie ein Turnier spielt? Zumindest hat sie selbst das einmal erzählt. Die Frage könnte aber auch lauten: Wieso zieht der Golfer Tiger Woods bei Turnieren sonntags am liebsten ein rotes Hemd an? Und weshalb trug der Basketball-Superstar Michael Jordan unter dem Trikot immer seine alten Shorts aus Uni-Zeiten? Ganz einfach: Diese Marotten verleihen den Sportlern Sicherheit. Aus irgendeinem Grund betrachten sie die Kleidungsstücke als Erfolgsgaranten – und tatsächlich beeinflusst so etwas mitunter die Leistung von Spitzensportlern.
Die Psychologen Robert Michael und Maryanne Garry von der Universität Wellington in Neuseeland sowie Irving Kirsch von der Harvard Medical School haben Studien über ähnliche Formen der Suggestion und Autosuggestion zusammengetragen und ein Schlaglicht darauf geworfen, welche absonderlichen Kleinigkeiten unsere Wahrnehmung und unser Denken beeinflussen. Nicht alle Beispiele sind allerdings derart offensichtlich wie die von den Glücksbringern im Spitzensport. Oft handelt es sich um subtile Signale, die suggestive Kraft entfalten – und zwar ohne dass der Mehrzahl der Menschen bewusst wird, was da mit ihnen geschieht.
Wer seine Sportsocken über mehrere Tage zu einem Anschlag auf die Nase verkommen lässt, möchte nach einem ersten Sieg unter möglichst exakt gleichen Bedingungen ins nächste Match gehen. So werden zufällige Objekte oder Verhaltensweisen mit einem Erfolg in Verbindung gebracht und mit der Erwartung versehen, dass er sich durch sie wiederholen lässt. «Wenn wir ein bestimmtes Ereignis erwarten, dann setzen wir automatisch eine ganze Kette von Denkmustern und Verhaltensweisen in Gang, die dieses Ergebnis eintreten lassen – nur dass wir die Ursache dafür falsch bewerten», schreiben die Psychologen um Robert Michael in ihrer Arbeit.
Das mag banal sein, doch die einzelnen Beispiele dafür, wie sehr die Erwartung das Erleben und das Denken von Menschen beeinflusst, bleiben beeindruckend. Zum Beispiel produzieren gegensätzliche Erwartungen bei einer Aufgabe auch gegensätzliche Ergebnisse. So gaben Wissenschaftler Probanden manipulierte Wodka-Tonics, die keinen Alkohol enthielten, aber so schmeckten. Die Testpersonen erwarteten, dass der Alkohol ihre Sinne benebeln würde – und tatsächlich ließen sie sich in einem Versuch eher von verwirrenden Informationen irritieren. In einem weiteren Test ergab sich das gegenteilige Bild: Diesmal nahmen Probanden ein wirkungsloses Mittel in dem Glauben ein, es handele sich um ein Medikament, das die Leistungsfähigkeit von Soldaten im Einsatz steigere. Unter diesen Umständen waren die Probanden konzentriert und kaum empfänglich für die verwirrenden Informationen, die ihnen präsentiert wurden.
Diese Art von Studien haben Psychologen in den vergangenen Jahren in beeindruckender Zahl publiziert: Die gleiche Schokolade schmeckt besser, wenn man glaubt, sie stamme aus der Schweiz statt aus China. Ein Energydrink zum vollen Preis lässt einen mehr Aufgaben lösen als ein preisreduziertes Getränk. Ein Placebo steigert die Leistung von Sportlern, Wein schmeckt besser, wenn er angeblich teuer war. Und auch Arzneien wirken stärker, wenn sie viel kosten. Ein Medikament wird außerdem als stimulierend empfunden, wenn diese Erwartung bei Patienten zuvor geweckt wurde, obwohl der Wirkstoff tatsächlich entspannend wirkt. Und Lehrer fördern jene Schüler besonders, von denen sie eine hohe Meinung haben, ohne dass dieses Verhalten den Lehrern bewusst oder es für andere offensichtlich ist. Erwartungen übertragen sich sogar: Das Verhalten von Richtern im Gerichtssaal kann die Meinung der Geschworenen auf Linie bringen. Die Liste ließe sich schier endlos fortführen.
Nur wie lassen sich diese Effekte erklären? Laut Irving Kirsch verändern die Erwartungen eines Menschen unmittelbar, wie er seine inneren Zustände erlebt. Wer intensiv in sich hineinhorcht, hört also quasi das Echo seiner Vorstellungen davon, was er dort hören sollte. Introspektion dieser Art ist gleichbedeutend mit der Suche nach bestätigenden Informationen. Wer eine vermeintlich leistungsfördernde Pille geschluckt hat, macht sich auf die Suche nach Signalen für besondere geistige Wachheit. Er wird Hinweise finden und ein falsches Urteil über die Kausalität fällen: Statt der mit erhöhter Konzentration betriebenen Selbstbespiegelung gilt das zuvor geschluckte Mittel als Auslöser des erlebten Zustands – nämlich der erhöhten Konzentration. Das Erleben wird mit der Erwartung in Einklang gebracht.
Aber was hat das alles mit der Überzeugung von Starrköpfen zu tun? Diese Beispiele aus dem Anekdoten- und Studienkasten der Psychologie verdeutlichen eines: Wir sind mitnichten die vernunftbegabten Wesen, für die wir uns halten. Unzählige Kleinigkeiten beeinflussen, wie wir Situationen wahrnehmen; welche Eindrücke für uns relevant sind; worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken; welche Vorstellung wir von Kausalitäten haben und so weiter. Das gilt leider auch für unsere Meinungen, Einstellungen und Überzeugungen sowie für die Art und Weise, wie wir mit Informationen umgehen.
Einen Aids-Leugner von seiner Meinung abzubringen, den Chef für eine ungewöhnliche Idee zu gewinnen oder den Partner dazu zu bewegen, die Aufgabenverteilung im Alltag anders zu regeln, hängt deshalb nicht in erster Linie davon ab, nur die richtigen Fakten zu erwähnen. Für den Erfolg des Unternehmens Überzeugung ist es viel bedeutender, wie diese Fakten präsentiert werden. Auf welche Vorstellungen sie prallen, welche Denkprozesse dabei eine Rolle spielen.
Nehmen wir an, ein Gegner und ein Befürworter der Grünen Gentechnik diskutieren miteinander. Beide sind keine Wissenschaftler, die in diesem Bereich arbeiten, aber beide haben eine ausgeprägte Meinung dazu. Die Diskussion dreht sich um Risiken und Chancen, es fallen Begriffe wie «Monsanto» oder «Zukunft der Ernährung». Beide Kontrahenten haben sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Nun führen sie Studien ins Feld, um ihren Standpunkt zu unterstützen. Doch die Gegenseite bleibt unbeeindruckt und erklärt, warum die erwähnte Studie nichts tauge, das Gegenteil aussage oder sowieso von einer Interessengruppe bezahlt worden sei. Die Auseinandersetzung ist hitzig, und beide Seiten haben das Gefühl, es mit einem Starrkopf zu tun zu haben, der einfach nicht kapiert, worum es geht – der die Fakten nicht im Kopf hat. Dabei haben die beiden Diskutanten zum einen selbst nicht alle relevanten Informationen parat, zum anderen interpretieren sie mutmaßlich die gleichen Aussagen einfach auf gegensätzliche Weise – jeder in seinem Sinne.
Die meisten Wissenschaftler glauben immer noch, dass Menschen an Irrtümern und Mythen festhalten, weil sie nicht über die relevanten Informationen verfügen. Wenn sie doch nur auf deren Grundlage logisch nachdächten, so die Überlegung, würde sich die Qualität ihrer Urteile und Entscheidungen schon verbessern. Der Schluss ist verlockend, aber leider falsch. Seth Kalichman gibt in seinem Buch «Denying Aids. Conspiracy Theories, Pseudoscience, and Human Tragedy» zu bedenken, dass zum Beispiel Holocaust-Leugner sehr vertraut mit der Geschichte des Zweiten Weltkrieges seien, so wie sich HIV-Leugner recht gut mit der Wissenschaft von Aids auskennen. Sie ziehen aus den Informationen schlicht die falschen Schlüsse.
Mehr noch: Zu viele Informationen schaden der Aufklärung sogar. Der deutsche Psychologe Norbert Schwarz von der Universität Michigan hat gezeigt, dass eine geringe Faktendosis mehr Wirkung entfaltet: Drei Gegenargumente erzielten in einem Versuch größere Überzeugungskraft als zwölf. Die größere Zahl von Argumenten festigte den Mythos, statt ihn zu entkräften. Dieser Effekt entstehe, weil es einer größeren Anstrengung bedürfe, sich mit einer Vielzahl von Argumenten auseinanderzusetzen. Schwarz zieht daraus einen klaren Schluss: Aufklärungskampagnen sollten nicht ausschließlich danach konzipiert werden, reine Informationen zu verbreiten. Stattdessen müsse die Frage, wie die Fakten präsentiert werden, viel stärker beachtet werden. Wir berücksichtigen Informationen nämlich nicht mit der eigentlich notwendigen Kühle. Stattdessen spielen unsere Gefühle eine wesentliche Rolle.
Es lohnt sich, das ein wenig zu vertiefen. Der amerikanische Psychologe Paul Slovic hat untersucht, wie Laien und Experten die Risiken neuer Technologien bewerten. Slovic zufolge ist Risikobewertung hochgradig subjektiv und repräsentiert eine Mischung aus Wissenschaft und wichtigen psychologischen, sozialen, kulturellen und politischen Faktoren. Besonders wirkmächtig scheinen die Emotionen zu sein: Sie beeinflussen fundamentale psychologische Prozesse wie Aufmerksamkeit, Gedächtnis oder die Verarbeitung von Informationen. Wie Paul Slovic beobachtet hat, steuern Affekte Einschätzungen, die Menschen abgeben – und nicht umgekehrt. Am Anfang steht das Gefühl, dann folgt die Bewertung. Das klingt deprimierend, ist es auch.
Slovic und sein Team ließen Probanden verschiedene Technologien bewerten, etwa Atomkraftwerke, Automobile, Pestizide oder die zivile Luftfahrt. Fiel die affektive Bewertung einer Technologie (also die Frage, ob man sie eher irgendwie gut oder schlecht findet) positiv aus, dann schrieben die Befragten ihr geringe Risiken und einen großen Nutzen für die Gesellschaft zu. Hatten sie eher eine negative Einstellung, dann hielten sie die jeweilige Technik auch für hochgradig riskant und ihren potenziellen Nutzen zugleich für geringer. Und ja, das galt für Laien wie für Experten. Mitglieder der...
| Erscheint lt. Verlag | 2.9.2013 |
|---|---|
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Psychologie |
| Schlagworte | Chef • Diskutieren • Fundamentalisten • Irrtümer • Mythen • Partner • Überzeugungskraft • Verhandeln • Verschwörungstheoretiker |
| ISBN-10 | 3-644-49041-4 / 3644490414 |
| ISBN-13 | 978-3-644-49041-3 / 9783644490413 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 554 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich