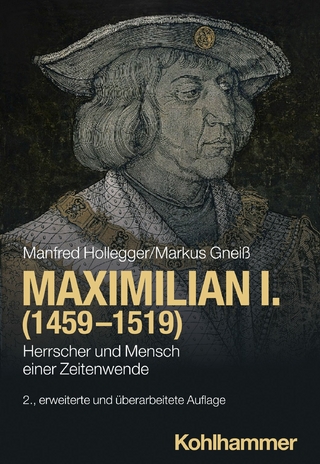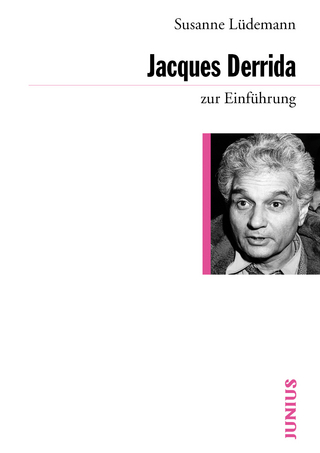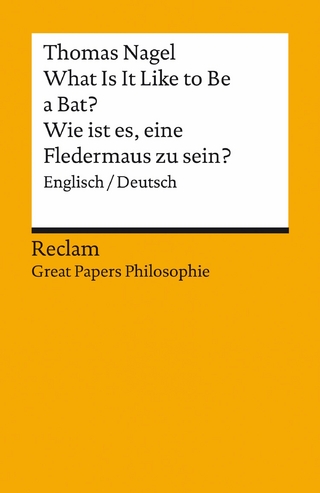Im Sog der Technokratie (eBook)
207 Seiten
Suhrkamp (Verlag)
978-3-518-73337-0 (ISBN)
<p>Jürgen Habermas wurde am 18. Juni 1929 in Düsseldorf geboren. Von 1949 bis 1954 studierte er in Göttingen, Zürich und Bonn die Fächer Philosophie, Geschichte, Psychologie, Deutsche Literatur und Ökonomie. Er lehrte unter anderem an den Universitäten Heidelberg und Frankfurt am Main sowie der University of California in Berkeley und war Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt in Starnberg. Jürgen Habermas erhielt zahlreiche Ehrendoktorwürden und Preise, darunter den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels (2001) und den Kyoto-Preis (2004).</p>
Cover
1
Informationen zum Buch oder Autor
2
Titel
3
Impressum
4
Inhalt 5
Vorwort 7
I. Deutsche Juden, Deutsche und Juden 11
1. Jüdische Philosophen und Soziologen als Rückkehrer in der frühen Bundesrepublik Eine Erinnerung 13
Die wenigen, die zurückkehrten 14
Die Rückkehr der nicht Zurückkehrenden 17
Der innerakademische Einfluss 20
Zwei Initialzündungen 23
2. Martin Buber - Dialogphilosophie im zeitgeschichtlichen Kontext 27
I. Die Blickrichtung auf das Performative 31
II. Der Grundgedanke: Primat der zweiten Person 36
III. Die philosophische Arbeit des religiösen Schriftstellers 41
3. Zeitgenosse Heine: »Es gibt jetzt in Europa keine Nationen mehr.« 47
II. Im Sog der Technokratie 65
4. Stichworte zu einer Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaates 67
5. Im Sog der Technokratie Ein Plädoyer für europäische Solidarität 82
III. Europäische Zustände Fortgesetzte Interventionen 113
6. Der nächste Schritt Ein Interview 115
7. Das Dilemma der politischen Parteien 125
8. Drei Gründe für »Mehr Europa« 132
9. Demokratie oder Kapitalismus? Vom Elend der nationalstaatlichen Fragmentierung einer kapitalistisch integrierten Weltgesellschaft 138
Die Genese der Krise 139
Die nostalgische Option 142
Kapitalismus oder Demokratie? 145
Gründe gegen eine Politische Union 149
Kein europäisches »Volk«? 152
Was nun? 155
IV. Momentaufnahmen 159
10. Rationalität aus Leidenschaft Ralf Dahrendorf zum 80. Geburtstag 161
11. Bohrungen an der Quelle des objektiven Geistes Hegel-Preis für Michael Tomasello 166
12. »Wie konnte es dazu kommen?« Eine Antwort von Jan Philipp Reemtsma 174
13. Kenichi Mishima im interkulturellen Diskurs 180
14. Aus naher Entfernung Ein Dank an die Stadt München 187
Nachweise 194
I.
Deutsche Juden, Deutsche
und Juden
1.
?
Jüdische Philosophen und Soziologen als
Rückkehrer in der frühen Bundesrepublik
Eine Erinnerung[7]
Ich kann bei dieser Gelegenheit keinen Beitrag zur Exilforschung leisten, sondern nur aus der unsicheren Perspektive des Zeitzeugen einige Erinnerungen sortieren. Jüdische Emigranten sind nach der Rückkehr in die Heimat, die sie verstoßen hatte, für eine jüngere Generation zu unersetzlichen Lehrern geworden. Gershom Scholems schmerzliche Feststellung, dass die sogenannte »deutsch-jüdische Symbiose« von Anbeginn eine Mesalliance gewesen ist, trifft soziologisch und politisch zu; sie beleuchtet eine immer wieder verleugnete Asymmetrie im Geben und Nehmen beider Seiten. Eine solche Asymmetrie setzt sich auch in meinen Zeilen fort; ich spreche nämlich aus der Perspektive des Nutznießers, ohne auf die Erfahrungen der Rückkehrer selbst einzugehen, die sich im Klima eines teils feindseligen Ressentiments, teils betreten-kommunikativen Beschweigens des wenige Jahre zurückliegenden Massenmordes zurechtfinden mussten.[8]
Juden haben allerdings seit den Tagen Moses Mendelssohns in der deutschen Philosophie eine so unvergleichliche Kreativität entfaltet, dass die Anteile der einen und der anderen Seite im objektiven Geist selbst verschmolzen sind. Ernst Cassirer hat, als er anlässlich der Verfassungsfeier am 11. August 1928 die vernunftrechtlichen Grundlagen der Weimarer Demokratie gegen deren Verächter verteidigte, aus deutschen Quellen der europäischen Aufklärung geschöpft; so auch, als er dann wenig später, im März 1929, in Davos seine große Kontroverse mit einem damals schon antihumanistischen Heidegger austrug. So musste der jüdische Hintergrund von Autoren wie Husserl, Simmel, Scheler oder Cassirer auch für einen Studenten, der 1949 mit einem halbwegs klaren Bewusstsein des historischen Gewichts von Auschwitz zur Universität gekommen war, keinen philosophisch relevanten Unterschied bedeuten.
Was für uns damals einen Unterschied machte, war das Entzweiende der politischen Lebensschicksale jener vertriebenen Philosophen, die zurückkehrten. Die Wahrnehmung des Emigrantenschicksals von Karl Löwith oder Helmuth Plessner, deren Bücher wir im Bonner Seminar neben denen von Hans Freyer und Arnold Gehlen lasen, ist der Schlüssel zum Verständnis der eminenten Bedeutung, die jüdische Philosophen in der alten Bundesrepublik für den Bildungsprozess von einigen Angehörigen meiner und von vielen Angehörigen der folgenden Generation gewonnen haben. Wir waren durch den Zivilisationsbruch gegenüber dem spezifisch Deutschen in der Tiefe, oder besser den Untiefen, der deutschen Traditionen argwöhnisch geworden. Mindestens intuitiv war uns klar: Wer, wenn nicht sie, die »rassisch aussortiert« worden waren, während ihre Kollegen munter weitermachten, wer sonst könnte eine schärfere Sensibilität für die dunklen Elemente in den besten unserer moralisch korrumpierten Überlieferungen ausgebildet haben?
Die wenigen, die zurückkehrten
Zur Rückkehr entschlossen sich die meisten Emigranten, wenn überhaupt, während der ersten Jahre der neu gegründeten Bundesrepublik. Gerufen wurden die wenigsten. So kamen zwischen 1949 und 1953 die Philosophen Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Helmut Kuhn, Michael Landmann, Karl Löwith und Helmuth Plessner aus dem Exil nach Frankfurt, Erlangen bzw. München, Berlin, Heidelberg und Göttingen zurück. Von ihnen gewannen in den frühen fünfziger Jahren vor allem Karl Löwith und Helmuth Plessner einen über ihre unmittelbare Wirkungsstätte hinausreichenden Einfluss. Löwith mag mit seiner Kritik am heilsgeschichtlich inspirierten Denken der Geschichtsphilosophie einige der Kriegsheimkehrer unter den Studenten auch in ihrer Ablehnung der Ideen von 1789 bestärkt haben; aber die Lektüre von Weltgeschichte und Heilsgeschehen hat in allen Studenten vor allem ein heilsames Misstrauen gegen die ersatzmetaphysische Rolle geschichtsphilosophischer Hintergrundannahmen geweckt. Das andere große Werk, Von Hegel zu Nietzsche, spiegelt noch die Interessen des jüngeren Löwith am Individuum in der Rolle des Mitmenschen. Ich war davon so beeindruckt, dass ich meiner Dissertation nachträglich, das heißt nach Fertigstellung des Hauptteils, ein Einleitungskapitel über die Junghegelianer hinzugefügt habe.
Helmuth Plessner hatte vor der Emigration zusammen mit Max Scheler zu den Begründern der Philosophischen Anthropologie gehört; für uns Studenten blieben auch die älteren Werke, vor allem Die Stufen des Organischen und der Mensch sowie die Studie über Lachen und Weinen, von unverminderter Aktualität. Mit dem Gedanken der »exzentrischen Positionalität« wurde dem autoritären Institutionalismus Gehlens ein auf Zivilisierung, auf gegenseitige Schonung und Takt angelegtes Konzept vom Menschen entgegengesetzt. Im Claire-obscure der frühen Adenauerzeit hatte Plessners Die Verspätete Nation, hatten überhaupt seine politisch-historischen Arbeiten etwas Befreiendes – charakteristischerweise waren es die liberal-linkskatholischen Frankfurter Hefte, die mich zur Rezension dieser Schriften einluden.
Ein spezieller Fall ist Ernst Bloch, der schon 1949 nach Leipzig zurückgekehrt war, der aber, wenn ich recht erinnere, in den Diskussionen der frühen Bundesrepublik keine nennenswerte Rolle spielte. Der Autor des damals vergessenen Buchs Geist der Utopie war bei uns erst seit der Veröffentlichung von Das Prinzip Hoffnung literarisch wieder gegenwärtig. Keinen seiner »wissenschaftlichen« Autoren hat Siegfried Unseld übrigens so verehrt wie diesen. Ein breiteres Echo fanden die rhapsodischen Werke erst im Zuge der Studentenbewegung. Rückblickend darf man vielleicht sagen, dass Blochs expressionistisch geprägter Marxismus als ein eigenwilliges Dokument der Zeit- und der Literaturgeschichte überlebt, innerhalb der Profession jedoch zu wenig bleibende Spuren hinterlassen hat.
Die erwähnten Emigranten hatten alle vor 1933 an deutschen oder deutschsprachigen Universitäten gelehrt. Ihre Rückkehr vollzog sich jedoch nicht immer reibungslos. Beispielsweise konnten die Soziologen Julius Kraft, Gottfried Salomon-Delatour und Alphons Silbermann erst 1957 bzw. 1958 im Zuge der »Wiedergutmachung« an den Universitäten Frankfurt und Köln die Lehre wieder aufnehmen. Der Soziologe und Mannheim-Schüler Norbert Elias lehrte in Leicester und an der University of Ghana in Accra und ließ sich 1975 erst nach seiner Emeritierung in Amsterdam nieder. Von dort aus hat er dann, vor allem mit der 1976 erschienenen Taschenbuchausgabe seines in den dreißiger Jahren entstandenen Hauptwerkes Über den Prozeß der Zivilisation, also erst mit 79 Jahren, eine enthusiastische Gefolgschaft gefunden – und zugleich ein lebhaftes Echo auch über die Grenzen des Faches hinaus. Akademische Außenseiter blieben der Ökonom und Gesellschaftstheoretiker Alfred Sohn-Rethel, der 1978, auch erst mit 79 Jahren, in Bremen Professor wurde, und der Philosoph Ulrich Sonnemann, dem es 1974 gelang, eine Professur in Kassel zu erhalten. Auf dem Campus wurden damals beide zu Kultautoren. Günther Anders, der Sohn des bekannten Entwicklungspsychologen William Stern und einstige Ehemann von Hannah Arendt, war von Haus aus Philosoph. Er hatte bei Husserl promoviert und kehrte schon 1950 nach Wien zurück, aber ohne in den deutschsprachigen Universitäten erneut Fuß fassen zu können. Allerdings erzielte er als philosophischer Essayist und zeitkritischer Schriftsteller, insbesondere mit seinen philosophisch-anthropologischen Überlegungen zum »atomaren Zeitalter«, vorübergehend eine große publizistische Wirkung.
Die Rückkehr der nicht Zurückkehrenden
Es waren also relativ wenige Philosophen, die überhaupt zurückkamen. Aus wirkungsgeschichtlicher Perspektive betrachtet, war manchmal der intellektuelle Einfluss der Emigranten, die nicht in persona zurückkehrten, sogar größer. Die Nachhaltigkeit des posthumen Einflusses Ludwig Wittgensteins, der 1951 starb und mit seinen Philosophischen Untersuchungen sogleich philosophische Weltgeltung erlangte, ist nur mit der Breite der ganz anderen, literarischen und öffentlichen Wirkung Walter Benjamins zu vergleichen. Benjamin war nach dem Krieg in Deutschland in Vergessenheit geraten. Am Schicksal dieses Verschollenen lässt sich exemplarisch die tödliche Gewalt eines Exils ermessen, das Erinnerungsspuren aus dem kulturellen Gedächtnis einer Nation auslöschen kann. In keinem anderen Fall haben sich das Undurchsichtige und anspruchsvoll Exaltierte einer unsteten Lebensgeschichte und die tragische Ironie eines freiwillig-unfreiwilligen Todes kurz vor dem Tor zur Freiheit so unmittelbar von der Entstehungsgeschichte eines Werkes auf die Geschichte seiner Rezeption übertragen.
Innerhalb der Profession hat vor allem Wolfgang Stegmüller erfolgreich an die Tradition des Wiener Kreises angeknüpft. Der Logische Empirismus beherrschte zu dieser Zeit auch die wichtigsten amerikanischen philosophy departments. Neben Rudolf Carnap und Carl Gustav Hempel war die Lektüre von Alfred Tarski, Herbert Feigl, Otto Neurath, Friedrich Waismann und Victor Kraft bis weit in die sechziger Jahre hinein auch ein...
| Erscheint lt. Verlag | 15.7.2013 |
|---|---|
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Philosophie ► Philosophie der Neuzeit |
| Schlagworte | edition suhrkamp 2671 • Elite • ES 2671 • ES2671 • Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2001 • grexit • Griechenland • Großer Deutsch-Französischer Medienpreis 2018 • Heinrich-Heine-Preis 2012 • John-W.-Kluge-Preis 2015 • Kasseler Bürgerpreis »Das Glas der Vernunft« 2013 • Politische Philosophie • Technokratie |
| ISBN-10 | 3-518-73337-0 / 3518733370 |
| ISBN-13 | 978-3-518-73337-0 / 9783518733370 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich