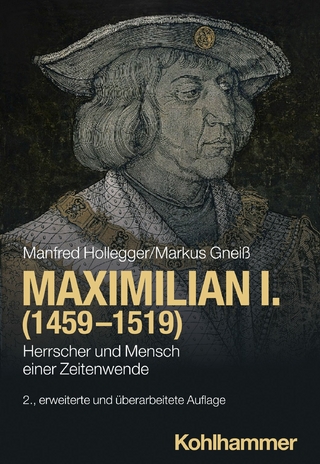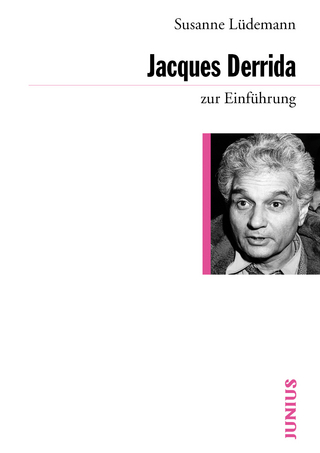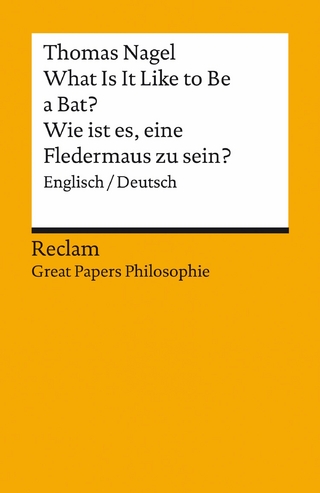Was ist Kritik? (eBook)
375 Seiten
Suhrkamp (Verlag)
978-3-518-73229-8 (ISBN)
<p>Rahel Jaeggi, geboren 1966, ist Professorin für Praktische Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin und leitet dort seit 2018 das <em>Centre for Social Critique</em>.</p> Tilo Wesche ist Professor für Praktische Philosophie an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Im Suhrkamp Verlag erschienen zuletzt: <em>Was ist Kritik?</em> (stw 1885, hg. zus. mit Rahel Jaeggi), <em>Die Rechte der Natur. Vom nachhaltigen Eigentum</em> (stw 2414) und <em>Vernünftige Freiheit. Beiträge zum Spätwerk von Jürgen Habermas</em> (stw 2420, hg. zus. mit Stefan Müller-Doohm und Smail Rapic).
Cover 1
Informationen zum Buch / zu den Autoren 2
Impressum 4
Inhalt 5
Einführung: Was ist Kritik? 7
I Kritik als Praxis 21
Kritik der Zeitverhältnisse Beschleunigung und Entfremdung als Schlüsselbegriffe der Sozialkritik 23
Wie diszipliniert ist (Ideologie-)Kritik? Zwischen Philosophie, Soziologie und Kunst 55
Soziologie der Kritik oder Kritische Theorie? Ein Gespräch mit Robin Celikates 81
II Normative Grundlagen der Kritik 115
Zur Rationalität der Gesellschaftskritik 117
Kritik, und wie es besser wäre 134
Der Grund der Kritik Zum Begriff der Menschenwürde in sozialen Rechtfertigungsordnungen 150
Bürgerliche Philosophie und der Begriff der »Kritik« 165
III Innen und Außen: Konstellationen der Kritik 191
Reflexion, Therapie, Darstellung Formen der Kritik 193
Was ist Kritik? Ein Essay über Foucaults Tugend 221
Genealogische Kritik 247
Was ist Ideologiekritik? 266
IV Kritische Hermeneutik und Wissenschaft 297
Mitspieler und Kritiker Die kritische Hermeneutik des psychotherapeutischen Gesprächs 299
Hermeneutik und Kritik 319
Verstehen – Verdacht – Kritik 339
Wissenschaft und Kritik Einige historische Beobachtungen 353
Über die Autorinnen und Autoren 372
7Einführung: Was ist Kritik?
I
Was ist und wozu betreiben wir Kritik? Die Frage nach den Bedingungen und der Möglichkeit von Kritik stellt sich immer dort, wo Gegebenheiten analysiert, beurteilt oder als falsch abgelehnt werden. Kritik ist, so verstanden, konstitutiver Bestandteil menschlicher Praxis. Immer dann, wenn es Spielräume, Deutungs- und Entscheidungsmöglichkeiten gibt, setzt sich menschliches Handeln der Kritik aus. Wo so oder anders gehandelt werden kann, kann man auch falsch oder unangemessen handeln – und entsprechend dafür kritisiert werden. Sofern sie sich auf soziale Verhältnisse richtet, stellt Kritik gesellschaftliche Werte, Praktiken und Institutionen und die mit diesen verbundenen Welt- und Selbstdeutungen ausgehend von der Annahme infrage, dass diese nicht so sein müssen, wie sie sind.
Sieht es aus dieser Perspektive so aus, als sei die Praxis des Kritisierens aus menschlichen Handlungszusammenhängen gar nicht wegzudenken, so wird andererseits die Frage, »wozu eigentlich (noch) Kritik?«, mit großer Entschiedenheit gestellt. Angesichts gesellschaftlicher Verhältnisse, die sich so darstellen, als gäbe es zu ihnen keine Alternative und in ihnen keine Entscheidungsspielräume, scheint die Möglichkeit von Kritik zu schwinden. Aber auch wenn der Philosoph Richard Rorty behauptet: »the best way to expose or demistify an existing practice would seem to be by suggesting an alternative practice, rather than criticizing the current one«,[1] verabschiedet er auf folgenreiche Weise eine bestimmte Idee von Kritik, wie sie lange unser theoretisches wie praktisches Selbstverständnis beherrscht hat.
Dabei leugnet er, wohlgemerkt, nicht die Veränderungswürdigkeit existierender gesellschaftlicher Praktiken und Institutionen an sich. Infrage gestellt wird hingegen die Annahme eines begründeten Übergangs von der alten, als defizitär beurteilten Praxis zu einer neuen. Es gibt dann keinen Maßstab, von dem her sich die durch 8Kritik motivierte Transformation als ein Fortschritt zum Besseren – und nicht nur als Übergang zu etwas anderem – verstehen ließe. Und es gibt dann auch keine wie auch immer gearteten Ressourcen, die im alten für einen neuen Zustand liegen könnten, wie es noch das auf radikale Transformation setzende Marx’sche Programm will, wenn Marx als Charakterzug seiner »neuen Richtung« hervorhebt, dass diese »nicht dogmatisch die Welt antizipieren, sondern erst aus der Kritik der alten Welt die neue finden« wolle.[2]
An dieser Alternative zwischen kritischer Transformation oder »Sprung« wird ein grundlegender Zug des kritischen Projekts deutlich: Kritik bedeutet immer gleichzeitig Dissoziation wie Assoziation. Sie unterscheidet, trennt und distanziert sich; und sie verbindet, setzt in Beziehung, stellt Zusammenhänge her. Sie ist, anders gesagt, eine Dissoziation aus der Assoziation und eine Assoziation in der Dissoziation. Noch die radikale Widerlegung ist in diesem Sinne eine Bezugnahme, und noch eine Kritik, die auf den Bruch mit einer bestehenden Ordnung setzt, stellt eine Beziehung zu der Situation her, die überwunden werden soll.
An diesem Umstand zeigt sich, wie vorraussetzungsreich die Praxis der Kritik ist und wie wenig selbstverständlich es ist, dass und wie das kritische Unternehmen funktioniert. Die Frage nämlich, wie das so beschriebene Verhältnis zwischen der Kritik und ihrem Gegenstand und zwischen dem Kritiker und dem von ihm Kritisierten im Einzelnen beschaffen ist, führt zu einem ganzen Komplex von Problemen, die im vorliegenden Band auf unterschiedliche Weisen thematisiert werden.
– In welchem Verhältnis steht die Kritik des Alten zur Möglichkeit des Neuen? Beharren die einen auf der Negativität der Kritik, so fordern die anderen von der Kritik ein konstruktives Moment, schon allein deshalb, weil die Kritik des Bestehenden, um wirksam zu werden, die motivierende Kraft eines positiven Gegenbildes zu diesem in Anspruch nehmen müsse.
– Wie sind die Maßstäbe auszuweisen, die es dem Kritiker erlauben, eine gegebene Situation als falsch, schlecht, unangemessen oder defizitär zu kritisieren – und gibt es solche Maßstäbe in einem Sinn, der über das Partikulare, partiell oder lokal Gültige hinausgeht? Infrage steht damit, ob Kritik sich auf universal gültige 9(den bestehenden Praktiken und Institutionen gegenüber »externe«) Wertmaßstäbe beziehen kann oder ob sie angewiesen bleibt auf die schon existierenden Normen einer Gemeinschaft, die dann vom Kritiker gewissermaßen »beim Wort genommen« werden. Sind solche Fragen lange Zeit in der Alternative von »starker« und »schwacher« Normativität verhandelt worden,[3] so rücken heute zunehmend Destabilisierungs- und Subversionseffekte ins Zentrum der Aufmerksamkeit, die als kritische Praktiken die Macht haben sollen, bestehende Ordnungen zu unterlaufen.
– Welches schließlich ist der Standpunkt, den der Kritiker einnimmt? Wird Kritik erst ermöglicht durch die Nähe zum Kritisierten – oder beruht sie, im Gegenteil, auf einer Distanz zum Bestehenden, die erst die Wahrnehmung von Missverhältnissen ermöglicht? Die Behauptung eines epistemologischen Sonderstatus durch den Kritiker, der sich den Verstrickungen in die von ihm kritisierte Realität entziehen zu können glaubt, ist immer wieder kritisiert worden. Und dennoch gehört die Fähigkeit zur Distanznahme möglicherweise zu den Bedingungen der kritischen Praxis.
– Wie steht es aber überhaupt um das Verhältnis zwischen Analyse und kritischer Praxis und damit auch um die Deutungsmacht sozialer Akteure gegenüber der Perspektive der theoriegeleiteten Kritiker? Ist die Artikulation von sozialem Leid schon Kritik – oder bedarf es theoretisch geleiteter Transformationsprozesse, um soziale Erfahrungen artikulierbar zu machen und in (gerechtfertigte) Kritik zu überführen?
II
Das Anliegen des Bandes, diesen Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven nachzugehen, wird von der Überzeugung getragen, dass der Kritik von Beginn an ein zentraler Stellenwert in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften eingeräumt wurde. Eine weitere Ausgangsüberlegung betrifft die Vielgestaltigkeit des Kritikbegriffs. Den Begriff der Kritik, auf den sich beispielsweise die Philosophie verpflichten ließe, gibt es ebenso wenig wie die Philosophie in ei10ner allein in Europa zweieinhalbtausendjährigen Geschichte. Mit dem geschichtlichen Wandel der Sozial-, Human- und Kulturwissenschaften verändert sich auch ihr Begriff der Kritik. Die Frage, was Kritik heißen kann, sucht deshalb nicht nach einem übergreifenden Kritikbegriff. Zudem ist das engere Bedeutungsfeld, dem sich dieser Band schwerpunktmäßig widmet, auf eine Auswahl von Fragestellungen begrenzt, die nicht alle Grenzbereiche wie Kulturkritik, Religionskritik und Bildkritik umfasst.[4] Historisch sind vier Bedeutungen von Kritik zu unterscheiden, die sich unter einem systematischen Gesichtspunkt wechselseitig ergänzen.
So alt wie die Philosophie ist ihr Selbstverständnis als Aufklärung. Im Übergang vom Mythos zum Logos betritt sie die Bühne als eine Erkenntniskritik, die der Grenzziehung zwischen Wissen und Glauben dient. Wie eng Philosophie mit der Kritik am Schein verwoben ist, führen zudem Kants drei Kritiken vor Augen. Dem »Kritizismus« geht es um die Vermeidung von Täuschungen, die sich im theoretischen Wissen als Dogmatismus und im praktischen Wissen als Bevormundung ausdrücken. Solche Täuschungen fallen in das Wissen selbst. So richtet sich Kants Kritik gegen einen Dogmatismus, der den transzendentalen, vom Verstand selbst erzeugten Schein verkennt. Als Kritik an einem Schein, der aus Rationalität erwächst, wendet sie sich im Namen der Aufklärung gegen eine vermeintliche Aufklärung. Solcher Aufklärungskritik kommt in der Philosophie seit Sokrates’ und Platons Abgrenzung von den Sophisten ein fester Platz zu.
Theorien sind zweitens eng mit einer historischen Kritik verknüpft, die der Positionierung gegenüber Alternativen dient. Abgrenzung, Überbietung und Korrektur sind – man denke nur an Aristoteles’ Platonkritik, Hegels Kantkritik oder Kierkegaards, Feuerbachs und Marx’ Hegelkritik – Medien der Selbstvergewisserung. Die theoretische Schlagkraft geht unter anderem auf die Schärfe der Kritik an alternativen Entwürfen zurück, als ob erst im Kontrast das eigene Profil Konturen gewinnt. Denn die Differenziertheit einer Theorie hängt von der Unterscheidungskraft ab, mit der sie vermeintliche Alternativen auszuschließen vermag. Ganz gleich 11deshalb, wie sich eine Theorie zu Alternativen verhält, sich zu ihnen verhalten muss sie.
Unter Kritik werden drittens intellektuelle Tugenden verstanden, auf die etwa die Rede von der ›Rolle des Intellektuellen‹ verweist. Zu dieser emanzipatorischen Kritik zählen alle erdenklichen Formen der ›Einmischung‹ von der Partizipation der Wissenschaften an Prozessen der Meinungsbildung über das Schaffen von Öffentlichkeit bis zum politischen Engagement, das sich nicht organisatorisch vereinnahmen lässt.[5] Ein frühes Zeugnis der emanzipatorischen Kritik herrschender moralisch-politischer Wertvorstellungen stellt das Convivio von Dante Alighieri dar, das sich an Leserinnen und Leser außerhalb der Universität und Kirche richtet mit dem Ziel, sie zur Selbstbestimmung und den Adel zur Umkehr seiner feudalistischen Politik zu führen.[6] Im Mittelpunkt der emanzipatorischen Kritik steht die Praxis. Als Gegenwartskritik stellt sie Diagnosen von Unrecht und greift in das Geschehen durch...
| Erscheint lt. Verlag | 11.3.2013 |
|---|---|
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Philosophie ► Philosophie der Neuzeit |
| Schlagworte | 2006 • Basel • Begriff • Kongress • Kritik • Philosophie • Philosophischer Buchpreis 2024 • STW 1885 • STW1885 • suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1885 |
| ISBN-10 | 3-518-73229-3 / 3518732293 |
| ISBN-13 | 978-3-518-73229-8 / 9783518732298 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich